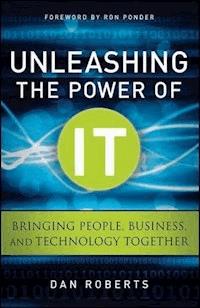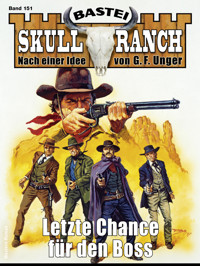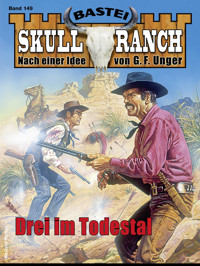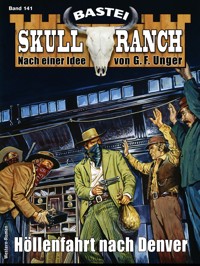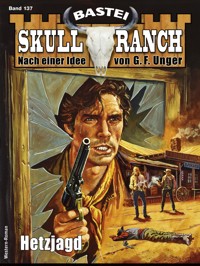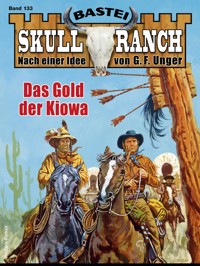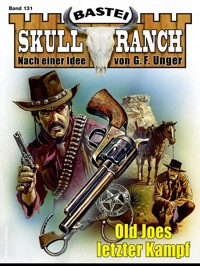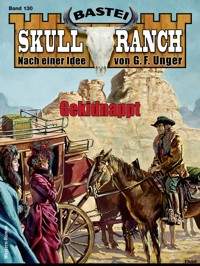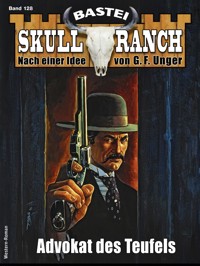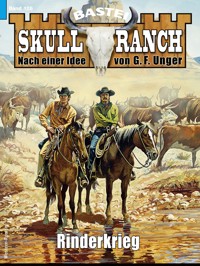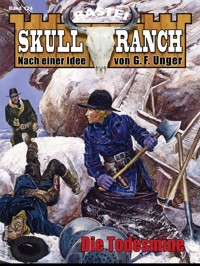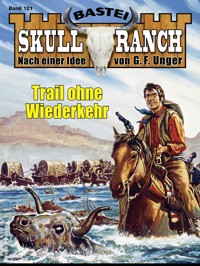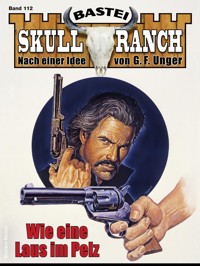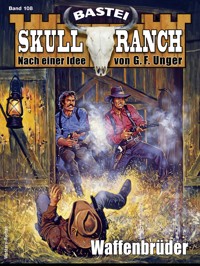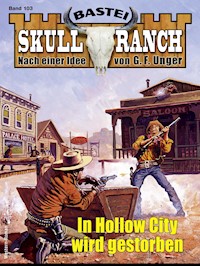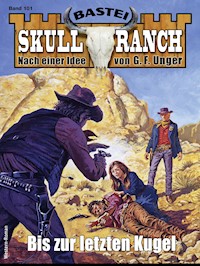1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Skull Ranch
- Sprache: Deutsch
Captain Sanderson ist ein Soldat von altem Schrot und Korn. Befehl ist für ihn Befehl. Daran konnten die vielen blutigen Erfahrungen seines langen Soldatenlebens nichts ändern. Das bekommen auch die zwei Dutzend Soldaten zu spüren, mit denen der Captain im Auftrag der Armee Pferde bei einem Züchter abholen soll.
Und als Sanderson erfährt, dass die bereits bezahlten Tiere von den Kiowa-Indianern gestohlen wurden, handelt er rücksichtslos nach der Devise: Nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Captain Sandersons letzter Befehl
Vorschau
Impressum
Captain Sandersonsletzter Befehl
von Dan Roberts
Captain Sanderson ist ein Soldat von altem Schrot und Korn. Befehl ist für ihn Befehl. Daran konnten die vielen blutigen Erfahrungen seines langen Soldatenlebens nichts ändern. Das bekommen auch die zwei Dutzend Soldaten zu spüren, mit denen der Captain im Auftrag der Armee Pferde bei einem Züchter abholen soll.
Und als Sanderson erfährt, dass die bereits bezahlten Tiere von den Kiowa-Indianern gestohlen wurden, handelt er rücksichtslos nach der Devise: Nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer ...
Seit zwei Tagen beobachten die Krieger schon die kleine Ranch. Sie liegt versteckt in den Rockies, in einem Seitental. Ein breiter Creek durchzieht das Gebiet.
Im Westen endet das Valley blind vor einer Steilwand. Der einzige Zugang ist der von Osten. Dort verbreitert sich das Tal wie ein Trichter. Links und rechts ragen Felswände auf. Pferde sind nicht in der Lage, diese Hindernisse zu überwinden. Höchstens Bergziegen schaffen es, diese Hänge hinaufzuklettern.
Der Krieger liegt dicht an den Boden geschmiegt. Die himmelhohen Ponderosakiefern werfen mächtige Schatten. Von unten kann niemand den Indianer entdecken. Aber er bleibt trotzdem vorsichtig.
Zwei Männer leben und arbeiten dort in dem Tal. Es liegt weit im Süden des Territoriums Colorado, fast am Ende der Gebirgskette, die bei den Weißen Sangre de Christo Range heißt, und die zu den Rocky Mountains gehört.
Ein Mann verlässt das Blockhaus, das aus roh zugerichteten Stämmen erbaut ist. Der Mann geht zum Corral, fängt sich ein Pferd mit dem Wurfseil und sattelte es.
Das ist die richtige Gelegenheit, denkt der Krieger. Aber er wartet noch ab. Denn der zweite Mann, der dort unten lebt, ist der Besitzer der kleinen Pferderanch.
In einem weiteren Corral traben sechs wunderbare Tiere. Sie wirken kräftig und ausdauernd und sind kerngesund. Fünf Stuten und einen Hengst fingen die beiden Weißen gestern ein. Sie warten im Corral auf die Käufer.
Der Reiter verlässt die Ranch, treibt sein Tier in den Canyon. Der zweite Mann bleibt im Haus. Er lässt sich nicht sehen. Ahnt er etwas? Spürt er, dass er beobachtet wird?
Auch manche der merkwürdigen weißen Männer besitzen diese Fähigkeit. Aber fast alle sind den Indianern unterlegen.
Der Krieger wartet noch eine Weile, bevor er vorsichtig zwischen die Stämme der Kiefern zurückkriecht. Erst als er den jenseitigen Rand der Schlucht nicht mehr sehen kann, richtet er sich auf und läuft geduckt los.
Minuten später erreicht er einen klaffenden Spalt, der sich beinahe eine halbe Meile weit quer durch die Felsen zieht. Die Ränder dieses kaum yardbreiten Einschnittes sind dicht mit Gräsern und Bergkräutern bewachsen. Sie hängen hinab, bilden so etwas wie einen herabfallenden Schopf aus gesundem Grün und behindern die Sicht nach unten.
Der Krieger stößt den schrillen Warnpfiff der Bergmurmeltiere aus. Sekunden später dringt von unten schwach die Antwort herauf.
Zufrieden schwingt sich der Indianer in die enge Öffnung. Er braucht nicht hinzuschauen. Er spürt die Vorsprünge und Vertiefungen mit Zehen und Fingern. Und er klettert so geschickt abwärts, als ginge er eine Treppe hinunter.
Kurz darauf steht er vor einem mittelgroßen Mann, der zwei Adlerfedern im Haarschopf trägt. Die große Nase dieses Mannes zuckt, als führe sie ein eigenes Leben, unabhängig von dem Häuptling.
»Einer ist weggeritten, an das Ende der Schlucht«, berichtet der Wolfskrieger seinem Chief. »Die Gelegenheit ist günstig, Big Nose.«
Ja, Big Nose und seine Krieger haben einen weiten Weg hinter sich. Vor Monaten schon beobachteten sie diese Pferderanch, die abseits der bekannten Trails durch das Felsengebirge liegt. Aber damals waren die Tiere noch nicht so weit, dass sie ein langes Treiben ohne Schaden überstanden hätten.
Als Big Nose den Hengst sah, war es um den Häuptling geschehen. Er wusste, dass er dieses Tier besitzen musste.
Der Apfelschimmel ist von einmaliger Schönheit. Und die Kiowa verstehen genug von Pferden, um nicht nur ihre Schönheit, sondern auch ihre Kraft, den Körperbau zu bewundern und richtig einzuschätzen.
Dieser Hengst ist ein ganz ausgezeichnetes Tier.
Wie es aussieht, sind die Kiowa genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Dass fünf Stuten aus der gleichen Zucht mit dem Hengst im Corral am Haus stehen, kann nur eines bedeuten. Nämlich, dass sie verkauft sind, dass sie in den nächsten Tagen abgeholt werden. Die Pferde, die in dem langgestreckten Tal frei aufwachsen, sollen sich an Menschen gewöhnen.
Ahnte Big Nose, was er sich mit diesem Diebstahl einhandeln würde, ließ er die Finger davon.
Aber er weiß es nicht, der schlaue Fuchs. Er weiß nur, dass sein Ziel zum Greifen nahe liegt.
»Reiten wir?«, fragt einer der jungen Krieger erwartungsvoll.
Bedächtig schüttelt der Häuptling seinen Kopf.
»Noch nicht«, antwortet er, »wir warten. Zehn Krieger lenken den anderen Mann ab. Wir reiten zum Blockhaus. Fünf von euch treiben die Pferde aus dem Corral. Seid leise wie die Schlangen. Sobald die Tiere laufen, schneiden wir dem zweiten Mann den Weg ab und bringen die Pferde der fünf Krieger mit.«
Es ist ein einfacher Plan, den Big Nose sich ausgedacht hat. Er hat den Vorteil, dass er jederzeit verändert, einer neuen Lage angepasst werden kann. Vor allem ermöglicht er den Kiowa die Flucht, wenn wider Erwarten etwas schiefgehen sollte.
Die Indianer laufen zu ihren Pferden und ziehen die Sattelgurte straff. Die schweren McClellan-Sättel stammen aus irgendeinem Beutezug gegen die US-Kavallerie. Denn nur die Pferdesoldaten benutzen diese unbequemen Sättel, die der Colonel McClellan eigens für die Army entworfen hat.
Die erste Gruppe reitet los. Über einen schmalen, kaum fußbreiten Steilpfad tasten sich die Tiere abwärts.
Aufmerksam verfolgen die jüngsten Wolfskrieger ihre Gefährten und melden Big Nose, dass die zehn Krieger die Talsohle erreicht haben.
Der Chief nickte nur. Er verzieht keine Miene, aber seine dunklen Augen funkeln vor Erwartung.
Endlich gibt er das Zeichen!
Die anderen sitzen auf, reiten an und folgen Big Nose, der seinen Schimmel als erster auf den Felsenweg leitet.
Als sie die Talsohle erreichen, haben die anderen genügend Vorsprung. Hinter einer leichten Biegung liegt das Blockhaus. Fünf Kiowa sitzen ab. In ihren Ledergürteln, die die wildledernen Hosen halten, stecken Messer und Revolver.
Lautlos laufen die Krieger davon. Sie halten sich dicht an der Felswand, scheinen mit dem Farbton des Gesteins zu verschmelzen. Kein Lichtreflex schimmert auf, kein Stein knirscht, und kein Sand rieselt unter den Mokassins. Vollkommen lautlos arbeiten sich die fünf roten Männer bis zu den Stangen des ersten Corrals vor.
Die Pferde werden unruhig. Ein paar Tiere traben unruhig los. Ihnen ist der Geruch fremd, der von diesen Männern ausgeht.
Beruhigend flüstern die Indianer mit den Pferden. Allmählich gewöhnen sie sich an die fremden Ausdünstungen, und die Kiowa huschen geduckt zum zweiten Corral.
Der Hengst steht dicht an den Stangen. Aufmerksam blickt er die rotbraunen Gestalten an. Das Tier wirkt wie aus Stein gehauen, selbst der Schweif hängt reglos herab.
Unruhig drängen sich die Stuten um den Hengst. Er ist der Boss, und sein Harem folgt ihm blindlings.
Geschickt schieben zwei Krieger die Stangen in den Eisenlaschen zur Seite. Einmal knirscht es leise. Sofort halten die Kiowa inne und warten ab, lauschen, aber nichts rührt sich im Haus.
Endlich ist es soweit. Die Lücke ist weit genug. Der Kopf des Hengstes zuckt zur Seite, als zwei Indianer unter den Stangen in den Corral rollen. Sie kriechen hinter die Pferde. Eine Sekunde später zischt es leise. Erschreckt drängen sich die Stuten dichter an den Hengst. Der verdreht die Augen, scharrt mit den Hufen und schnaubt und prustet. Aber noch wartet er ab.
Erst als das scharfe Rasseln hinter ihm ertönt, springt er aus dem Stand mit einem mächtigen Satz durch die Lücke. Sofort jagen seine Stuten hinter ihm her.
Die beiden Männer rollen sich aus dem Corral, während ihre Gefährten schon wieder die Stangen einschieben. Anschließend laufen die Wolfskrieger zur Felswand zurück.
Noch immer rührte sich nichts im Blockhaus.
Die Indianer laufen auf die Biegung zu, erreichen ihre Pferde und sitzen auf. Big Nose hat mit den anderen Kriegern bereits die Beutetiere eingefangen und liebkost den Hengst, spielt in seiner langen Mähne und redet leise auf das Tier ein.
Die Wolfskrieger haben ihrem Ruf Ehre gemacht. Sie sind die besten, die fähigsten und gerissensten des Stammes. Sie bilden die Leibgarde des Häuptlings, führen die anderen Krieger an und sind eine Art Polizei.
Sie sind die Elite.
Big Nose blickt einen der Unterführer an und nickt. Der Krieger legt den Kopf in den Nacken.
Der durchdringende Jagdschrei eines Rotschulterbussards durchbricht die Stille des Nachmittags.
Der Häuptling braucht nichts zu sagen, keine Anweisungen zu geben. Seine Männer wissen, was sie zu tun haben. Sie bilden einen Dreiviertelkreis um die sechs gestohlenen Pferde und reiten an. Willig folgt der Hengst den Indianerpferden. Und da er antrabt, laufen die Stuten mit. Die Kiowa haben keine Mühe mit ihrer Beute.
Hufe donnern durch das Tal.
Die zehn Krieger, die den Reiter ablenken und beobachten sollten, treiben ihre Pferde im Galopp auf den trichterförmig erweiterten Ausgang zu.
Big Nose hebt die Rechte. Die übrigen Kiowa lösen den dichten Kreis um die Beute. Mehr als die Hälfte der Männer zieht die Gewehre aus den Rohlederscabbards.
Jetzt ist der kritischste Zeitpunkt gekommen.
Das Fenster neben der Tür des Blockhauses fliegt auf. Ein Gewehrlauf blitzt in der Sonne. Und dann peitscht die Winchester. Harmlos sirrt das Blei in den Himmel.
Big Nose beobachtet seine letzten zehn Männer. Sie drängen ihre Pferde in den Schatten der Steilwand, bieten kaum ein Ziel.
Der Mann im Haus denkt gar nicht daran, auf diese Schatten zu feuern. Er schießt sich auf Big Nose ein. Die anderen Krieger reiten hinter ihren Chief. Der Weiße sieht, dass er allein gegen mehr als drei Dutzend Krieger ankämpft und gibt auf.
Sollen sie doch die Pferde mitnehmen, denkt er sich wohl. Hauptsache, ich behalte mein Leben. Und sicher denkt er auch an seinen Partner, der vor kurzer Zeit in den Canyon ritt. Zehn Krieger kamen von dort hinten. Es ist wichtiger, nach dem Partner zu sehen.
Die Kiowa entkommen unangefochten. Außer den fünf oder sechs Schüssen wurde nichts den Kriegern gefährlich. Eigentlich wundern sie sich darüber. Aber sie nehmen es hin, denken nicht weiter darüber nach, sondern treiben die gestohlenen sechs Pferde in die Sangre de Christo-Berge.
Auf Wegen, die nur ein Indianer nachvollziehen oder finden kann, reiten sie nordwärts.
Dort liegt das weite Bluegrass Valley, das vor kurzem noch ihnen alleine gehörte. Aber dann kam der große Weiße, John Morgan. Er brachte drei Männer und tausend gefleckte Büffel mit, denen die Weißen den Namen Longhorns gegeben hatten.
Die Männer, die mit dem Rancher kamen, heißen Shorty, Brazos und Doc Smoky. Angeführt wurden sie von Leroy Spade. Er ist ein Trapper, ein Fallensteller und Bergläufer. Er genießt hohes Ansehen bei der roten Rasse, denn er lebt im Einklang mit der Natur und nimmt das, was sie im Überfluss bietet. Aber er wurde nie so wie die meisten Weißen: zu raubgierigen Winterwölfen, die alles vernichten oder an sich reißen.
Big Nose lässt sein Pferd zurückfallen. Als die Wolfskrieger an ihrem Chief vorbeireiten, ruft er ihnen ein paar Worte in der kehligen Sprache des Stammes zu.
Sie wissen Bescheid. Er wird auf der Fährte warten und beobachten. Stellen sich Verfolger ein, lockt der Häuptling sie auf eine falsche Spur.
Aber nach einem halben Tag stößt Big Nose wieder zu seinen Elitekriegern. Er grinst, dass seine mächtige Nase furchterregend zuckt. Alles ist so, wie sich Big Nose ausgedacht hat. Niemand folgt der Fährte der gestohlenen Pferde nach Norden.
Der Stamm, die Wolfskrieger, haben unter ihrem Chief eine neue große Heldentat vollbracht. Denn Pferdediebstahl zählt zu den größten Tugenden bei den roten Männern.
Niemals nehmen sie einem Mann das Pferd, wenn er sich nicht ohne das Tier am Leben erhalten kann. Es geht hierbei nicht um das Leben, sondern um die Geschicklichkeit. Und wiederum hat Big Nose bewiesen, dass er wirklich der beste Mann ist, der je an der Spitze des Stammes stand.
Die Sonne brennt vom Himmel. Es ist Mittagszeit. Kein Windhauch lindert die Hitze.
Die zwei Dutzend Soldaten sitzen schlaff in den Sätteln. Die meisten Uniformierten haben sich die Käppis tief in die Stirn geschoben, um wenigstens die Augen zu beschatten. Die Männer haben keinen Blick für die Umgebung übrig. Sie sind müde, fühlen sich zerschlagen, und ihnen ist verdammt egal, ob sie durch die Schönheit der Bergwelt oder durch flaches Land reiten.
Der Captain an der Spitze schiebt sich den Hut etwas in den Nacken. Als der Offizier den Kopf wendet und prüfend zu seinen Männern zurückblickt, spürt er heftigen Zorn in sich aufsteigen.
Der Sergeant hat zur Wasserflasche gegriffen und nimmt einen gewaltigen Schluck. Sofort machen es ihm die Soldaten nach.
»Was soll das?«, schreit Captain Horace Sanderson, »ich habe keinen Befehl zum Trinken gegeben.«
»Es gibt Sachen, da kommen wir von selbst drauf!«, ruft einer der Reiter aus der Doppelreihe zurück.
»Wer hat das gesagt?«, schreit der Offizier wütend. »Melden Sie sich, Reiter, los! Ich werde Sie bestrafen.«
»Er sollte auch mal 'nen Schluck Wasser nehmen«, murmelte ein anderer Mann. »Sonst dörrt ihm die Sonne auch noch den letzten Rest Gehirn aus.«
Horace Sanderson presst die Lippen zusammen, dass sie wie dünne, blutleere Striche wirken. Diese verdammten Dreckskerle. Sie haben nicht für einen Cent Disziplin im Leib.
»Wenn noch jemand ohne Befehl trinkt, lernt er mich kennen«, droht der Captain. »Wasser gibt es erst bei der Rast. Der Scout wird uns sagen, wo wir genügend Schatten finden, damit die Pferde ausruhen können.«
Abrupt wendet sich der Captain wieder im Sattel um.
Sanderson verflucht die störrischen Kerle hinter sich, verflucht diesen Auftrag, den der jüngste Second Lieutenant hätte durchführen können und verflucht den Pawnee-Späher, der seit Stunden verschwunden ist.
Verdammt, warum muss ausgerechnet er, Captain Horace Sanderson, diesen Job bekommen? Er ist ein Mann der Garnison, des Appellhofes; ein Offizier, der alle Vorschriften kennt und sich danach richtet. Er gehört längst in den Stab.
Sanderson fragt sich zum hundertsten Mal, warum er immer noch in dreckigen, staubigen Forts Dienst machen muss. Er begreift einfach nicht, dass er kein Mensch für den Stab ist. Er handelt stur nach den Vorschriften, führt jeden Befehl aus und dreht beinahe durch, wenn ein Soldat der Kavallerie die Stiefel oder die blanken Teile der Waffen nicht richtig geputzt hat.
Horace Sanderson gehört zu jenen Menschen, für die jeder Vorgesetzte ein kleiner Gott und jeder Befehl eine heilige Handlung ist, die es auszuführen gilt.
»Er spinnt ziemlich stark heute«, meint einer der vierundzwanzig Soldaten hinter dem Captain.
»Zu heiß«, antwortet sein Nebenmann, »dreht ihm das Gehirn um.«
Die Reiter unterhalten sich ungeniert und laut genug, dass zumindest der rothaarige Sergeant die Worte hören kann.
Glenn O'Toole, ein waschechter Ire, grinst verhalten. Die Boys haben recht. Aber ein Vorgesetzter bleibt ein solcher. Und darum muss Glenn die Reiter zurechtweisen.
Er macht das leise und auf seine unnachahmliche kameradschaftliche Art.
Die Soldaten grinsen und schweigen. Sie wissen, dass der Sergeant den geschniegelten Captain genauso wenig mag wie sie.
Kurze Zeit später hält ein Reiter schräg von links auf die Gruppe zu.
Two Arrows, der Pawneescout, geruht, wieder zurückzukommen.
»Verdammt, Two Arrows«, ruft der Captain, »was soll das heißen?«
Verständnislos blickt der Indianer den Offizier an.
»Wo treiben Sie sich herum?«, will Sanderson wissen. »Ich gab Ihnen Befehl, sich nicht weiter als eine Stunde von der Truppe zu entfernen. Das macht eine Stunde für den Hinritt und eine für zurück. Sie aber sind genau fünf Stunden verschwunden gewesen.«
Der Captain starrt auf das schmucklose Zifferblatt seiner Taschenuhr.
Two Arrows grunzt nur verächtlich, als er diese Worte hört. Aber der Captain gibt nicht auf.
»Ich wette, Sie haben unter einem Baum gelegen und geschlafen«, hetzt er. »Das kenne ich doch, alle Indianerscouts sind Faulpelze und Schlafmützen.«
»Alle Captains, die graues Haar und lange Winter haben«, antwortete der Pawnee, »sind schlechte Soldaten. Sonst wären sie große Führer mit Gold an der Uniform.«
Sanderson zuckt etwas zusammen. Dieser unverschämte, stinkende Wilde hat die empfindlichste Stelle des Offiziers getroffen.
»Dich nehme ich mir vor, wenn wir wieder im Quartier sind«, droht Sanderson wütend. »Du wirst den Tag verwünschen, an dem du dich als Scout zur Army gemeldet hast.«
Two Arrows lächelt verächtlich und spitzt die Lippen, als wolle er vor dem Führer der Truppe ausspucken.
Was will dieser Weiße? Er ist dumm wie eine Beutelratte. Er versteht nichts von der Natur, sieht keines der Anzeichen, die auf den richtigen Weg hinweisen und ist alleine hilflos wie ein Fisch im Sand. Two Arrows beachtet die Drohung des Offiziers gar nicht. Sollte er wirklich Ärger machen, wenn sie wieder in der Garnison sind, so sattelt der Pawnee sein Pferd und reitet davon.
»Zwei Stunden noch, dann sind wir am Ziel«, sagt der indianische Scout kehlig.
Horace Sanderson reagiert sofort. Er will sich für die Unverschämtheit der Soldaten rächen, die eben ohne seinen Befehl Wasser getrunken und ihn beleidigt haben.
»Wir verlegen die Rast!«, ruft der Captain. »In zwei Stunden erreichen wir die Pferdezüchter. Dort gibt es Schatten genug.«