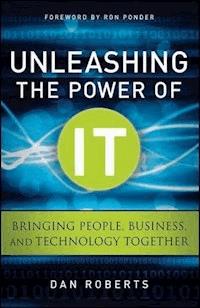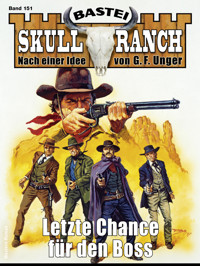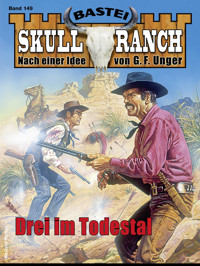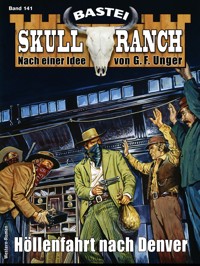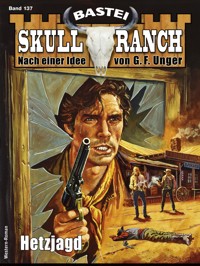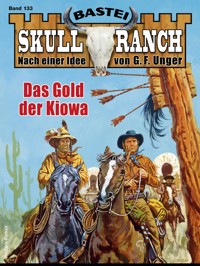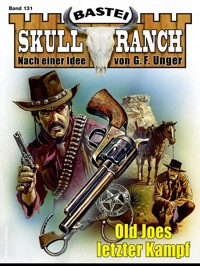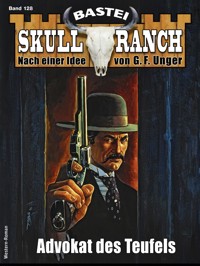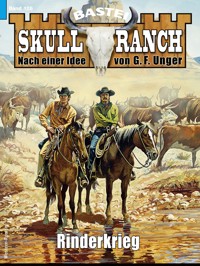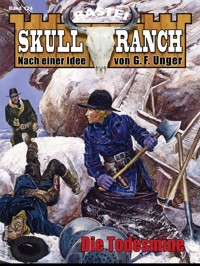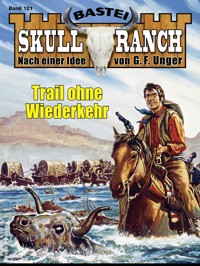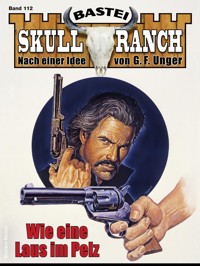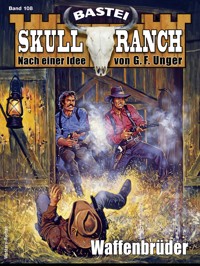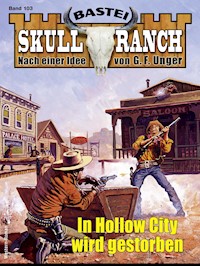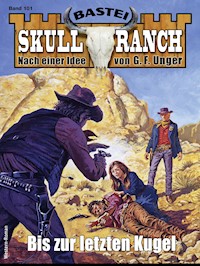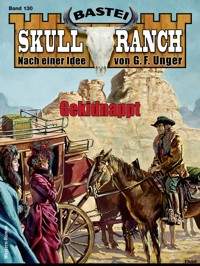
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Skull Ranch
- Sprache: Deutsch
In den Rockies treiben sich vier hartgesottene Burschen herum. Die ausgebrochenen Sträflinge schrecken vor nichts zurück. Als sie von der Skull-Ranch hören, der größten und reichsten weit und breit, wittern sie ihre große Chance.
Ihr Plan steht fest, als sie erfahren, dass der Rancher eine Tochter hat. Sie werden Mary-Lou kidnappen.
Aber vorher nehmen sich die Banditen noch einiges vor...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Gekidnappt
Vorschau
Impressum
Gekidnappt
von Dan Roberts
In den Rockies treiben sich vier hartgesottene Burschen herum. Die ausgebrochenen Sträflinge schrecken vor nichts zurück. Als sie von der Skull-Ranch hören, der größten und reichsten weit und breit, wittern sie ihre große Chance.
Ihr Plan steht fest, als sie erfahren, dass der Rancher eine Tochter hat. Sie werden Mary-Lou kidnappen.
Aber vorher nehmen sich die Banditen noch einiges vor...
Plötzlich durchbricht der Warnpfiff eines Murmeltiers die Stille. Die Sonne steht nur eine Handbreit über den Gipfeln der Berge im Osten.
Vier Männer sitzen in den Sätteln und fassen die Zügel unwillkürlich fester. Der schrille Pfiff hat sie erschreckt.
Der Mann auf dem vordersten Tier sieht über die Schulter zurück und fragt kaum hörbar: »Indianer, Arch?«
Arch Slocum schüttelt den Kopf.
»Nein, Rush, keine Rothäute«, sagt er in normalem Tonfall. »Der Wind hat gedreht und trägt den Murmeltieren unseren Geruch zu. Das reicht, um die Wachtposten nervös zu machen.«
Der dritte Reiter lacht nervös. Sein Lachen fällt etwas zu schrill aus. Die anderen sehen den Mann an, dessen grüne Augen kalt und ausdruckslos wirken. Er fährt sich mit der Linken über die weißblonden Haare und sagt: »Was denn, Freunde, ich drehe nicht durch. Ich drehe nie durch. Aber ich glaube einfach nicht, dass diese Höhlengräber Wächter ausstellen.«
Arch Slocum lacht verächtlich auf.
»Du hast keine Ahnung, Strother«, sagt der kleine Mann. »Die Murmels stellen sogar mehrere Wächter aus, die sich ablösen. Da sieht man, dass du dir deine Dollars immer in den Boomtowns verdient hast.«
»Was dagegen?«, fragt Strother scharf.
Er blickt Arch mit dem fischigen Blick an, dessen Ausdruck sich nie zu verändern scheint. Doch von Slocums Haltung geht plötzlich etwas Bedrohliches aus.
Sie gehen sich auf die Nerven, diese vier abgerissenen Pilger. Seit langen Wochen trailen sie zusammen durch das wilde Land. Ihr Ziel ist Colorado. Dort hoffen sie, in Sicherheit zu sein.
Denn das Gesetz jagt diese vier Männer.
Rush Quinn, Strother Wayfish, Arch Slocum und Flint Castello sind in Yuma, im äußersten Südwestzipfel von Arizona aus dem Staatsgefängnis ausgebrochen.
Eine blutige Spur liegt hinter ihnen. Auf einsamen Ranches, auf abgelegenen Farmen und bei Goldsuchern, die durch die Einsamkeit halb verrückt geworden waren, haben die vier Mordwölfe Beute gemacht. Aus diesen Überfällen stammen die Pferde, die Waffen und stammt die Kleidung der Banditen. Sie alle haben mehr als einen Mord auf dem Gewissen. Und sie alle verdanken es nur ihrem persönlichen Glück, dass sie nicht schon lange gehängt wurden.
Aber Yuma, Yuma war fast so wie der Tod.
Rush und Arch sind beide wegen Mordes zweiten Grades verurteilt. Sie wären niemals mehr aus dem Staatsgefängnis herausgekommen.
Strother hatte zehn Jahre bekommen, weil er im Auftrag eines Minenbosses Arbeiter eines Silberbergwerkes in Arizona zusammengeschossen hatte, als die einen Aufstand machten.
Und Flint Castello hatte das Pech, auf der falschen Seite zu stehen, als es um Wasser in einem Weidekrieg im südwestlichen Arizona ging. Das Gericht wies ihm nach, dass Flint wusste, auf welcher Seite er gestanden hatte, dass er einem Raubrancher, einem Landpiraten den Kampf gegen die rechtmäßigen Besitzer der Wasserstellen führte.
Dafür gab ihm der Richter zwölf Jahre in Yuma.
Aber schon vier Jahre bedeuteten den Tod.
Die Gefangenen mussten in den Steinbrüchen schuften, bis sie zusammenbrachen. Sie atmeten jeden Tag zehn Stunden lang den scharfen, feinen Felsstaub ein und verreckten jämmerlich.
Es blieb die Flucht.
Hunderte hatten sie versucht, und Hunderte waren wieder eingefangen worden. Die meisten verloren die Nerven, wenn die Bluthunde auf ihrer Fährte rannten und ihr wildes Heulen und Bellen hören ließen.
Dieses vierblättrige Kleeblatt jedoch war aus anderem Holz geschnitzt. Sie schafften es, entkamen den Aufgeboten und durchquerten sogar einen Wüstenstreifen, den die Apachen beherrschten.
»Wir müssen weit weg«, hatte Rush gesagt. »Irgendwohin, wo das Gesetz noch nicht fest im Sattel sitzt.«
»Das Goldland von Colorado«, hatte Arch geantwortet, denn er war lange genug alle Möglichkeiten durchgegangen. »Colorado ist Territorium. Da gibt's nur das Bundesgesetz. Und eine Handvoll US-Deputies kann unmöglich das ganze Gebiet überwachen.«
»Und wie kommen wir dahin?«, wollte Strother wissen. »Lassen wir uns Flügel wachsen und fliegen bei Nacht? Am Tage dürfen wir uns nämlich nicht sehen lassen, Archie.«
»Das weiß ich auch«, hatte Slocum erwidert, »aber lass das mal meine Sorge sein. Ihr macht den Plan, wie wir aus diesem verdammten Zuchthaus rauskommen. Und ich führe euch nach Colorado.«
Die anderen hatten ihn angestarrt, als sei er plötzlich verrückt geworden. Denn zwischen Yuma und dem Goldland des Territoriums lagen mehr als achthundert Meilen.
Doch Arch überzeugte seine Kumpane. Es ging schließlich darum, dieses verfluchte Yuma so weit wie möglich hinter sich zu lassen. Und Arch hatte lange Jahre in der Wildnis als Fallensteller und Jäger gelebt.
Und jetzt, jetzt lag dieser mörderische Weg hinter ihnen.
Mörderisch war er in zweifacher Hinsicht gewesen. Einmal hatten die Strapazen die letzten Reserven der Banditen angegriffen. Und zum anderen lagen eine Menge Tote hinter den Halunken.
Das Goldland von Colorado war höchstens noch zwei Tagesritte entfernt, als die vier eine Blockhütte inmitten der Rockies entdeckten. Das Haus war bewohnt, denn aus dem Schornstein stieg Rauch.
Und jetzt warten die entflohenen Sträflinge darauf, dass sich der Trapper zeigt. Denn die Halunken gehen, wie die meisten ihrer Art, kein unnötiges Risiko ein. Eine Kugel aus dem Hinterhalt führt zum gleichen Ergebnis wie ein Schuss von vorne. Aber der heimtückische Feuerüberfall birgt für den Mörder kaum ein Risiko.
»Der Biber rührt sich nicht«, sagt Rush Quinn mit unterdrücktem Zorn in der Stimme. »Los, jagen wir ihn aus seinem Bau. Wir knallen ein paar Kugeln in die Stämme und Fensteröffnungen. Dann wird er schon rausspringen.«
Quinn zieht die Winchester aus dem Sattelschuh und hebelt die erste Patrone ins Lager.
»Nicht, Rush«, sagt Arch warnend, »wenn in der Hütte wirklich ein Trapper oder Mountainman haust, hält er zwei oder drei Wochen durch, wenn wir ihn belagern. Die Kerle haben Vorräte für ein halbes Jahr und Munition für ein ganzes.«
Quinn lacht gemein und erwidert: »Aber er muss irgendwann mal schlafen.«
»Und dann holen wir ihn, Archie, denn wir können uns abwechseln.«
Slocum schüttelt wiederum den Kopf und entgegnet: »Bei jedem anderen, einen Indianer vielleicht ausgenommen, gebe ich dir recht. Aber die Männer der Berge gehören zu einer anderen Sorte. Jeder von ihnen kennt einen ganzen Haufen Tricks. Bis wir diese Hütte stürmen können, sind zwei von uns tot. Dafür garantiere ich euch. Nein, wir warten noch. Wenn der Kerl endlich rauskommt, folgen wir ihm und kreisen ihn ein. Nur so haben wir 'ne Chance.«
Flint Castello grinst und lässt seine perlweißen Zähne sehen. Der Halbmexikaner glaubt nicht so recht an Archs Warnung.
Genauso wenig glaubt Strother Wayfish daran. Im Gegensatz zu den anderen zögert er nicht länger, sondern bringt sein Pferd in Trab.
Das Tier geht über den dichten Teppich aus verdorrten Fichtennadeln. Sein Hufschlag ist nicht zu hören. Ein Dutzend Längen vor dem Blockhaus zügelt Strother das Pferd und sitzt ab. Geschmeidig wie eine Katze gleitet er zur Tür, die mit breiten Lederbändern als Scharnieren befestigt ist.
»Dieser verdammte Narr«, murmelt Arch, »er macht das genau falsch. Wenn wir mit dem Trapper reden wollen, müssten wir offen auf das Blockhaus zureiten und rufen, bevor wir nahe rankommen.«
Aber es sieht so aus, als sei Wayfishs Art doch richtig gewesen. Denn der grünäugige Halunke gelangt ungeschoren bis zur Tür. Vorsichtig drückt er mit der Linken gegen die dicken Bretter. Als sie langsam zurückschwingen, zieht Strother den Colt und spannt den Hahn.
Jetzt ist der Spalt groß genug.
Wayfish springt mit einem Satz in die Hütte.
Zwei Sekunden später erscheint er wieder in der Öffnung. Der Colt steckt im Holster, und Strother ruft laut: »Alles okay, ihr könnt herkommen. Der alte Biber liegt auf einem Haufen Fellen. Scheint krank zu sein, der Bursche.«
Rush Quinn sieht Arch spöttisch an.
Slocum hebt die Rechte halb und sagt ärgerlich: »Schon gut, ich weiß, was du jetzt sagen willst. Aber woher, verdammt noch mal, soll ich wissen, dass der Trapper krank oder betrunken ist?«
Die vier Sträflinge gehen in die Hütte. Aber Flint Castello verlässt schon nach kaum einer Minute die Behausung. Es gibt nicht viel, was ihn interessiert. Darum hält er draußen Wache. Sie müssen aufpassen wie die Luchse, denn ganz sicher haben die Gefängnisbullen inzwischen in alle Richtungen Steckbriefe losgejagt.
Und wer weiß, vielleicht treibt sich gerade hier in den Rockies ein Bursche rum, der einen solchen Steckbrief in der Tasche hat.
»Was ist mit dem Biber?«, fragt Rush, der sich über den alten Trapper beugt.
Aufmerksam betrachtet der Bandit das durch Wind und Wetter gegerbte Gesicht, die wild wuchernden Brauen und Barthaare und den nackten linken Unterschenkel.
Am rechten Fuß trägt der Bewusstlose einen Mokassin nach indianischer Art.
Arch untersucht das nackte Bein, teilt die Haare mit den Fingerspitzen und deutet schließlich auf zwei Punkte, die so groß wie der Kopf eines Schwefelholzes sind. Feuerrot sind diese Male, und von ihnen gehen verfärbte Streifen aus, die nach oben führen.
»Hier, eine Klapperschlange«, sagt Slocum. »Es muss der Urgroßvater aller Felsenklapperschlangen gewesen sein. Ich frage mich nur, wie das Biest den Alten erwischt hat. Die Bergläufer sind mächtig vorsichtig und lassen sich nicht so einfach erwischen.«
»Übersteht er es?«, will Strother wissen, der alle Ecken der Blockhütte durchwühlt.
»Auf keinen Fall«, erwidert Arch, »er hat 'ne Menge Gift im Körper. Es ist sinnlos, jetzt noch die Wunde aufzuschneiden. Ich möchte wirklich wissen, warum er sich den Biss nicht sofort aufgeschnitten hat. Die Kerle sind doch sonst nicht so zimperlich.«
Sekunden später öffnet der graubärtige Alte die Lider. Sein Blick ist trüb und verschwommen. Schweißperlen erscheinen auf seiner Stirn, als er sich aufrichten will.
»Ich war blau, Freunde«, sagt der Bergläufer matt. »Ich habe gar nicht gemerkt, dass mich das Vieh erwischt hatte. Und als ich wieder halbwegs bei mir war, hatte ich keine Chance mehr.«
Arch setzt sich auf den Holzrahmen des roh zusammengenagelten Bettgestelles und sieht den Mountainman an.
»Okay, Biber, wir bleiben so lange hier, bis es vorbei ist«, sagt Slocum. »Früher habe ich selbst eine Zeit lang Fallen gestellt und gejagt. Aber das Geschäft wurde mir zu mühsam.«
Der Trapper grinst verzerrt, als er murmelt: »Hast wohl keine Ausdauer, was, Junge? Es dauert zwei oder drei Jahre, bis du die Tricks alle kennst und richtig Dollars machst. Aber pass auf, dafür, dass ihr hierbleibt, bekommt ihr was von mir.«
Erwartungsvoll kommen Rush und Strother näher an das Lager des Alten.
»Hinten in der Ecke, wo die Fallen liegen«, sagt der Bergläufer, »findet ihr eine lose Planke. Hebt sie hoch. Behaltet das Zeug, ich kann doch nichts mehr damit anfangen. Aber ihr müsst mir noch 'nen Gefallen tun.«
Die drei Halunken sehen sich an und nicken fast zugleich. Was soll es schon? Sie können diesem alten Biber, der bald in die ewigen Jagdgründe eingehen wird, ruhig was versprechen. Ob sie ihr Wort halten, das steht auf einem anderen Blatt.
»Ihr reitet nach Nordosten«, flüstert der Oldtimer und beschreibt den Banditen den Trail ins Shepherd Valley. »Dort findet ihr Leroy Spade. Er ist Bergläufer, wie ich. Jetzt ist er allerdings viel bei einer Schafzüchterin. Sagt ihm, wie ich gestorben bin. Mehr verlange ich nicht.«
Abermals sehen sich die Hundesöhne an. Strother steht auf und geht in die Ecke und findet das lockere Bodenbrett.
Als der Alte das Knirschen hört, verzieht er sein Gesicht zu einem schwachen Grinsen und sagt: »Ihr könnt es wohl nicht erwarten, wie? Es sind ungefähr zwei Pfund. Vor Jahren stieß ich in einem trockenen Sommer auf einen Bach, der kaum noch Wasser führte. Ich sah das Glitzern, wühlte mit den Händen und dem Bowieknife den Boden um und stieß auf eine Goldtasche. Aber das war auch alles. Ich fand nie wieder was von dem gelben Zeug. Nehmt es, sagt Leroy, dass Old Grizzly tot ist.«
Der alte Trapper bäumt sich plötzlich auf. Seine Lippen bewegen sich noch, aber kein Laut dringt mehr aus seiner Kehle.
»Er ist hinüber«, sagt Rush gefühllos. »Hast du das Gold, Strother?«
»Ja, zwei Säckchen. Reiten wir zu dem Shepherd Valley?«
»Das müssen wir uns noch gut überlegen«, erwidert Quinn. »Wenn in dieser Gegend jedes Tal besiedelt ist, sollten wir einen weiten Bogen schlagen. Ich habe keine Lust, einem Sternträger in den Käfig zu marschieren.«
Flint lehnt draußen an der Wand der Hütte. Als seine Kumpane rauskommen, sagt er: »Schauen wir uns das Tal doch mal an. Wir haben nicht genug aus dem Alten herausbekommen. Warum musste der Narr auch so schnell verrecken?«
Sie reden noch eine Weile über die Sache und entschließen sich, zumindest in die Nähe des Shepherd Valleys zu reiten. Sicherlich bieten die Berge genügend Deckungsmöglichkeiten, und die Halunken können das Tal beobachten.
Wird ihnen die Sache haarig vorkommen, ziehen sie sich zurück und verschwinden.
Aber auf der anderen Seite könnten sie gut neue Pferde gebrauchen.
Es genügt schon, wenn sich die Tiere eine Woche ausruhen und sattfressen, dann werden sie weitere achthundert Meilen marschieren.
An diesem Morgen liegen Leroy Spade und Myriam Sunbeam nebeneinander im Schlafraum des Hauses.
Es ist ruhig im Shepherd Valley. Die Tiere grasen in drei Herden, die über das ganze Tal verstreut sind. Paco, der alte Mexikaner, der sich mit Schafen bald besser als mit Menschen auskennt, ist auf dem Muli schon im Morgengrauen losgeritten. Er kontrolliert die Hirten, die Herden und die Hunde.
General Lee, der Schäferhund, den Leroy von der Skull mitgebracht hat, lief unschlüssig hin und her. Offensichtlich konnte er sich nicht entscheiden. Folgte er Paco, so gab es eine Menge Spaß. Denn die Schafe stellten sich ziemlich dämlich an, wenn der Hund zwischen sie fuhr und für Wirbel sorgte. Aber Lee schien sich an den Stock mit der Eisenspitze zu erinnern, den der alte Hirte immer mitführte. Schon mehr als einmal hatte der Hund diese Eisenspitze gespürt, wenn er es mit den Schafen gar zu toll getrieben hatte.
Also blieb General Lee beim Haus.
Er blickt dem Jefe der Hirten nach, bis selbst seine Hundeaugen nichts mehr von dem Muli sehen können. Und dann schleicht General Lee ins Wohnhaus. Wie er die Klinken runterdrücken kann, hat er schon vor langer Zeit herausgefunden.
Myriam dreht sich herum und öffnet die Augen. Sie lächelt, als sie Leroys Gesicht sieht. Zärtlich zeichnet sie mit der Kuppe ihres Zeigefingers die Linien nach.
Der Jäger erwacht, lächelt ebenfalls und nimmt die schöne Frau in seine Arme. Erst nach einem langen Kuss wünschen sich Myriam und Leroy einen guten Morgen.
Etwas atemlos sagt die schöne Frau: »Wenn ein Morgen so anfängt, kann er nur gut werden.«
»Er wird noch besser, glaube ich«, murmelt Leroy kaum hörbar und küsst ihr Ohr.
Als er Myriam behutsam streichelt, geschieht es.
Mit einem harten Geräusch schnappt die Türklinke und General Lee stürmt mit drei mächtigen Sätzen ins Zimmer. Einen Yard vor dem Bett stößt sich der ausgewachsene Schäferhund ab und landet auf den beiden Menschen.
Stöhnend blicken sich Myriam und Leroy an und lachen resigniert.
»General Lee«, sagt Spade streng, »du bist ja schlimmer als ein kleines Kind. Warum bist nicht mit Paco gelaufen, he? Das ist jetzt nicht deine Zeit, Hund. Das ist die Zeit der Menschen.«
General Lee blafft kurz und zieht die Lefzen hoch, als grinse er. Anschließend versucht er, Leroys Gesicht abzulecken. Der Jäger zuckt zurück, und sofort wendet sich der Schäferhund Myriam zu, die weniger schnell als Spade reagiert und die Zunge des Hundes längs über ihr Gesicht gezogen bekommt.
Die Schafzüchterin stößt einen Schrei aus, befreit sich, aber General Lee hält das für ein großartiges Spiel und tobt auf dem breiten Bett herum, als gelte es eine Schafherde oder ein Hühnervolk durcheinanderzuwirbeln.
Es dauert eine Weile, bis Leroy und Myriam den Hund aus ihrem Schlafraum getrieben haben. Sie lachen beide, als Lee mit eingezogenem Schwanz und gesenktem Kopf davontrottet.
Myriam legt Leroy die Arme um den Hals, schmiegt sich an den Jäger und sagt leise: »Ich habe noch nie darüber gesprochen, Mr. Spade. Aber jetzt wird es allmählich Zeit, finde ich.«
Spade zieht die Brauen zusammen und blickt auf die Frau hinab, die fast einen ganzen Kopf kleiner als er ist. Was kommt jetzt, überlegt sich Leroy.
»Was halten Sie eigentlich vom Heiraten, Mr. Spade?«, fragt Myriam und hebt den Kopf und schaut den Bergläufer an.
In Spades pulvergrauen Augen erscheint ein belustigter Ausdruck, aber sein Gesicht bleibt unbewegt.
»Warum sollte ich heiraten?«, fragt er ernsthaft. »Ich habe eine schöne Frau. Die wäre mir sicher böse, wenn ich jetzt irgendein Girl heirate.«
Myriam bläst beide Wangen auf und pustet die Luft langsam zwischen den gespitzten Lippen hinaus.
»Du sollst dir kein anderes Girl suchen, Trapper«, sagt die Schafzüchterin, »du sollst mich heiraten! Wenn du eines Tages herkommst und mir erzählst, dass du eine andere Frau geheiratet hast, verkaufe ich dich mit der nächsten Schafherde. Du wirst in irgendeinem Topf landen, und die Leute werden sich wundern, warum das Hammelfleisch mit Bohnen so komisch schmeckt.«
Leroy Spade spürt den Wunsch der Frau, ihn zu binden. Aber ist noch immer ein Mann der Berge, der Felsenwildnis. Er weiß nicht, ob er noch frei umherziehen kann, wenn er einmal mit Myriam verheiratet ist. Ein Mann verspürt dann Verantwortung. Er muss seine Frau schützen, immer da sein, um Gefahren von ihr fernzuhalten. Es wird nicht so einfach sein, einmal für einige Wochen wieder durch die Rockies zu trailen.
»Ich will dich nicht festbinden«, sagt Myriam und sieht Leroy offen an.
»Ich möchte nur ganz genau wissen, dass wir zusammengehören. Ich möchte sicher sein, dass du zu mir zurückkehrst, wenn du mal wieder unterwegs warst.«
»Und du möchtest sicher sein, dass ich keine andere Frau anschaue, wenn ich umherziehe, nicht wahr?«, fragt Leroy lächelnd.