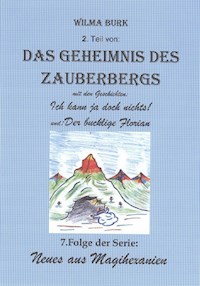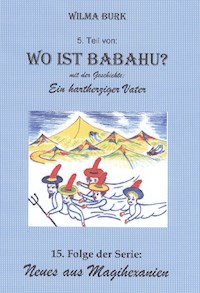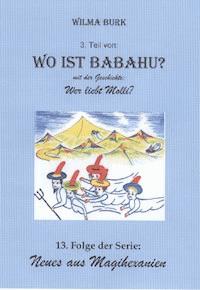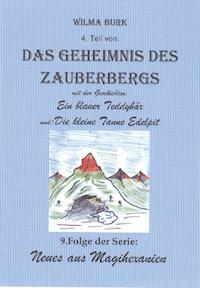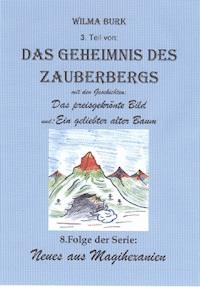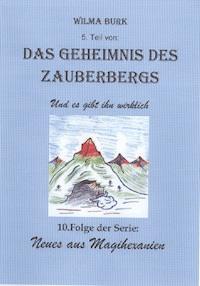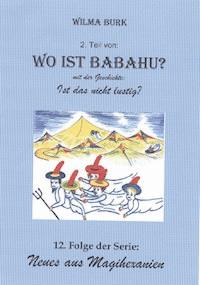2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks Self-Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Drei Frauen, drei Bücher, in drei Generationen von 1948 bis 1996. Hier, in diesem ersten Buch berichtet die Ich-Erzählerin aller Bücher aus ihrem eigenen Leben von 1948 bis 1955. Sie tut das nicht, ohne die Ereignisse auch selbstkritisch zu betrachten. Es spielt in West-Berlin in einer Zeit zwischen Angst und Hoffnung um diese Stadt. Jung und verliebt heiraten sie 1948 während der Blockade West-Berlins. Nun muss sich ihre überschäumende Liebe im Alltag bewähren. Jeder bringt dabei seine eigenen Erwartungen an den andern, an ihr Zusammenleben mit ein. So können Kleinigkeiten bereits zu Enttäuschungen werden. Das Tauziehen beginnt. Wer setzt sich durch? Wie werden sie mit größeren Problemen fertig, wie mit einem Schicksalsschlag? Und bei allem gibt es noch die Sorgen um das Zeitgeschehen. Da ist aber auch noch ein Freund, der es fast zu gut mit ihnen meint, eine Mutter, die sagt, was sie denkt, und eine Familie, die sich mit all ihren eigenen Problemen um sie schart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 656
Ähnliche
Wilma Burk
Tauziehen am Myrtenkranz
Roman. Erstes Buch von: Heute ist alles anders als gestern - besser?
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Impressum neobooks
1. Kapitel
Wieder war ich in einer Situation, wie ich sie hasste. Ich fühlte mich allein und ratlos. Verdammt! Warum hatte mir Mama nicht beigebracht, meine Ellenbogen zu benutzen? Warum sollte ich ein anständiges Mädchen sein - wie sie es nannte -, das stets höflich zurücktrat und Verständnis für die Wünsche anderer hatte?
Hilflos rannte ich mit meinen schweren Taschen auf dem Bahnhof eines Vororts von Berlin an einem Zug entlang, mit dem ich zur Stadt zurückfahren wollte. Doch völlig überfüllt war der bereits in den Bahnhof eingefahren. Dabei waren im März 1948 die „Hamsterzüge“ eigentlich nicht mehr so hoffnungslos überfüllt wie in den ersten Jahren nach dem Krieg. Ja, vor einem Jahr noch, nach dem strengen Winter, da hingen die Menschen wie Trauben an den Zügen, aber inzwischen war es nicht mehr so schlimm. Nur das, was man auf Lebensmittelkarten zugeteilt bekam, reichte nicht zum satt werden. So fuhren die Berliner weiter aufs Land und besorgten sich bei den Bauern, was sie bekommen konnten.
*
Der zweite Weltkrieg war erst drei Jahre her. Die Stadt wirkte mit ihren Ruinen und Schutt in den Straßen verloren. Aber tot war sie nicht, das Leben pulsierte dazwischen weiter. Als Folge des verlorenen Krieges war Berlin eine geteilte Stadt. Deutschland war unter den vier Siegermächten, Amerika, England, Frankreich und der Sowjetunion, in vier von ihnen besetzte Zonen aufgeteilt worden und Berlin zugleich in vier Sektoren. Als es mehr und mehr zu Spannungen zwischen der Sowjetunion und den Westmächten kam, wirkte sich das bald auch auf die Stadt aus. Die drei Westmächte schlossen sich mit ihren gemeinsamen Interessen in den drei Westsektoren zusammen und die Sowjetunion grenzte sich mit ihrem besetzten Ostsektor ab. Daraus entstanden bald West-Berlin und Ost-Berlin. Doch am Ende des Winters 1948 gab es noch keine Mauer und die Menschen strömten hinüber und herüber, wie sie wollten, auch in das Umland der Stadt.
Hunger herrschte in den Westsektoren ebenso wie in dem Ostsektor. Die Bauern in der Umgebung Berlins, die zur Ostzone der Sowjetunion gehörte, konnten sich kaum retten vor den hungrigen Städtern, besonders, wenn der Winter zu Ende ging.
Auch Mama hatte wieder geklagt, dass ihre Lebensmittelvorräte bedenklich zusammengeschrumpft waren. Was ja kein Wunder war, bei dem ständigen Appetit meines Bruders Bruno, meiner Schwester Traudel und sicher auch mir. Wie gut, dass wir zu den Glücklichen zählten, die eine Tante mit einem Bauernhof draußen im brandenburgischen Land hatten. Das ersparte uns, unseren Haushalt nach möglichen Dingen zu durchforschen, die man beim Bauern gegen Lebensmittel eintauschen könnte. Der Spruch: „Die Bauern würden ihre Kuhställe bald mit echten persischen Teppichen auslegen“, machte hinter vorgehaltener Hand bereits die Runde.
Diesmal war ich mit einer Hamsterfahrt zu Tante Luise an der Reihe. Mein Bruder Bruno hatte vor Kurzem erst einen Sack Kartoffeln von ihr angeschleppt und einige Zeit davor Mama Eier, Speck und mehr. Was Tante Luise eben so geben konnte.
Schon früh im Morgengrauen hatte ich mich an diesem Tag auf den Weg gemacht. Erst ging ich fast allein die verschlafenen Straßen entlang. Ich fand es gruselig, wie der Mond durch die Fensterhöhlen der Ruinen schien. Bald aber war es erst ein Mensch, dann noch einer, der vor mir oder hinter mir ging. Immer mehr strebten dem Bahnhof zu wie ich. Und alle hofften, am Abend mit ihren Rucksäcken oder Taschen, voll gefüllt mit Nahrungsmittel, wieder heimkehren zu können.
Bereits vor der Abfahrt in Berlin wurde am Morgen auf dem Bahnsteig gedrängelt, geschoben und geschubst, um in den Zug hineinzukommen. Höflich, wie ich erzogen war, ließ ich diesem und jenem den Vortritt und war schließlich froh, überhaupt hineingekommen zu sein. Ich hatte nicht erwartet, schon mit einem fast überfüllten Zug aus Berlin loszufahren. Beklommen fragte ich mich da bereits, wie es wohl am Abend bei der Heimfahrt sein würde.
Noch ahnte ich nicht, welche Bedeutung der Tag für mich haben sollte, als ich an diesem Morgen in einem Eisenbahnabteil zwischen den beiden Sitzreihen stand. Was heißt, stand? - Ich hing an einer Haltestange des Gepäcknetzes über den Sitzenden und drohte schwankend, bei jedem Ruck des Zuges, auf dem Schoß des Glücklichen vor mir zu landen, der gerade noch einen Sitzplatz erwischt hatte. Noch standen meine Taschen faltig und leer am Boden, und ich hoffte, dass Tante Luise sie wieder mit essbaren Schätzen füllen konnte. Mit meinen Füßen versuchte ich sie festzuhalten. Nein, ein Vergnügen war so eine Hamsterfahrt nicht.
Onkel Fred, Tante Luises Mann, holte mich mit einem Pferdefuhrwerk vom Bahnhof ab. Ich hörte bereits das Schnauben der Pferde, als ich mich zwischen eilig davon strebenden Menschen aus dem Bahnhof drängte. Wer außer mir wurde hier schon abgeholt? In alle Richtungen eilten die Menschen mit ihren leeren Rucksäcken und Taschen. Einige wussten inzwischen, wo sie etwas bekamen, viele aber wollten noch die Ersten sein, die einen Bauernhof erreichten, um vielleicht wenigstens Kartoffeln zu erhalten. Wenn so mancher wüsste, womit ich in meinen Taschen heimfuhr, der wäre sicher neidisch geworden.
„Na, Mädchen, ist bei euch wieder Not in der Speisekammer?“, rief mir Onkel Fred entgegen als ich aus dem Bahnhof trat. Breit saß er auf dem Kutschbock seines Ackerwagens, ein kerniger Bauer mit rotem von Wind und Wetter zerfurchtem Gesicht. Unter seiner warmen Schirmmütze mit den Ohrenklappen sah er mich mit seinen hellen gutmütigen Augen an. Das war schon viel, was Onkel Fred sagte. Redselig war er nie. Er erwartete auch keine Antwort. Aber fürsorglich legte er mir die Decke um die Beine, nachdem ich zu ihm auf den Kutschbock geklettert war. Das war gut bei der noch immer eisigen Kälte.
Onkel Fred hob die Peitsche, und mit einem „Hüh!“ setze er die Pferde in Trab. Langsam zogen wir an den Menschen vorüber, die ihres Weges gingen, von Bauernhof zu Bauernhof, in diesem Ort oder im nächsten. Vielleicht liefen einige auch zu einem weiter entfernten Ort, wobei sie hofften, viele würden sich den weiten Weg nicht machen, und so ihre Chance größer sein, dort etwas zu bekommen. Manch neidischer Blick traf mich im Vorbeifahren.
Bald hatten wir die Menschen zurückgelassen, und näherten uns dem Ort, der dort am Ende der Landstraße vor uns lag. Zeigte der Winter auch noch, was er konnte, so kündigte sich der Frühling bereits an. Die Vögel begannen ihr Lied zu singen, und die Bäume links und rechts der Chaussee wirkten nicht mehr so kalt und grau. Die Pferde dampften und schnaubten und zogen uns in ruhigem Trott die Straße entlang. Die weiße Schneedecke auf den weiten Feldern war dünn geworden, sie ließ hier und da braune Erde durchsehen. Einen würzigen Duft von fruchtbarem Boden brachte der Wind mit, der uns bei der Fahrt eisig in die Wangen kniff.
Tante Luise erwartete uns bereits. Die Hühner im Hof stoben gackernd auseinander und die Gänse, die träge in der Ecke lagen, standen irritiert schnatternd auf, als die Pferde den Ackerwagen rumpelnd durch das große Tor auf den Hof zogen. Der Hofhund bellte und zog an seiner Kette, an der er am Tag angemacht war. Ihn musste ich zuerst begrüßen, als ich vom Kutschbock sprang, sonst hätte er uns ausdauernd nachgejault. Doch schon kam Tante Luise aus dem Haus gelaufen. Ihre lustigbunte Kittelschürze flatterte, ihr kräftiger Busen wogte und ihre drallen Arme drückten mich fest an sich - mir blieb fast die Luft weg.
„Katrina, Kind, da bist du ja! Bin ich froh, dass du gut angekommen bist“, rief sie. Offenbar machte sie sich wirklich jedes Mal Sorgen, wenn ich allein aus der Stadt zu ihnen kam. Für Tante Luise blieb ich eben immer das „Kind“, trotz meiner inzwischen zwanzig Jahre. Dann schob sie mich ein Stück von sich und sah mich kritisch an. „Ich glaube, du bist wieder dünner geworden“, stellte sie fest. Auch das tat sie jedes Mal. Ich wusste, gleich würde sie vor mir auf den Tisch stellen, was ihre Vorratskammer zu bieten hatte, so als könne sie den Makel damit sofort beseitigen.
Ich war gerne bei ihr. Es gefiel mir, in ihrer molligen Bauernküche auf der Bank am blank gescheuerten Holztisch zu sitzen, während im Herd brennende Holzscheite knisterten und der letzte Frost des Winters Eisblumen in eine Ecke des Fensters malte. Ich aß eine Scheibe von dunklem Bauernbrot, dick mit süßem Quark bestrichen, und sah zu, wie Tante Luise meine Taschen mit Kostbarkeiten wie Eiern, Speck, selbst gemachter Wurst und sogar mit einer Ente füllte. Eifrig lief sie dabei zwischen ihrer Vorratskammer und der Küche hin und her. Sie verstand es, alles sorgsam einzupacken, dass auch ja kein Ei auf der Heimfahrt entzweiging. Immer wieder strich sie sich die vorwitzigen dunklen Locken zurück, die ihr von ihrem sonst straff gekämmten Haar ins Gesicht fielen, und dabei überfiel sie mich mit einem Schwall von Fragen. Ja, Tante Luise wollte alles genau wissen: Wie es Mama und Papa ging, was mein Bruder Bruno machte oder meine Schwester Traudel und wie es bei uns im Westteil der Stadt aussah.
Ein Fremder war an die Hoftür gekommen und hatte um ein paar Kartoffeln gebettelt. Ich hörte Tante Luise ablehnen, ihren Seufzer hinterher und war froh, selbst nicht bettelnd von Hof zu Hof gehen zu müssen.
„Augenblicklich laufen einem die Berliner wieder das Haus ein. So viel kann man gar nicht haben, wie man da geben möchte“, erklärte Tante Luise, als sie in die Küche zurückkam.
Als es am späten Nachmittag Zeit war heimzufahren, wünschte sie mir: „Nun komm nur mit all den Sachen gut nach Hause“, ehe mich Onkel Fred mit seinem Ackerwagen wieder zum Bahnhof zurückbrachte.
Ja, das war nie sicher, weil bei jeder Heimfahrt am Bahnhof Kontrolleure stehen konnten, die bei diesem oder jenem sehen wollten, was er in seinem Gepäck mit sich führte. Denn eigentlich mussten die Bauern abliefern, so viel sie konnten. Wie oft tauchten darum vor dem Bahnhof unerwartet Männer auf und ließen sich von einigen zeigen, was sie in Rucksack oder Tasche hatten. Nicht selten wurde so manch einem dabei wieder abgenommen, was er sich zuvor erbettelt hatte. Mir war es bisher noch nie passiert, aber die Angst davor blieb. Je näher wir dem Bahnhof kamen, desto mehr fror ich - vor Kälte oder vor Spannung und Furcht?
Onkel Fred hielt schon ein ganzes Stück vor dem Bahnhof an. „Den Kontrolleuren möchte ich nicht begegnen“, sagte er.
Beklommen stieg ich vom Kutschbock hinunter und nahm die schweren Taschen. Von allen Seiten kamen jetzt die teilweise noch mageren Gestalten schwer beladen mit Rucksäcken und Taschen zum Bahnhof. Jeder hoffte, das Essbare, was er sich bei seinem Weg von Bauernhof zu Bauernhof erbettelt oder gegen irgendetwas beim Bauern eingetauscht hatte, nach Hause zu bringen. Wir hatten Glück, ein Kontrolleur war heute nicht zu sehen.
Auf den Bahnhof wurde ich mehr geschoben, als dass ich ging. Schwer trug ich an den Taschen. Zitternd vor Kälte stand ich schließlich zwischen Säcken, Koffern, anderem Gepäck und Menschen am Bahnsteigrand und wartete auf den Zug. Unter meinem Mantel trug ich eine alte, viel zu weite Hose von Papa. Aber auch sie schützte mich vor der Kälte nicht - oder fror ich so, weil ich voll Bangen sah, wie die Menschenmauer auf dem Bahnsteig beängstigend anwuchs? Nervös zog ich den Knoten des Kopftuchs unter meinem Kinn fester. Die Hände waren mir klamm und wollten mir kaum gehorchen.
Die Abenddämmerung war fast in Dunkelheit übergegangen, als endlich der bereits überfüllte Zug einfuhr. Bewegung kam in die Menschenmauer. Jeder griff sich, was er hatte. Schwer beladen drängten sie zu den Abteilen. Das war ein Schubsen, Stoßen, Zetern und Schreien! Dicke Menschentrauben bildeten sich vor den wenigen Wagen. Und ich ratlos dazwischen! Ich war es, die geknufft, gebufft und beiseite geschoben wurde. Ich verdammte die mir anerzogene Höflichkeit und Rücksichtnahme, die mich daran hinderte, den Menschen kräftig auf die Füße zu treten. Verzweifelt rannte ich noch immer mit meinen schweren Taschen am Zug entlang, als es die meisten bereits aufgaben. Einige erklommen die Dächer der Waggons oder banden ihr Gepäck auf den Trittbrettern fest. Wie in den schlimmsten Zeiten der „Hamsterzüge“ nach dem Krieg hockten sie sich daneben. Ratlos liefen mir Tränen über das Gesicht. Ich merkte es nicht. Wäre doch Mama jetzt hier, oder irgendjemand, der mich an die Hand nähme und mir sagte, was ich tun sollte. So dachte ich, hörte auf zu rennen und blieb ratlos stehen. Dieser Zug würde ohne mich abfahren. Wie so viele andere würde auch ich zurückbleiben. Und was dann?
Keine Menschentraube drängte sich mehr vor irgendeinem Waggon. Der Stationsvorsteher mit seiner roten Mütze und der Kelle in der Hand, stand an der Bahnsteigkante und rief ständig eindringlich: „Zurücktreten!“ Da sprang von einer schon überfüllten offenen Plattform vor dem Eingang eines Eisenbahnwagons vor mir ein Mann herunter. Er ergriff mich und meine Taschen, riss sie mir aus der Hand, reichte sie hoch zu den Menschen auf der Plattform, packte mich und schob mich vor sich her hinauf.
Hätte ich mich auflehnen und wehren müssen? Nein, ich weiß nicht, warum, doch ich ließ es geschehen und war einfach froh, dass jemand für mich handelte. Alles geschah so schnell. Meine Taschen landeten auf einem Berg von Gepäckstücken und ich hing mehr an dem Zug, als dass ich auf der Plattform stand. Doch fest an den Körper des Fremden gepresst, schob er mich zwischen die zusammengequetscht stehenden Menschen, denen es kaum noch möglich war, sich zu rühren. Nur widerwillig gaben sie nach, bis die Tür der offenen Plattform geschlossen werden konnte. Am liebsten hätte ich zu jedem, mit dem ich in Berührung kam, gesagt: „Entschuldigen Sie bitte!“
Doch ohne den Fremden würde ich jetzt hier nicht stehen und mit dem Zug nach Berlin fahren können. Ich wischte mir die Tränen aus den Augen und sagte leise: „Danke.“ Der Fremde lächelte zu mir herab. Schnell blickte ich zur Seite. Bewegen konnte ich mich kaum. Auch sonst fühlte ich mich wie gelähmt. Von diesem Fremden ging etwas mir Unerklärliches aus, was mir fast die Luft nahm. Mir war, als spürte ich jede Faser seines Körpers. Sein Atem streifte mein Gesicht. Auch wenn ich es gekonnt hätte, ich wäre unfähig gewesen, mich nur einen Schritt von ihm zu entfernen.
Verwirrt, willenlos meinen Gefühlen ausgeliefert, stand ich inmitten der Menschen an ihn gepresst. Noch nie hatte ich Ähnliches erlebt. Ein Mensch war in mein Leben getreten, der eine mir unerklärliche Gewalt über mich zu haben schien. Alles was mir Mama gesagt hatte, wie distanziert sich ein anständiges Mädchen zu verhalten hätte, wie vorsichtig ich Fremden gegenüber sein sollte, nichts davon schien mehr zu gelten. Was war geschehen?
Der Stationsvorsteher rief: „Vorsicht an der Bahnsteigkante!“ Ich hörte seinen Pfiff, mit dem er dem Zug die Fahrt freigab. Langsam, ganz langsam rollten knirschend die Räder auf den Schienen. Die Lokomotive stieß zischend und fauchend Dampf und Rauch in die Luft. Gemeinsam im Takt der ruckenden Wagen schwankten unsere Körper hin und her. Die vielen Menschen, die auf dem Bahnsteig zurückbleiben mussten, sahen enttäuscht zu, wie der Zug aus dem Bahnhof rollte. Wir fuhren! Ich wollte gerade aufatmen, da blieb der Zug stehen. Die Lokomotive stampfte leise vor sich hin. Über Lautsprecher wurden alle, die auf den Dächern saßen, aufgefordert, den Zug zu verlassen.
Unwillkürlich duckte ich mich, mussten auch wir von diesem offenen Peron herunter? Dabei spürte ich, wie der Fremde versuchte, trotz des Gedränges, seinen Arm um meine Schulter zu legen. „Das gilt nicht für uns“, sagte er.
Beruhigt atmete ich auf. Nein, wir waren nicht gemeint. Und die Menschen von den Dächern fanden tatsächlich noch Platz in dem Zug. Wie, weiß ich nicht. Irgendjemand sagte, sie seien durch die Fenster in die Abteile hineingekrochen.
Endlich setzte sich der Zug mit Zischen und Fauchen wieder in Bewegung, schneller und schneller. Wir fuhren. Dicke Wolken mit Funken vermischt spuckte die Lokomotive in den dunklen Himmel. Ruhe kehrte unter den Menschen ein. Zaghaft wagte ich einen ersten Blick in das Gesicht über mir. Soweit ich es in der Dunkelheit erkennen konnte, sahen helle Augen auf mich herab und sein Lächeln wollte mich beruhigen. Ich erwiderte es verlegen und errötete. Gut, dass er das in der Dunkelheit nicht erkennen konnte. In der Menge dicht an ihn gepresst, glaubte ich, seine Wärme zu spüren.
Verlegen starrte ich auf einen Knopf an seinem Mantel, dessen Kragen er hochgeschlagen hatte, der aber seine sicher rot gefrorenen Ohren kaum erreichte. Er hatte keine Kopfbedeckung auf. Er musste frieren in dem eisigen Fahrtwind, der uns umwehte. Von Zeit zu Zeit bedeckte er seine Ohren mit den Händen. Schüchtern bot ich ihm mein Halstuch an. Er schlug es lachend aus. Ja, was sollte er damit, es sich um den Kopf binden? Wie würde das aussehen? Da lachte auch ich.
Die Spannung der Menschen begann sich zu lösen. Ihre Freude, mit dem Zug mitgekommen zu sein, machte sich in ersten launigen Bemerkungen Luft.
„Sie, Männekin, wenn se nich sehn wolln, wat ick zu Mittach jejessen habe, denn nehm se ma lieba ihren Ellenbogen aus meine Magenjegend!“, rief einer irgendwo neben mir in dem Knäuel zusammengepresster Menschen. Befreites vielstimmiges Gelächter antwortete ihm.
„Ich glaube, ich stehe auf einer Kartoffel, auf einer einzigen, mit einem Bein“, verkündete mit piepsiger Stimme eine Dame, die irgendwo eingekeilt war. Wäre sie nicht eingeklemmt von den Körpern um sie herum, so wäre sie wahrscheinlich umgefallen.
Lachend stellten einige fest, dass es ihnen genauso erginge. „O je, mein Kartoffelsack is uffjejangen!“, dröhnte eine tiefe Stimme.
„Wat denn!“, rief da der Erste. „Ihr tretet uff det kostbare Jut rum? Det jeht aba nich, Leute! He, Männekin, se sind dünne jenuch, tauchen se mal unter und fangen se die Ausreißer wieder ein.“
Dass der Dünne der Aufforderung nachkam, merkte daran, dass ich enger an den Fremden gedrängt wurde. Schützend versuchte er mit den Armen den schlimmsten Druck von mir fernzuhalten. Noch immer stand ich wie gelähmt. Doch ich fand es überhaupt nicht unangenehm, so an ihn gedrängt zu werden. Im Gegenteil, in mir kam der Wunsch auf, einfach meinen Kopf an seine Schulter zu legen. Hatte ich mich verliebt? Geht das so schnell?
Der Dünne schnappte nach Luft, als er wieder an der Oberfläche erschien. „Melde, so viele Kartoffeln wie möglich eingefangen!“, berichtete er.
Wie hatte er das nur geschafft? Er musste ja zwischen den Beinen der andern herumgeangelt haben. Aber irgendwie hatte er es erreicht, sie wieder in den Sack zu stopfen. Der Besitzer dankte es ihm mit vielen Worten. Ja, alle um ihn herum schienen sich mit ihm zu freuen.
Plötzlich war bei den auf der Plattform zusammengezwängt stehenden Menschen vergessen, dass sie sich vorhin auf dem Bahnsteig am liebsten gegenseitig weggestoßen hätten, um nicht zurückbleiben zu müssen. Als hätte es das nicht gegeben, begannen einige sich zu unterhalten, während der Zug durch die Dunkelheit fuhr. Mit dem Rauch und Dampf der Lokomotive schwirrten Funken wie Glühwürmchen durch die Luft.
Auch der für mich noch Fremde und ich begannen stockend und zögernd ein Gespräch, obgleich es schwierig war, etwas zu verstehen, bei dem Gewirr der Stimmen um uns herum. Nach den Fragen: „Wo müssen Sie hin?“ – „Wo kommen Sie her?“ sprachen wir davon, wie es uns im Krieg ergangen war. Ich erfuhr, dass sein kleiner Bruder, sechzehn Jahre alt, als Flakhelfer bei einem Bombenangriff auf Berlin gefallen war und dass bei der Zerstörung seines Elternhauses durch Bomben auch seine Mutter umkam. „Mein Vater wurde kurz darauf in Russland für vermisst erklärt. Doch man glaubt, er sei gefallen“, sagte er.
Ich schwieg kurz betroffen. Wie gut war es mir dagegen ergangen. „Wir, unsere ganze Familie, hatten Glück. Wir haben alles gut überstanden“, erklärte ich leise, fast mit einem schlechten Gewissen, dass ich nicht wenigstens berichten konnte, bei einem Bombenangriff unsere Wohnung verloren zu haben. Wie viele gab es überhaupt noch, denen wie uns, trotz Bombenhagel, ihr Zuhause erhalten geblieben war?
Die Fahrt war lang. Wir hatten viel Zeit zum Reden. Seltsam, wann habe ich einmal einem Fremden so viel von mir erzählt und genauso viel von ihm erfahren? Es war, als wäre es wichtig, dass wir dies austauschten. Nicht einmal die Zuhörer um uns herum störten uns dabei. Wir hatten nur Augen und Ohren für uns.
Lachend erzählte er mir, dass er nach seiner Heimkehr aus der Kriegsgefangenschaft, gleich nach Kriegsende, zuerst in seiner alten Firma im Osten Berlins wieder angefangen hatte zu arbeiten. Doch dort wurden zu der Zeit noch Suppenlöffel, Schaumlöffel und andere Haushaltsgeräte statt elektrischer Geräte hergestellt, weil die Russen im Zuge der Reparationen fast alle Maschinen aus der Fabrik in die Sowjetunion „verlagert“ hatten. Selbst die nebensächlichsten Konstruktionszeichnungen hatten sie mitgenommen. Der Betrieb musste praktisch bei Null beginnen.
Doch da er im Westen Berlins wohnte und sich bald die Gegensätze zwischen Ost und West abzeichneten, wechselte er als kaufmännischer Angestellter bei der ersten Gelegenheit in einen Betrieb im Westen, der vor der Teilung der Stadt zu einem Konzern mit der jetzigen Ostfirma gehört hatte.
Viel zu schnell verging mir die Zeit unserer gemeinsamen Fahrt. Wie aus einem Traum erwachte ich, als der Zug mit kreischenden Bremsen in den Heimatbahnhof einfuhr. Mit Stoßen und Drängen löste sich das Knäuel der Menschen auf. Dabei hatte jeder Mühe, sein Gepäck zu finden. Ohne den Fremden wäre ich hilflos gewesen. Er aber hatte mit einem Griff meine Taschen aufgenommen, gab sie mir und schulterte sich seinen Rucksack auf den Rücken. Mich am Ärmel festhaltend, bahnte er uns den Weg zum Ausgang.
Mein Herz klopfte bis zum Hals. Würden wir jetzt gleich auseinandergehen und uns nie wiedersehen? Wir blieben vor dem Bahnhof im schwachen Schein einer Laterne stehen. Die Menschen quollen aus dem Bahnhof und hasteten um uns davon. Wir machten beide nicht einen Schritt voneinander, um zu gehen. Es war, als wollten wir den Moment der Trennung hinauszögern.
„Kann ich Sie irgendwo telefonisch erreichen“, fragte er.
Ich schaute ihn an, wollte ihm antworten, begann zu stottern. Verflixt! Was war mit mir los?
Meine Straßenbahn bog quietschend um die Ecke. „Meine Bahn!“, schreckte ich auf. Plötzlich trieb es mich, schnell wegzukommen. Hastig lief ich los zur Haltestelle.
„Aber, wo? Ihre Adresse?“, hörte ich ihn rufen.
Ich drehte mich im Weglaufen um und rief ihm zu: „Ich arbeite bei der ‚Habag Versicherung’ in Tempelhof. Fragen Sie nach dem Schreibbüro und Katrina Richter.“ Dann hatte ich die Straßenbahn erreicht und stieg ein.
Atemlos stand ich im letzten Wagen, klebte am Fenster und sah den Fremden kleiner und kleiner werden, bis wir um die Ecke fuhren und er ganz verschwand. Wann hatte ich mich jemals so über mich geärgert wie jetzt. Hätte ich nicht auf die nächste Straßenbahn warten können? Aber nein, als wäre ich auf der Flucht, war ich davongerannt. Wovor war ich davongerannt? Wenn er jetzt nicht verstanden hatte, was ich ihm zurief, würde ich ihn nie wieder sehen.
*
Noch, als ich an diesem Abend übermüdet im Bett lag und doch nicht schlafen konnte, fragte ich mich bang: Wird es ein Wiedersehen geben? Ja, würde ich ihn überhaupt wieder erkennen? Ich wusste nicht einmal seinen Namen. Verzweifelt versuchte ich, mir ein Bild von ihm zu machen. Ich hatte ihn nur in Dämmerung und Dunkelheit gesehen, aber auch gefühlt … Schlank war er und größer als ich. Doch hatte er nun blondes oder dunkles Haar? Nur seine hellen Augen sah ich klar vor mir. Und dann war da ein Geruch, der ihn umgab. Ich kannte ihn von Papa her. Das war der Geruch nach Tabak. Ich konnte ihn mir gut mit einer Tabakpfeife vorstellen. Hoffentlich, hoffentlich hatte er verstanden, was ich ihm im Weglaufen zurief. Noch im Einschlafen wünschte ich es mir.
*
Gespannt auf einen Anruf wartend verbrachte ich die nächsten Tage an meinem Arbeitsplatz in einem tristen Büro. Die Wände davon hätten längst einen neuen Anstrich vertragen. Der Putz der Decke war rissig seit den Bombenschäden des Krieges in der Umgebung. Wenn man morgens hereinkam, war die Luft stickig. Als Erstes zog jeder gleich die farblosen grauen Vorhänge zurück und riss die Fenster auf. Mit der frischen Luft drangen aber auch der Lärm und der Staub der Straße herein. Es war eine breite Hauptstraße. Ich hatte Glück, dieses Büro der Versicherung befand sich im amerikanischen Sektor, während einige andere Filialen davon nach der Teilung der Stadt zum Ostsektor gehörten. Viele der dort Angestellten waren dadurch zu Wanderern zwischen zwei Welten geworden, sie wohnten in einem westlichen Sektor und arbeiteten im Ostsektor. Ich aber saß hier an meiner Schreibmaschine und hoffte, dass der Fremde mich finden würde. Bei jedem Klingeln des Telefons hielt ich inne. War er es?
Fräulein Krause, die Chefin unseres Schreibzimmers, saß gleich neben der Tür an ihrem Schreibtisch, so dass sie alle Schreibmaschinenplätze übersehen konnte. Ihr Alter war schwer zu schätzen. Sie wirkte grau und eingesunken. Fand sie aber einen Grund, vorwurfsvoll ihren Kopf zu heben, so richtete sie sich auf. Sie hörte genau, wenn eine der Maschinen stillstand. Ungehalten konnte sie dann fragen: „Was gibt's?“ Und sie fragte es mich in diesen Tagen oft.
Brigitte, meiner engsten Freundin, die neben mir saß, hatte ich gleich von dem Fremden aus dem Zug erzählt. Ihre dunklen Augen leuchteten auf. „Warum hast du ihn nicht wenigstens nach seinem Namen gefragt?“, rügte sie mich verständnislos, warf mit einem ungeduldigen Ruck ihre langen dunklen Haare in den Nacken und erklärte: „Es kann doch unmöglich sein, dass er dich so verwirrt hat.“
„Doch, das hat er“, erklärte ich verlegen und errötete.
„Dann hast du dich verliebt!“, triumphierte sie. Dabei musterte sie mich neugierig.
Ich kicherte vielsagend. „Dass du aber den Mund hältst und niemanden etwas davon erzählst, besonders nicht bei mir zu Hause“, beschwor ich sie.
So kam es, dass auch sie bald aufhörte zu schreiben und neugierig aufsah, wenn das Telefon klingelte. Fräulein Krause musterte uns bereits misstrauisch.
Doch welch vorwurfsvoller Blick traf mich erst, als sie mich dann wirklich ans Telefon rief. „Ein Privatanruf? Machen Sie daraus keine Gewohnheit, Fräulein Richter“, ermahnte sie mich.
Brigitte stieß mich bedeutsam an, sie war ebenso aufgeregt und gespannt wie ich. Ich lief nach vorn, nahm den Hörer, den mir Fräulein Krause hinhielt, und spürte, wie mir mein Herz fast zum Hals heraussprang. Mit zittriger Stimme meldete ich mich: „Katrina Richter.“
„Hier Konrad Haideck“, antwortete mir eine vertraute Stimme. „War nicht so einfach, Sie zu finden. Wann sehen wir uns?“ Das klang bestimmt, war mehr als eine Frage.
Wieder spürte ich, wie ich mich dem Willen dieses mir immer noch fremden Mannes unterwarf. „Wann Sie wollen“, antwortete ich, ohne weiter zu überlegen.
Nachdem wir eine Verabredung vereinbart hatten, legte ich den Hörer auf. Wie auf Wolken schwebte ich an meinen Platz zurück. Erst Brigittes neugierige Frage: „Na, war er es?“, holte mich wieder herunter. Als ich es ihr bestätigte, traf mich ein seltsamer Blick. Sollte sie darauf neidisch sein?
In unserem Schreibbüro arbeiteten noch zwei andere Mädchen neben uns. Monika und Waltraud waren Freundinnen wie wir. Ich sah, wie sie miteinander tuschelten, als sie mitbekamen, was das für ein Anruf war, den ich da erhalten hatte. Ich warf den Kopf in den Nacken, sollten sie doch! Brigitte und ich mochten diese beiden nicht. Sie gehörten zu den Mädchen jener Zeit, die möglichst Nylonstrümpfe trugen und mit ihren amerikanischen Freunden prahlten. Wenn Fräulein Krause es nicht sah, zogen sie sich ihre breit gemalten, knallroten Lippen nach. Häufig erzählten sie uns von tollen Partys, an denen sie teilgenommen hätten. Was es dort alles zu Essen und zu Trinken gegeben hätte, könnten wir uns überhaupt nicht vorstellen, schwärmten sie. Auch mit anzüglichen Bemerkungen über das, was sie dabei erlebten, sparten sie nicht. Der Blick, den sie uns dabei zuwarfen, ließ uns wissen, dass sie uns für naive Gänse hielten. Brigitte und ich sahen uns nur verständnisvoll an. Jedoch wurde ich nie das Gefühl los, Brigitte würde ganz gerne Nylons tragen und Erlebnisse sammeln wie diese beiden.
Mama behauptete allerdings: „Von diesen Mädchen solltest du dich fernhalten. Sie sind leichtfertig. Das sind keine Mädchen, die ein Mann heiraten möchte.“ Und Mama musste es ja wohl wissen.
*
Mamas Welt waren die Kinder, der Mann und das Heim. Noch immer gab es keine graue Strähne in ihrem dunklen Haar, obgleich sie Angst und Sorgen durch die Kriegsjahre nie losgelassen hatten. Schlimm war es für sie gewesen, als Papa Soldat wurde und sie am Ende des Krieges nicht wusste: Lebt er noch, ist er in Kriegsgefangenschaft? Da habe ich die kleine, sonst emsig im Haushalt werkelnde Person manchmal nachdenklich am Fenster stehen sehen. Was für ein Glück muss es für sie gewesen sein, als Papa schon kurz nach Ende des Krieges heimkehrte. Der Gefangenschaft entgangen hatte er sich selbst nach Hause durchgeschlagen, wie viele in jener ersten Zeit danach. So stand er eines Tages zerlumpt, mit stoppeligem Bart und hohlen Wangen vor der Tür. Ein leiser glücklicher Aufschrei von Mama und sie fielen sich in die Arme. Wie hielten sie sich umklammert! Wir umringten sie und weinten. Papa war wieder da. Sein Haar war grau und dünn geworden. Als er mich umarmte, spürte ich die Knochen seines hageren Körpers. Doch der vertraute Geruch nach Tabak umwehte ihn, auch wenn er sicher nur von fiesem Tabakabfall sein konnte, den er sich vielleicht „geschnorrt“ hatte.
Das war sicher Mamas schönster Tag gewesen, ihre Welt war wieder in Ordnung. Sie war glücklich, dass ihre kleine Familie gut über den Krieg gekommen war und noch immer ihr Zuhause hatte. Wenn dieses Zuhause auch Risse in den Wänden aufwies, wenn es sich auch in einem Haus befand, dessen Putz durch das Kriegsgeschehen nur noch teilweise das Mauerwerk verdeckte, dieses Haus stand. Davon gab es nicht mehr allzu viele nach Kriegsende. Oft glichen sie dem Haus uns gegenüber in der Straße, das ohne Leben war. Durch die leeren ausgebrannten Fensterhöhlen konnte die Sonne von innen nach außen scheinen und den Regen hinderte kein Dach hineinzuprasseln.
Über alles habe ich mit Mama reden können, aber über Konrad Haideck, den Fremden, nicht. Auch an jenem Abend, als ich von der Hamsterfahrt nach Hause kam, erwähnte ich ihn mit keinem Wort. Mama wurde schon ungeduldig. „Lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen, Mädel!“, beklagte sie sich. Da erst begann ich, ihr von dem überfüllten Zug zu berichten und all den Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben hatten. Natürlich behauptete ich, dass ich sie alle allein gemeistert hätte. Wenn sie wüsste! Ich war sicher, sie würde warnend ihre Stimme erheben, dass ich mich nicht hätte so auf den Fremden verlassen dürfen. Nein, besser war es, Mama erfuhr davon vorerst nichts.
An dem Abend meiner ersten Verabredung mit Konrad Haideck zu einem Kinobesuch, sagte ich betont unbefangen zu Mama: „Ich treffe mich mit meiner Freundin Brigitte. Wir gehen ins Kino.“
Mama wollte mich noch etwas fragen. Doch noch ehe sie das tun konnte, war ich zur Tür hinaus. Ich hatte es sehr eilig wegzukommen.
*
Wie konnte ich nur glauben, ich würde ihn nicht erkennen. Von Weitem wusste ich bereits, dieser Mann dort vor dem Kino, mit dem schmalen Gesicht, der sich gerade eine Haarsträhne aus der Stirn strich, das musste er sein. Mit dieser Geste tat das nur einer, der Fremde. Mit federnden Schritten kam er auf mich zu. Ich musste mich zurückhalten, um ihm nicht entgegenzurennen. Ein warmer Glanz lag in seinen Augen, als er meine Hand nahm, meinen Arm und mich zum Eingang des Kinos mit sich zog. So hatte mich noch nie jemand angesehen. Befangen versuchte ich seinem Blick auszuweichen. Doch die Sicherheit, die von ihm ausging, machte es mir leicht, ihm widerstandslos zu folgen.
Dieser Verabredung folgte bald die nächste. Wieder war Brigitte dabei meine Ausrede, wie auch bei allen weiteren Malen. Manchmal liefen wir nur durch die vom Laternenschein erleuchteten Straßen. Wir redeten und redeten miteinander.
Die Tage wurden länger, der Wind wurde wärmer und ein Duft nach Frühling lag in der Luft. Mal gingen wir ins Kino, mal spazieren. Bald ergriff er meine Hand dabei und hielt sie fest. Hand in Hand liefen wir so, als würden wir uns ewig kennen. Doch nie ließ ich mich von ihm bis vor unsere Haustür bringen. Stets verabschiedete ich mich ein Stück davor. Es hätte uns ja jemand sehen können. Sein Lächeln darüber wirkte amüsiert, ja, eine gewisse Überlegenheit lag darin. Mich machte das unsicher und nervös.
Wie froh aber war ich, dass wir nicht vor unserer Haustür standen, als er mich eines Abends zum Abschied behutsam bei den Schultern ergriff, an sich zog und sanft küsste. Liebevoll umfing er mich für einen Moment. Dann schob er mich von sich. „Tschüß, Katrina!“ Und er ging davon. Ratlos blieb ich zurück. Er drehte sich noch um und lachte sein vertrautes spitzbübisches Lachen. Das also war unser erster Kuss. Was bedeutete das? Liebt er mich? Warum sagte er es mir dann nicht?
Als ich an diesem Abend nach Hause kam und Mama mich ansah, wurde ich rot. Ich bemerkte wohl, wie sie mich daraufhin erstaunt musterte- Doch sie sagte nichts und ich auch nicht.
2. Kapitel
Wenn ich jetzt morgens erwachte, galt mein erster Gedanke Konrad. Verträumt stand ich auf und stellte mich erst gedankenverloren an das Fenster meines Zimmers. Ich sah Menschen die Straße entlangeilen und sah sie doch nicht. Ich bemerkte auch nicht das aufbrechende Grün der Straßenbäume oder hörte das Lärmen der Spatzen. Nicht einmal das mächtige Dröhnen der Flugzeugmotoren vom nahe gelegenen Flugplatz Tempelhof konnte mich aus meinen Träumen reißen.
Meinem Bruder Bruno allerdings gelang es oft genug, mich früher aus dem Schlaf zu holen als nötig. Er verstand es, nebenan im Badezimmer wahre Arien zu gurgeln. Dazu überflutete er noch plätschernd den Boden und wenn das nicht reichte, klopfte er an die Wand. Er konnte es sich nicht versagen, mich morgens um sechs Uhr zu wecken, obgleich er wusste, ich brauchte erst eine Stunde später aufzustehen. Damit es ihm auch wirklich gelang, rief er noch durch die beiden Risse in der Wand zu meinem Zimmer, die bei einem Luftangriff auf die Stadt im Krieg entstanden waren: „Katrinchen, aufstehen!“
Wütend warf ich dann meine Pantoffeln gegen die Wand. Ich konnte es nicht ausstehen, Katrinchen gerufen zu werden. Er wusste es genau. Ich fand den Namen bäuerisch und völlig unpassend für mich. Ich war zierlich und nicht rund, hatte keinen Zopf oder Dutt, sondern schönes gewelltes blondes Haar.
Auch am Morgen jenes Tages, der entscheidend für mein ganzes Leben werden sollte, weckte mich Bruno auf seine Art. Polternd - wie üblich - verließ er das Bad. Er konnte es sich nicht versagen, noch vom Flur aus an meine Tür zu klopfen. Doch da stand Mama gleich in der Küchentür.
„Psst! Mach nicht solchen Lärm, Junge! Du weckst mir Traudel auf“, ermahnte sie ihn mit verhaltener Stimme.
Bruno brummte unwillig und schlurfte in die Küche. Ganz schön neidisch war er auf Traudel, unsere jüngere Schwester, die länger schlafen konnte.
Doch Traudel, das Küken, zwölf Jahre alt mit Stupsnase und roten dicken Zöpfen, konnte so leicht nichts wecken. Da hatte er bei mir mehr Erfolg. Das machte mich manchmal wütend. Doch konnte man diesem Schlaks von siebzehn Jahren mit dem dunkelblonden Wuschelkopf überhaupt böse sein?
Ich hörte Bruno in der Küche noch sagen: „So gut wie Traudel möchte ich es auch haben. Wie gut, wenn man zur Schule geht.“
Auch Bruno könnte noch zur Schule gehen. Papa hätte es gern gesehen, wenn er sein Abitur gemacht und dann studiert hätte. Er war doch der Sohn der Familie - und ein Sohn musste wenigstens einen gleichwertigen Beruf wie der Vater haben. Bei den Mädchen war das nicht so wichtig. „Die heiraten sowieso“, meinten Papa und Mama. Beide waren eben noch aus den alten Generationen.
Bruno jedoch dachte anders. „Nun gut, Papa, du hast studiert und bist Ingenieur“, lehnte er sich auf. „Muss ich deshalb mindestens ein Doktor werden? Ich sehe das nicht ein. Ich habe die Schule satt. Meinem Freund und mir bietet sich jetzt die Gelegenheit, eine Lehre zum Elektromonteur anzufangen. Da kann ich bereits Geld verdienen, wenn es auch wenig ist. Bald geht der Wiederaufbau der Stadt los. Dann ist dieser Beruf bestimmt gefragt.“
„Junge, überlege dir das gut! Was du jetzt versäumst, kannst du in deinem ganzen Leben nicht mehr nachholen.“ Eindringlich redete Papa auf ihn ein.
Bruno aber war nicht mehr umzustimmen. Bestärkt von seinem Freund, erzwang er sich das Einverständnis von Papa. Der bemühte sich danach, nicht zu zeigen, wie traurig er darüber war.
Doch Bruno strahlte vor Freude. „Schau, Papa, ist es nicht ein Glück, dass ich diese Lehrstelle bekommen habe, bei der Arbeitslosigkeit zu dieser Zeit?“, versuchte er ihn nachträglich zu überzeugen. „Wer weiß, wie das in ein paar Jahren aussieht. Mir kann das dann egal sein. Ich habe dann meinen Beruf.“
So war der Tag gekommen, an dem Bruno mit einem lauten „Hurra!“ seine Schultasche in die Ecke warf. Mama hatte besorgt zu Papa gesehen. Auch ihr wäre es lieber gewesen, wenn Bruno sein Abitur gemacht hätte.
Wie jeden Morgen ließ er auch heute die Tür hinter sich geräuschvoll ins Schloss fallen, als er ging. Mama seufzte, dass sich der Junge wieder nicht hingesetzt und gefrühstückt hatte. Mit einer Scheibe Brot in der Hand war er eilig die Treppe hinuntergestürmt.
Anders dagegen war es bei Papa. Während Mama in der Küche am Tisch weiter das Frühstück für Traudel und mich zurechtmachte, saß er gemütlich daneben. Auf dem großen Kachelherd in der Ecke der Küche hatte Mama immer eine große tönerne Kanne Malzkaffee warm gestellt. Zum Frühstück gehörten für Papa eine Tasse davon, frisch gebrüht, und die Neuigkeit der Zeitung. Da sprach Mama ihn auch nicht an. Manchmal machte er sich empört Luft über das, was er las. Dann tat Mama erstaunt oder nickte verständnisvoll. Hatte er schließlich die Zeitung zusammengefaltet, so schlurfte er leise mit seinen Filzpantoffeln in den Flur, zog sich die Straßenschuhe an, gab Mama, die wartend an der Wohnungstür stand, einen liebevollen Kuss und ging pünktlich zehn Minuten vor sieben Uhr zur Arbeit.
Dann wurde es Zeit für mich. Als ich an diesem Morgen in die Küche kam, sah ich erfreut, Mama legte mir eine hauchdünne Scheibe Schinken auf mein Frühstücksbrot. Der Schinken war noch von meiner Hamsterfahrt zu Tante Luise her. Ich dachte daran, dass sie noch vor kurzer Zeit oft falsche Leberwurst darauf gestrichen hatte. Das war ein Gemisch aus Mehl, Zwiebeln und Majoran, was wir nicht sehr mochten. Doch sagten wir ihr das, dann konnte Mama traurig erwidern: „Ja meint ihr, ich gäbe euch nicht auch lieber etwas anderes mit?“
Einige Wochen war es bereits her, dass ich mit essbaren Schätzen von Tante Luise nach Hause gekommen war. Genauso lange kannte ich jetzt Konrad. Ich fieberte jeder Verabredung mit ihm entgegen. Ich schmiegte mich inzwischen an ihn, wenn er mich zärtlich in den Arm nahm und küsste. Eigentlich müsste ich jetzt Mama von ihm erzählen. Auch an diesem Morgen überlegte ich das. Doch ich schob es auf, bis zur Mittagszeit, bis ich von der Arbeit wieder nach Hause kam.
Obwohl sonnabends nur wenige Stunden gearbeitet wurde, verging mir die Zeit an diesem Tag viel zu langsam. Ungeduldig sah ich auf die Uhr.
„Na, du kannst es wohl nicht erwarten?“, neckte mich Brigitte und musterte mich neidisch, wie mir schien.
Ich lachte, packte mittags schnell meine Sachen zusammen und lief zur Tür.
„Da brauche ich dich wohl nicht zu fragen, ob du heute Zeit für mich hast?“, rief sie mir nach. „Oder habe ich vergessen, dass wir uns heute treffen?“
„Natürlich treffen wir uns wieder, wie immer in letzter Zeit. Das weißt du doch!“, antwortete ich vieldeutig.
„Ach, ja!“, antwortete sie. „Habe es schon verstanden.“ Sie wusste, dass sie meine Ausrede war, wenn ich mich mit Konrad traf.
Die Köpfe von Monika und Waltraud flogen herum. Sie spürten, da war etwas Geheimnisvolles. Fräulein Krause sah prüfend auf die Uhr, ob ich auch nicht eine Minute zu früh das Büro verließ. Ich atmete auf, sobald ich draußen war.
Als ich mich unserem Haus näherte, ging meine Schwester Traudel vor mir her. Ihre roten Zöpfe hingen ihr weit über die Schulter. Unter dem Arm trug sie ihren Schulranzen. Sie band ihn sich nie mehr auf den Rücken. „Das machen doch nur Babys“, konnte sie mit der Herablassung ihrer zwölf Jahre sagen. Sie bettelte seit Langem um eine richtige große Aktentasche. Doch Papa meinte, der Ranzen sei wenigstens aus Leder, dagegen sei eine Aktentasche, wie man sie heute kaufen könnte - wenn überhaupt - nur aus Ersatzmaterial. Das wäre viel zu teuer und würde der Behandlung durch Traudel sicher nicht lange standhalten. Traudel gab dann ihrem Ranzen heimlich einen herzhaften Fußtritt und murrte: „Ich pfeif was auf Leder!“ Aber der Ranzen aus Leder ging eben trotz der Fußtritte nicht entzwei.
Kurz vor der Haustür holte ich Traudel ein. Zu ihrem Missfallen hielt ich sie an ihren Zöpfen fest.
Unser Haus in dieser Straße sah aus wie alle anderen hier, die den Krieg überstanden hatten. Es war teilweise beschädigt und die Klingeln an der Haustür funktionierten nicht mehr. Es gehörte zu einer Siedlung, die man damals modern nannte, mit glattem Putz und vielen Balkons. Das waren keine Altberliner Häuser mit hohen Fenstern und Stuckaturen. Früher quollen hier die Balkonkästen über von Sommerblumen und machten neben den herrlichen Rotdornbäumen am Straßenrand die Gegend freundlich. Wenn sie blühten, hatte das sonntags viele Spaziergänger aus der Innenstadt angezogen.
Die Räume in diesen Häusern waren nicht so hoch wie in einem Altberliner Haus, die Wohnungen nicht so groß. Trotzdem hatte ich hier ein eigenes Zimmer. Es war klein. Gerade ein Schrank, ein Bett, ein Tisch und ein Stuhl hatten Platz darin. Aber es war mein Reich. Als wir vor Beginn des Krieges hier einzogen, hatte Bruno gemault und gemeint, ihm, als einzigem Jungen, stünde das Zimmer zu. Doch Papa hatte mit einer Handbewegung seine Einwände beiseite geschoben, „Katrina ist die Älteste“, bestimmte er. So bekam Bruno sein Bett auf der Couch im Wohnzimmer jeden Abend zurechtgemacht und Traudel schlief auf einem Sofa bei den Eltern im Schlafzimmer.
Schon im Treppenhaus roch es nach gebratenen Zwiebeln. Wie jeden Sonnabend stand mittags dampfende Kartoffelsuppe auf unserem Tisch in der Küche, um den sich die Familie versammelte. Wie jeden Sonnabend warf Bruno flehentlich seinen Blick zur Decke und sagte: „Und jetzt ein paar Bockwürste dazu!“, ehe er nach seinem Löffel griff.
Anfangs hatten wir darüber gelacht, doch dann mahnte Papa: „Lass den Unsinn!“ Und schließlich achteten wir kaum noch darauf. Nur Traudel nahm ihren Löffel nie auf, ehe ihr vergötterter großer Bruder nicht seinen Spruch getan hatte.
Als sich Papa nach dem Essen zu einem Mittagsschlaf ins Schlafzimmer zurückzog, war eigentlich der Moment gekommen, Mama zu sagen, dass ich mich heute mit Konrad treffe. Doch ich konnte es nicht - noch nicht - später, nahm ich mir vor.
Nach dem Essen half ich Mama in der Küche das Geschirr abzuwaschen. Eifrig redete ich, um damit mein schlechtes Gewissen zu verbergen. Als wir fast fertig waren, sagte ich beiläufig: „Ich treffe mich gleich mit Brigitte. Wir wollen bei dem schönen Wetter ins Grüne, an die Havel fahren.“ War ich erleichtert, dass mir die Ausrede wieder leicht über die Lippen ging - nur putzte ich wohl den Teller, den ich in der Hand hielt, besonders lange trocken.
Mir entging nicht, wie Mama mich von der Seite her ansah. „Gut!“, sagte sie zustimmend. Doch nach einer Pause: „Ist der Teller nicht schon trocken genug?“ Und sie lächelte seltsam dabei, so dass ich vor Verlegenheit errötete und mich fast verraten hätte.
Ich stutzte. Ahnte Mama etwas? Unmöglich! Sicher lächelte sie, weil ich wieder gewartet hatte, bis Papa schlief, um ihr das zu sagen. Papa konnte so unbequeme Fragen stellen: Wohin? Mit wem? Wann zurück? - Ich war froh, dass sie es wieder war, die all seine Fragen beantworten musste. Und darin hatte sie im Laufe der Jahre viel Übung bekommen.
*
Es war ein schöner warmer Tag im Mai. Wer Zeit hatte und nicht damit beschäftigt war, das Notwendige fürs tägliche Leben zu beschaffen, der strebte hinaus in die Natur. Mein Weg zur S-Bahnstation war nicht weit. Zwischen all den Menschen dort, sah ich Konrad sofort. Mit seinem warmen Glanz in den Augen sah er mir entgegen. Längst näherte ich mich ihm nicht mehr zögernd, sondern lief die letzten Schritte und sprang ihm regelrecht in die Arme. Jede Geste, jeder Blick von mir musste ihm verraten, wie sehr ich ihn liebte. Die Zeit, da ich versuchte, dies zu verstecken, war längst vorbei. Eng umschlungen, miteinander vertraut, gingen wir auf den Bahnsteig und stiegen in den Zug. Dicht beieinander standen wir zwischen all den anderen Menschen im vollen S-Bahnabteil und fuhren hinaus nach Wannsee zur Havelchaussee.
Das Wasser der Havel dümpelte leise plätschernd an den Strand und strich immer wieder den feinen Sand, von vielen Füßen zertreten, glatt. Auch in meine Schuhe drang dieser Sand, so dass ich kaum noch laufen konnte.
„Komm!“, sagte Konrad. „Lass uns hinaufgehen in den Wald.“
Mir war es recht. Vom ersten Moment an, als wir uns begegneten, hatte ich nie den Wunsch verspürt, mich gegen seinen Willen aufzulehnen. Was Konrad tat war richtig, ich hatte Vertrauen. So verließen wir die vielen Menschen am Strand der Havel und stiegen hinauf in den schattigen Wald der Havelberge.
Es war schön, neben ihm zu gehen, sich an ihn zu lehnen. Ich war so jung und an ihm war nichts Jungenhaftes mehr. War er auch nur einige Jahre älter als ich, so machte es zwischen uns viel aus. Er ging so sicher und wusste, was er wollte.
Bald lenkte Konrad unsere Schritte vom Weg ab. Ein schmaler Pfad verlor sich im Wald. Kein Mensch war mehr um uns herum. Aufgeregt, beklommen und ängstlich schmiegte ich mich in seinen, mich fester umfassenden Arm. Vor uns öffnete sich der Wald und wir traten geblendet hinaus auf eine sonnenüberflutete Lichtung. Wir blickten hinunter auf die Straße und zu dem Strand am Ufer der Havel. Gedämpft klang das Stimmengewirr der Spaziergänger von dort unten zu uns hoch, auch das leise Plätschern der Wellen auf dem Fluss. Hier war ein warmer Platz, einsam, als wäre er für Verliebte geschaffen.
Konrad zog sich seinen Mantel aus, legte ihn auf das Gras mit den ersten grünen Halmen und setzte sich darauf. „Komm! Lass uns hier verweilen. Der Boden ist schon warm“, forderte er mich auf und zog mich zu sich hinunter.
Ehe ich mich versah, lag ich neben ihm auf seinem Mantel. Ein seltsames Gefühl der Unruhe befiel mich. Ich fühlte mich wie erstarrt, bereit zur Abwehr. Konrad drehte sich mir zu, blickte mich forschend an und grinste, als wüsste er, was in mir vorging. Sacht griff er nach meiner Hand zwischen uns und hielt sie fest. „Ich träume gerne so in den Himmel. Komm, lass uns das zusammen tun“, forderte er mich auf und sah zu den einzelnen Wolken hoch. Träumen, ja! Die Spannung in mir löste sich und ich konnte mich dem wundervollen Gefühl überlassen, hier neben ihm zu liegen.
Herrlich war dieser Tag, diese stille Stunde, diese junge Zeit der Liebe, die schöner war, als ich sie mir je erträumt hatte. Ich vertraute ihm. Er würde mich nicht überrumpeln, dessen war ich mir sicher. Und doch, wenn er sich zu mir drehte, mich zärtlich küsste und liebkoste, spürte ich sein Drängen. Das rief in mir eine seltsame Unruhe hervor. Verunsichert zog ich mich von ihm zurück.
Ich bemühte mich aber, ihn das nicht merkten zu lassen. So rupfte ich ihm neckend ein Gänseblümchen aus seinem Mund, das er spielend mit seinen Zähnen bewegt hatte.
„Na warte“, ging er scherzhaft darauf ein.
Ich wollte aufspringen und lachend davonlaufen, er aber ergriff mich und hielt mich fest. Verliebt miteinander balgend rollten wir auf den Boden zurück. Plötzlich spürte ich sein leidenschaftliches Begehren. Atemlos still, wie gelähmt lag ich da.
„Katrina, komm, lass uns zu meiner Laube fahren. Ich habe am Stadtrand einen kleinen Schrebergarten. Dort sind wir ungestört - nur wir zwei. Komm, bitte!“, flüsterte er dicht an meinem Ohr unter Küssen.
Verschreckt zog ich mich zurück, als ich den Sinn seiner Worte erfasste, seinen an mich gerichteten Wunsch. Kälte schien plötzlich vom Boden hochzukriechen.
„Was ist?“ Erstaunt ließ er mich los, als er meinen Widerstand spürte.
Ich errötete heftig, richtete mich auf und starrte angestrengt auf den Boden. „Ich dachte, du liebst mich“, stammelte ich.
„Weshalb zweifelst du daran?“, fragte er verwundert.
Vor Verlegenheit rupfte ich büschelweise das Gras um mich herum. Am liebsten hätte ich mich verkrochen. „Ja, weil ... weil das ... na, was du eben wolltest ... bittet man darum nicht nur leichtfertige Mädchen“, stammelte ich hilflos. Drängende Tränen würgten mich. Ich wusste nicht, wem sie galten, Konrads frechem Wunsch oder dem eigenen zurückgedrängten Verlangen.
Sprachlos blickte er mich für einen Moment an. Dann ließ er sich zurückfallen und lachte, lachte!
Ich fühlte mich verletzt und weinte.
Liebevoll, wie man ein Kind nimmt, zog er mich in seine Arme. „Katrina, wo lebst du?“
Ich schluckte und schwieg.
„Wolltest du eben sagen, dass du glaubst, dass Männer ... dass man Mädchen ... Herrgott! - Dass man eben erst heiratet?“, stotterte er.
Ich nickte stumm.
Leise, ganz leise lachte er noch einmal auf, zog mich fest an sich, wie etwas, dass man nie wieder loslassen möchte und sagte: „Da werden wir bald heiraten müssen, Kleines. Ich will nicht lange warten!“
Ich sah über seine Schulter hinweg und entdeckte eine kleine Maus. Sie war unter einem Busch aus ihrem Loch gekrochen und verschwand wieder eilig darin, als sie uns erblickte. Erst langsam wurde mir bewusst, dass ich eben einen Heiratsantrag bekommen hatte. Staunend erkannte ich, dass er nicht die geringste Ähnlichkeit mit den Worten meines Traumhelden hatte. Ich fand ja nicht einmal Gelegenheit ein zurückhaltendes „Ja“ zu hauchen. Konrad fühlte sich meiner Antwort sicher, und ich war es zufrieden.
3. Kapitel
Dann kam der Tag, an dem Konrad zum ersten Mal zu uns kam. Verlegen und stotternd hatte ich Mama darauf vorbereitet. Es Papa mitzuteilen, überließ ich natürlich ihr. Da hatte ich ihr auch beichten müssen, dass Brigitte als Ausrede herhalten musste, wenn ich mich mit Konrad getroffen hatte.
„War das nötig?“, fragte sie nur kopfschüttelnd.
Und dann kam Konrad. Er kam zwar nicht in einem dunklen Anzug, sondern in jenem grauen, in dem man jede Falte sehen konnte, die einmal eingesessen war, und in der Hand hielt er einen Strauß roter, bereits zu weit aufgeblühter Rosen. Wer weiß, wo er die aufgetrieben hatte? Mama war angenehm überrascht. „Wie es sich gehört“, meinte sie. Unter dem Arm trug er noch ein längliches Paket.
Alle, außer Papa, standen in der Diele um ihn herum und musterten ihn unverhohlen neugierig. Das war sogar Konrad peinlich. Unruhig schob er das Paket unter seinem Arm hin und her. Endlich kam Papa, machte einen Schritt auf ihn zu, begrüßte ihn zurückhaltend und bat ihn ins Wohnzimmer. „Ich denke, wir unterhalten uns erst einmal, um uns besser kennenzulernen“, meinte er.
Konrad übergab Mama schnell noch das Paket, dann verschwanden sie beide im Wohnzimmer und Papa schloss die Tür.
Bruno, Traudel und ich folgten Mama in die Küche. Traudel platzte vor Neugierde, was in dem Paket sei. Doch wie enttäuscht war sie, als Mama nur eine Suppenkelle und einen Schaumlöffel auspackte. Die waren wohl noch aus der Zeit, als er bei der Firma im Osten gearbeitet hatte. Mama lachte und sagte: „Oh, das ist aber aufmerksam in heutiger Zeit.“
Mama hatte zu diesem Tag Kuchen gebacken. Sogar Fett, Eier und Zucker hatte sie nicht so sparsam wie sonst dazu verwandt. „Schließlich ist das ein besonderer Tag“, betonte sie. Nur Bohnenkaffee fehlte, den hätte sie auch noch gern gehabt. Aber diesmal konnte ihr nicht einmal Onkel Anton, Papas Bruder, so schnell dazu verhelfen. Er war Experte auf dem verbotenen Schwarzmarkt, wo man für viel Geld fast alles unter der Hand kaufen konnte - wenn man nur nicht dabei erwischt wurde -. So stand sie also und brühte wie gewohnt Malzkaffee auf. Bruno lümmelte sich neben ihr auf dem Stuhl am Tisch, als sie den Kuchen aufschnitt. Er ergatterte sich ein Stück davon und bekam einen Klaps auf die Finger dafür. Traudel lehnte am Fenster und trat vor Spannung von einem Fuß auf den andern. Sie fand alles so aufregend!
Ich lief unruhig umher. Das Warten wurde mir zur Ewigkeit. Es ging mir auf die Nerven. „Hoffentlich hat er seinen Bankauszug, sein Sparkassenbuch, seinen Impfschein und - Gott weiß was alles – mitgebracht“, moserte ich.
„Aber, Katrina!“, mahnte Mama.
„Was hat Papa sonst so lange mit ihm zu reden, wenn er ihn nicht ausfragt?“, verteidigte ich mich.
Bruno, der sowieso alles albern fand, rief dazwischen: „Das mache ich nie. Ich sehe nicht ein, wozu das alles nötig ist. Wenn mein Mädchen mal ja sagt, dann ist doch alles klar. Oder etwa nicht?“
„Was weißt du schon?“, erwiderte Mama und brachte den Kuchen vor ihm in Sicherheit. „Wenn es so weit ist, wirst du genau das tun, was dein Mädchen von dir erwartet. Und in einer soliden Familie ist es auch heute üblich, die Fragen der Eltern zu beantworten.“
„Ich bestimmt nicht!“, konnte Bruno gerade noch versichern, da ging die Wohnzimmertür auf und Papa rief uns herein.
Allen voran stürmte Traudel. Papa wirkte sehr feierlich. Und Konrad? - Er stand neben ihm mit diesem liebevollen Glanz in den Augen, den ich so an ihm mochte. Ich sah nur ihn. Ich hatte einen Kloß im Hals und war beklommen. Papa sprach viele zu Herzen gehende Worte, unter anderem vom „Bund fürs Leben“. Mama schluckte ein paar Tränen hinunter. Mich erreichte kaum, was Papa so bedeutungsvoll sagte. Wie gebannt stand ich nur und kämpfte hilflos gegen eine mir unverständliche Aufregung, die mich beherrschte. Erst als ich begriff, dass Papa mit Konrad einverstanden war, atmete ich auf. War ich jetzt eigentlich verlobt? In Gedanken fragte ich mich schon, was wohl Brigitte und die anderen im Büro dazu sagen würden.
Da riss mich ein Ausruf von Mama aus meinen Gedanken. „Was denn, so bald? Und keine Verlobung, wie es sich gehört?“, rief sie erschrocken und rang ihre Hände. „Aber Kinder, warum denn so schnell? Ihr kennt euch doch erst ein paar Wochen. Was sind schon ein paar Wochen, um darauf ein ganzes Leben aufzubauen?“
Überrascht sah ich zu Konrad. Keine Verlobungsfeier und schon nach kurzer Zeit die Hochzeit? Er machte einen Schritt auf mich zu. Sein überzeugendes Lächeln erinnerte mich daran, was er auf der Lichtung im Wald gesagt hatte: „Ich will nicht lange warten.“ Und seine Augen schienen in diesem Augenblick seine Worte zu wiederholen. Da hatte ich nichts mehr dagegen einzuwenden. Wieder einmal hatte Konrad, ohne mich zu fragen, entschieden. Wieder einmal war ich stillschweigend damit einverstanden.
„Sehen Sie“, wandte sich Konrad Mama zu, „durch den Krieg bin ich ohne Angehörige. Ich möchte Ihre Katrina, und ich möchte wieder jemand haben, der zu mir gehört.“ So redete er eindringlich auf sie ein, seine ganze Warmherzigkeit setzte er dabei ein. Ich sah, wie er damit ihren Widerstand überwand.
Doch Mama wollte mich nicht so schnell hergeben. „Wie soll ich in dieser kurzen Zeit alles zu einer Hochzeitsfeier beschaffen, wo das gerade jetzt besonders schwer ist?“, versuchte sie einen letzten Einwand.
„Wir brauchen nicht viel, um zu heiraten“, wehrte Konrad ab. „Bitte, verstehen Sie meine Ungeduld“, fügte er hinzu. Dabei sah er mich vielsagend an. Ich verstand, was er meinte. Hier vor Mama und Papa war mir das peinlich. Wenn sie es errieten. Verlegen schlug ich die Augen nieder und errötete heftig.
„Eine Hochzeit ohne Feier - das, Herr Haideck, ist nicht Ihr Ernst?“, machte Mama noch einen letzten Versuch.
Bis hierher hatte ich schweigend dabeigestanden. Alles wäre mir recht gewesen, aber heiraten ohne eine Feier? „Nein“, rief ich dazwischen und blickte Konrad beschwörend an. „Ich möchte eine richtige Hochzeit haben, mit Freunden und Verwandten.“ Meinen Traum von Kranz und Schleier wollte ich nicht aufgeben, nicht einmal Konrad zuliebe.
Noch ehe Konrad antworten konnte, mischte sich Papa ein. „Das können wir immer noch besprechen“, beschwichtigte er.
Jetzt erst wunderte ich mich, dass Papa einer schnellen Heirat nicht widersprochen hatte. Konrad musste ihn im Sturm erobert haben.
„Wir lassen euch erst einmal allein“, bestimmte Papa sichtlich großzügig und schob Mama und Bruno zu Tür hinaus. „Du auch, Traudel“, musste er sie ermahnen. Sie stand neben uns mit großen Augen, wie fest gebannt auf ihrem Platz. Sie wollte nichts, aber auch gar nichts versäumen.
Die Tür schloss sich hinter ihnen. Traudels eifriges Plappern und Brunos herablassende Reden verloren sich zur Küche hin. Er fand das alles übertrieben feierlich. „So 'n Blödsinn!“ hörte ich ihn noch sagen.
Konrad und ich sahen uns stumm an. Hier, in der Nähe meiner Familie, bekam ich es nicht einmal fertig, ihm wie sonst in die Arme zu springen. Fast verlegen wie am ersten Tag, stand ich am selben Fleck. Konrad spürte es. Ein amüsiertes Lächeln huschte über sein Gesicht. Ich fragte mich, ob er wie Bruno dies feierliche Getue auch für Blödsinn hielt. Doch als er in seine Jackentasche griff und ein kleines Kästchen herauszog wurde er ernst. Zwei silberne Trauringe lagen darin.
„Ich hoffe, wir können sie einmal in goldene Ringe umtauschen“, sagte er und streifte mir den schmalen Reif über den Ringfinger der linken Hand. Nun war auch er feierlich geworden. Als ich ihm auch seinen Ring übergestreift hatte, besiegelte ein warmer liebevoller Kuss - kein leidenschaftlicher - unser unausgesprochenes Versprechen, nun unseren Lebensweg gemeinsam zu gehen.
Dann stand Mama mit der Kanne voll dampfendem Kaffee in der Tür und mahnte, dass es Zeit sei, am Kaffeetisch im Wohnzimmer Platz zu nehmen. Bald saßen wir alle in gemütlicher Runde und es war, als hätte Konrad schon immer zu uns gehört. Auch Konrad fühlte sich offensichtlich nicht fremd.
Als der Kaffeetisch abgeräumt war, packte Konrad seine Tabakpfeife aus. Dazu holte er ein Kästchen mit Tabak hervor und bot Papa an, sich daraus auch seine Pfeife zu stopfen. „Das ist aus eigenem Anbau“, betonte er stolz.
Papa nahm das Kästchen entgegen und roch daran. „Donnerwetter“, lobte er, ,,wenn der Tabak so schmeckt, wie er riecht.“
Damit hatten sie ihr Gesprächsthema gefunden, Tabakanbau und seine Fermentierung. Papa pflanzte selbst im Hof unseres Häuserblocks jedes Jahr ein paar Stauden an. In dieser Zeit, da selbst Tabakwaren rationiert waren, hatte jeder Mieter ein Stückchen des ehemaligen Rasens zugeteilt bekommen. So war der sehr geräumige Hof - denn Hinterhäuser gab es in unserer Siedlung nicht - zu einem Schrebergarten geworden. Da wuchsen Radieschen, Tomaten, Gemüse oder eben Tabak.
Tabak, Tabak! - Es war ja schön, dass Papa und Konrad sich gleich so gut verstanden, aber allmählich ging mir dieses ausdauernde Gerede darüber auf die Nerven. Sie ereiferten sich dabei, während wir gelangweilt herumsaßen. Gab es denn an diesem Tag unserer Verlobung nichts Wichtigeres als Tabak? Eigentlich dachte ich, Konrad könnte jetzt nur noch Augen für mich haben und nicht von meiner Seite weichen. Dabei begann ich schon zu befürchten, sie würden noch in den Hof gehen, um das Stückchen Erde mit den jungen Pflanzen zu begutachten. Ungeduldig rutschte ich auf meinem Stuhl hin und her. Mama sah es. Sie rettete wieder einmal die Situation, indem sie Konrad nach seiner Firma fragte, bei der er arbeitete.
Als Konrad ging, begleitete ich ihn ein Stück die Straße entlang. Ein Weilchen noch hatte ich ihn allein für mich. Fest hakte ich mich bei ihm ein, als würde ich ihn nun besitzen. Ein Glücksgefühl erfüllte mich. Ich meinte, jeder Vorübergehende müsste es erkennen: Ich war verlobt!
*
Diesen Eintritt Konrads in unsere Familie konnte man als gelungen bezeichnen. Doch mit diesem kleinen Kreis hatte er noch nicht alle erobert. Es gab zwei „Käuze“ in der weiteren Familie. So nannte sie Bruno. Doch durften weder Mama noch Papa das hören, denn Mama wollte keineswegs von ihrer Schwester Emmy lassen, noch Papa von seinem Bruder Anton.