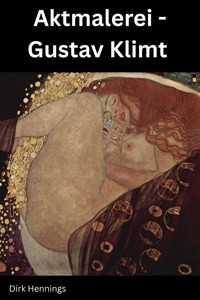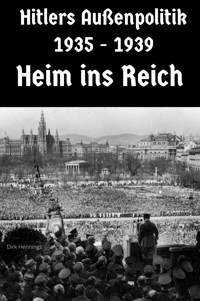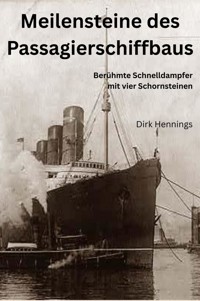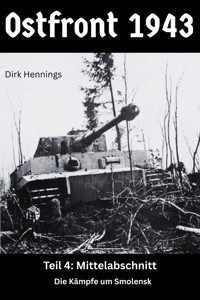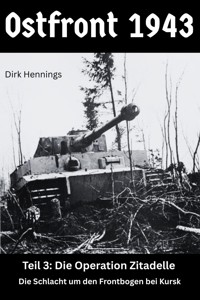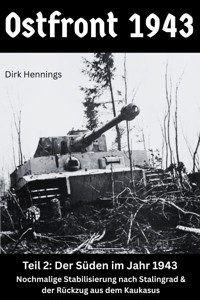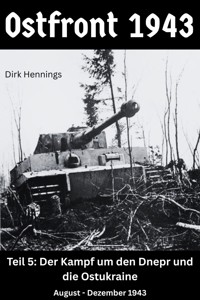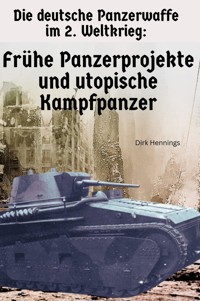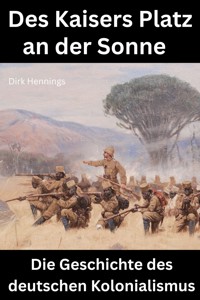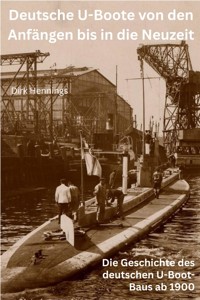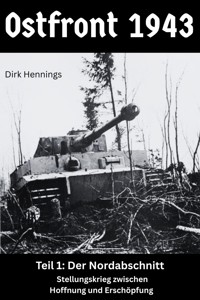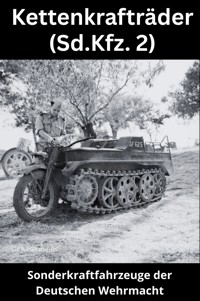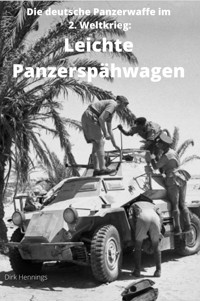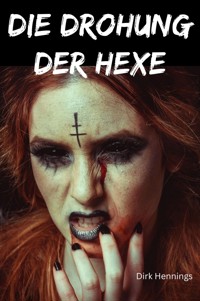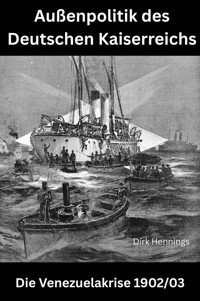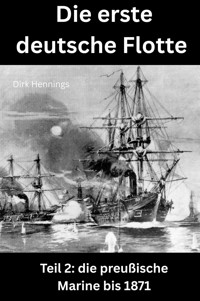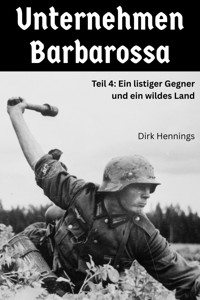
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
UNTERNEHMEN BARBAROSSA Teil 4: Ein listiger Gegner und ein wildes Land Mit dem Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion fand ein "unnatürliches" Bündnis sein Ende, das seit dem August 1939 Bestand gehabt hatte. Unter dem Eindruck der "vermeintlich" leichten Siege in Polen, im Westen und auf dem Balkan, glaubte Hitler auch mit der Sowjetunion in Blitzkrieg-Manier fertig werden zu können. Doch seine Rechnung ging aus mehreren Gründen nicht auf. Diese Gründe haben zum einen ihre Ursachen in den natürlichen Gegebenheiten dieses Riesenreichs. Doch zum anderen gab es von Seiten der Westalliierten wichtige und auch kriegsentscheidende Hilfestellungen. Aber vor allem trug auch die Sowjetunion selbst durch besonderes strategisches und kriegswirtschaftliches Verhalten wesentlich am Erfolg gegen Hitlerdeutschland bei. Dieses Buch erzählt die Geschichte von General Winter und den Schlammperioden. Es beleuchtet die Bedeutung der Pacht- und Leihlieferungen der Westalliierten und der Partisanenbewegung. Und es beschreibt ferner die große Ostverlagerung der sowjetischen Rüstungsindustrie hinter den Ural. Umfangreiches historisches Bild- und Kartenmaterial ergänzt dieses Werk. Umfang 129 Seiten
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unternehmen Barbarossa
Teil 4: Ein listiger Gegner und ein
wildes Land
IMPRESSUM:
Dirk Hennings
c/o IP-Management #4887
Ludwig-Erhard-Str. 1820459 Hamburg
Einleitung
Mit dem Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion fand ein „unnatürliches“ Bündnis sein Ende, das seit dem August 1939 Bestand gehabt hatte. Unter dem Eindruck der „vermeintlich“ leichten Siege in Polen, im Westen und auf dem Balkan, glaubte Hitler auch mit der Sowjetunion in Blitzkrieg-Manier fertig werden zu können. Doch seine Rechnung ging aus mehreren Gründen nicht auf. Diese Gründe haben zum einen ihre Ursachen in den natürlichen Gegebenheiten dieses Riesenreichs. Doch zum anderen gab es von Seiten der Westalliierten wichtige und auch kriegsentscheidende Hilfestellungen. Aber vor allem trug die Sowjetunion selbst durch besonderes strategisches und kriegswirtschaftliches Verhalten wesentlich am Erfolg gegen Hitlerdeutschland bei.
Dieses Buch soll hierfür die Gründe beleuchten.
Rasputiza (oder die Wegelosigkeit)
Dorfstraße in der Gemeinde Sokol, Oblast Wologda (Nordwestrussland) im Jahr 2012 – die Auswirkungen sind also immer noch ähnlich wie 1941
Von WM wm WM - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23137818
Rasputiza (russisch ‚Wegelosigkeit‘) ist die russische Bezeichnung für die Schlammzeit, Schlammperiode bzw. Regenzeit im Frühjahr und Herbst, in der weite Landschaften und unbefestigte Straßen im östlichen Europa (insbesondere Belarus, Russland und Ukraine) durch Schneeschmelze bzw. die Herbstregenfälle aufgrund der besonderen Geographie der Landschaft aufweichen und unbefahrbar werden. In Russland wird die Rasputiza, die beiden Schlammzeiten, wie eine weitere Jahreszeit betrachtet. Dazwischen liegt die als „General Winter“ bezeichnete Winterzeit.
Zwischen der sowjetischen Westgrenze von 1941 und den drei Städten St. Petersburg, Moskau und Kiew, welche in dieser Reihenfolge etwa 620 bzw. 750 km voneinander entfernt liegen, gibt es keine Bodenerhebung höher als 150 Meter. Die Wassermassen der Schneeschmelze und die der Herbstregenfälle können daher nicht rasch ab- und zusammenlaufen. Auch Hügel oder Berge, in denen je nach Gesteinsart Niederschläge in großen Mengen versickern könnten, um nach Zwischenspeicherung später aus Quellen wieder an Bäche abgegeben zu werden, gibt es nicht. Der Boden weicht folglich tief auf und wird grundlos.
Sowjetunion (Kursk) – Pferdegespann der Wehrmacht in tiefem Schlamm eingesunken (März 1942)
Von Bundesarchiv, Bild 101I-289-1091-26 / Dinstühler / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5410734
Die Dauer der Rasputiza ist von Jahr zu Jahr verschieden. Als Richtwert kann im Frühjahr die Zeit von Mitte März bis Ende April und im Herbst die Zeit von Mitte Oktober bis Ende November genommen werden.
Bedeutung im Krieg
Die beiden Schlammzeiten verhindern etwa für einen Monat jegliche Truppenbewegungen. Während des Zweiten Weltkrieges antwortete der sowjetische Befehlshaber der Woronesch-Front, Filipp Iwanowitsch Golikow, auf die Frage, ob die Aussicht bestünde, dass eine Gegenoffensive der Roten Armee die Dnjepr-Linie noch bis März 1943 erreichen könne:
„Es sind 320 bis 370 km bis zum Dnjepr und 30 bis 35 Tage bis zur Frühjahrs-Rasputiza. Ziehen Sie Ihren eigenen Schluss daraus.“
Dorfstraße vor Moskau, November 1941
Von Bundesarchiv, Bild 183-B15500 / Britting / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5432607
Dieser musste lauten, dass die Schneeschmelze vor dem Abschluss der russischen Operation einsetzen und die Dnjepr-Linie zunächst in deutscher Hand bleiben würde.
Auswirkungen im Zweiter Weltkrieg
Im Deutsch-Sowjetischen Krieg wirkte sich die jahreszeitlich bedingte großflächige Sumpfbildung vor allem zum Nachteil der angreifenden Truppen der Wehrmacht aus, wobei sie auch sowjetische Gegenoffensiven wie die oben erwähnte von 1943 bremste. So dauerte die Schlammperiode im Frühjahr 1941 ungewöhnlich lange und verzögerte den deutschen Überfall auf die Sowjetunion um mehrere Wochen. Die vermatschten Wege und Straßen behinderten ab dem 13. Oktober 1941 beide Seiten in der Schlacht um Moskau. Den Hauptnachteil hatten aber die Angreifer, denn der Schlamm machte deren schnelles Vorrücken auf Moskau unmöglich. Durch die Rasputiza wurde der deutsche Blitzkrieg durch den Schlamm fast zum Stillstand gebracht, da es nicht einmal vor Moskau ein gut ausgebautes asphaltiertes Straßennetz gab, wodurch schwerere Panzer wie der Panzer III und IV mehr oder weniger stecken blieben. Doch nicht nur die Panzer blieben stecken. Da die Eisenbahn von den Sowjets zum einen beim Rückzug zerstört worden war und zum anderen in Russland eine andere Spurweite verwendet wurde, musste die laufende Versorgung der Truppe mit Nachschub über LKW erfolgen. Und auch diese steckten nun im Schlamm fest.
Plötzlich war nicht mehr die Panzertruppe die schnellste und beweglichste Einheit sondern die Infanterie, wobei auch sie mit dem sumpfigen Gelände zu kämpfen hatte. Und in einer solchen Situation wurden naturgemäß auch die Verteidiger begünstigt. Inwieweit die deutschen Planer die Rasputiza beim Unternehmen Barbararossa berücksichtigt haben, ist nicht bekannt. Vermutlich eher nicht, weil man ja glaubte, die Sowjetunion in wenigen Wochen niederzuwerfen. Und ebenso wie bei der fehlenden Winterkleidung hatte man nicht mit Alternativen geplant.
Wehrmachtsoldaten ziehen an der Ostfront ein Auto aus dem Schlamm, November 1941
Von Bundesarchiv, Bild 146-1981-149-34A / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5483120
Für die Panzerwaffe wurde eine Verbesserung erst im Winter 1942 erzielt, als die sogenannten Winterketten eingeführt wurden, die aus einer Verlängerung bestanden, mit der die Ketten durch die Anbringung von Außenplatten verbreitert werden konnten, wodurch der spezifische Druck des Gewichts des Panzers auf den Boden verringert wurde, sodass er sich leichter auf Schnee oder Schlamm bewegen konnte und die Gefahr des Festfahrens verringert wurde. Im Vergleich zu den deutschen Panzern hatten die sowjetischen Modelle wie beispielsweise der T-34 von Haus aus breitere Ketten und er konnte sich daher in dem widrigen Gelände besser fortbewegen. Die einzige Ausnahme der Fortbewegung bildete das wendige und leichte Kettenmotorrad, das bald sehr beliebt wurde. Diese ganzen Verzögerungen verschafften der Roten Armee mehr Zeit, sich auf die Schlacht um Moskau vorzubereiten.
Von Bundesarchiv, Bild 101I-276-0738-15 / Bergmann, Johannes / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5476765
Dann kamen die Winterfröste, die den Boden ab 1. November wieder hart machen. Zwar wurde dies anfangs von der Wehrmacht begrüßt, da dadurch der Boden wieder hart wurde und die Mobilität der schnellen Panzertruppe wieder hergestellt wurde. Doch schon bald gab es ein böses Erwachen, denn die Fröste wurden bereits ab dem 6. November ungewöhnlich streng, worauf die Wehrmacht, die keine Winterkleidung beschafft hatte, nicht vorbereitet war.
Das Wehrmachtsloch und die Prypjatsümpfe
Das Wehrmachtsloch war im Zweiten Weltkrieg eine Bezeichnung durch Stabsoffiziere der Wehrmacht für ein Gebiet in den deutschen Lagekarten der besetzten Sowjetunion, das rund 100.000 Quadratkilometer im Bereich der Prypjatsümpfe umfasste. Der Name wies darauf hin, dass es in dieser Region keine größeren deutschen Verbände gab. Sowjetische Partisanen bauten das große Wald- und Sumpfgebiet jedoch trotzdem zu einem Hauptstützpunkt und Operationsgebiet ihrer Kampfeinsätze aus.
Sowjetisches Geschütz, Oktober 1942
Von RIA Novosti archive, image #90027 / Lander / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15579470
Die Wehrmachtsführung hielt große Teile dieses Sumpfgebietes für unpassierbar, was sich aber als falsch herausstellte. Die ortskundigen Partisanen führten im Laufe der „Operation Bagration“ im Sommer 1944 sowjetische Truppen durch diese Sumpfgebiete, in denen sie auch Knüppeldämme anlegten, die von Panzern und LKW passiert werden konnten.
Zwischen der sowjetischen Grenze von 1941 und den drei Städten Leningrad, Moskau und Kiew, die je etwa 1000 Kilometer voneinander entfernt liegen, gibt es, wie schon erwähnt, keine Bodenerhebung höher als 150 Meter. Da die Flüsse, die diese weitläufige Ebene durchströmen, parallel zu der Richtung verlaufen, die der deutsche Vormarsch nahm, standen den motorisierten deutschen Einheiten zunächst keine nennenswerten natürlichen Hindernisse mit Ausnahme der Prypjatsümpfe selbst im Weg. Das Gebiet der Sümpfe wurde jedoch von den Planern des Unternehmen Barbarossa für ungeeignet gehalten, um reguläre militärische Operationen durchzuführen. Daher blieb es von der deutschen Wehrmacht weitgehend unbesetzt.
Von Bundesarchiv, Bild 101I-140-1210-26A / Götze / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5476236
Von Bundesarchiv, Bild 101I-140-1220-17A / Cusian, Albert / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5476238
Von Bundesarchiv, Bild 101I-023-3496-29 / Wolff, Paul / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5475384
Von Bundesarchiv, Bild 146-1982-184-32 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5483157
General Winter
General Winter (oder auch ‚General Frost‘) ist ein symbolischer Begriff aus der russischen Geschichte, der die kalten russischen Winter bezeichnet, die schon mehrfach maßgeblich dazu beitrugen, fremde Invasoren aus Russland zu vertreiben. Der Winterzeit im Osten ist die Rasputiza als Schlammzeit vor- und nachgelagert.
Rückzug der Wehrmacht vor Moskau
Einmarsch der deutschen Achsenmächte, 1941
Nach den Erinnerungen von Heinz Guderian sollten die Truppen Hitler-Deutschlands und seiner europäischen Verbündeten der Achsenmächte gemäß dem Plan „Barbarossa” den Blitzkrieg bis zum Winter 1941/1942 beenden. Da nicht genügend Winterausrüstung bereitgestellt worden war und die Truppen dann doch von Frost überrascht wurden, konnte die vorhandene Kleidung nicht schnell genug aus den polnischen Lagern über Hunderte von Kilometern an die Front geliefert werden. Auch Fahrzeuge, Lokomotiven, Geschütze und Panzer waren nicht für die extremen Kältebedingungen dieses Winters gerüstet und fielen regelmäßig aus oder sprangen nicht an. Der kritische Moment traf die Deutsche Wehrmacht wenige Dutzend Kilometer vor Moskau, als einigen Fahrzeugen auch noch der Treibstoff einfror und mehr Gerät wegen der Kälte und nicht wegen Gegnereinwirkung ausfiel. Eine ähnliche Situation ergab sich für die Soldaten, die teilweise heftig mit Erfrierungen zu kämpfen hatten.
Soldaten der Wehrmacht auf Wache im Dezember 1941 westlich von Moskau
Von pic from Wilhelm Gierse, my dead uncle, I am the heir of the pic - Eigenes Werk, CC BY 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7445620
Laut der Temperaturkurve für Moskau im Jahr 1941 sank die Lufttemperatur bereits erstmals am 4. November auf −7 °C. Diese tiefen Temperaturen hielten drei Tage lang an und dann folgte ein Anstieg auf null Grad, der jedoch nicht lange anhielt. Die Lufttemperatur sank plötzlich für drei Tage (11. bis 13. November) um 15 bis 18 Grad und lag danach wieder zwischen −5 und −10 °C, wobei sie erst zu Beginn der Gegenoffensive der Roten Armee Anfang Dezember 1941 deutlich sank.
Die Sibirier kommen
Von Mil.ru, CC BY 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65982940
In seinen Memoiren „Soldatische Pflicht” erwähnt Marschall Rokossowski ebenfalls die anhaltenden, aber recht hohen Minustemperaturen als entscheidenden Faktor, der es der Wehrmacht ermöglichte, ihren Vormarsch auf Moskau fortzusetzen:
„Am 17. November setzte der Feind seinen Vormarsch fort und schickte immer neue Truppen ins Feld. Die Kälte hatte die Sümpfe gefroren, und nun hatten die deutschen Panzer- und motorisierten Verbände – die Hauptangriffskraft des Feindes – mehr Bewegungsfreiheit. Das spürten wir sofort. Das feindliche Kommando begann, Panzer abseits der Straßen einzusetzen.“
Auch wenn nun zunächst die deutschen Truppen wieder mobil waren und auch der Nachschub an Treibstoff und Munition wieder zu rollen begann, sollte die Macht des Winters und russische Verstärkungen aus Sibirien nur wenige Wochen später die Wehrmacht vor den Toren Moskaus zum Stehen bringen.
Verbrannte Erde
Verbrannte Erde bezeichnet eine seit der Antike praktizierte Kriegstaktik, bei der eine Armee alles zerstört, was dem Gegner in irgendeiner Weise nützen könnte, also Gleise, Straßen, Brücken, liegengebliebene Fahrzeuge, Lebensmittelvorräte, Fabriken, Wohnhäuser und manchmal bis hin zur kompletten Zerstörung von Städten und Dörfern. Technische Werkzeuge, als Beispiele in jüngerer Geschichte, die verheerende Schäden für die Zivilbevölkerung hinterlassen, sind Schienenwolf, Flammenwerfer und Brandbomben.
Von Bundesarchiv, Bild 101I-087-3693-07A / Koch / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5408602
Die Taktik der verbrannten Erde kommt dann zur Anwendung, wenn entweder die sich zurückziehende Armee nicht damit rechnen kann, in nächster Zeit besetztes oder eigenes Gebiet zurückzuerobern, oder der Gegner Guerillataktik anwendet und auf die Unterstützung der Bevölkerung zählen kann. Im zweiten Falle kalkuliert die Taktik der verbrannten Erde bewusst ein, dass dies auch auf Kosten der eigenen Bevölkerung geht. In allen Fällen hat die Anwendung dieser Taktik oft Hungersnöte und andere schwerwiegende Auswirkungen zur Folge. Zu unterscheiden ist, ob die Taktik ein angegriffener Staat zur eigenen Verteidigung oder eine Kriegspartei, die ein Land überfällt, anwendet. Dementsprechend ist diese Kriegshandlung bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts für Besatzungsarmeen durch die Haager Landkriegsordnung als völkerrechtswidrig geächtet.
Völkerrecht
Die Haager Landkriegsordnung in der Fassung von 1907 legt in folgenden Artikeln einerseits fest: