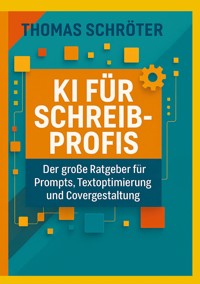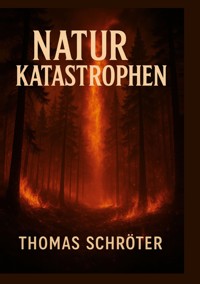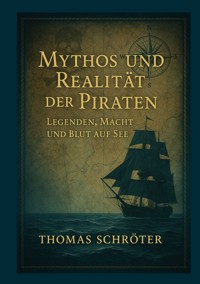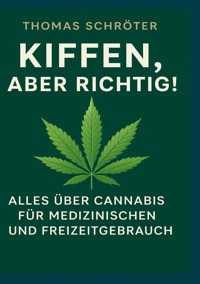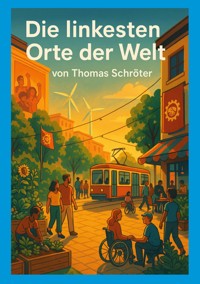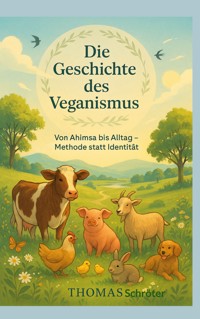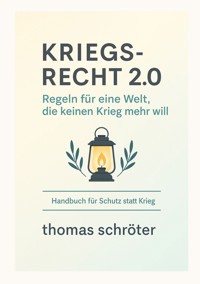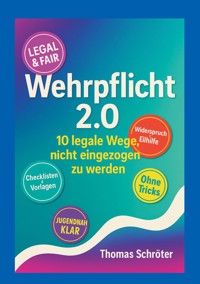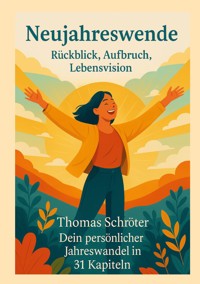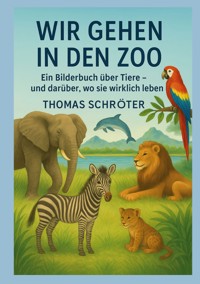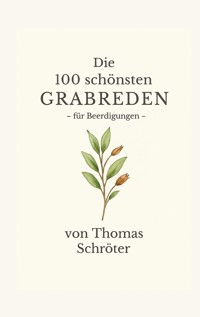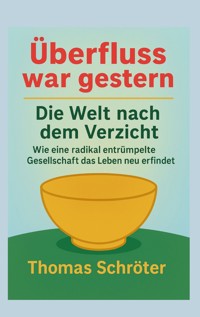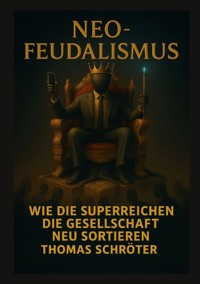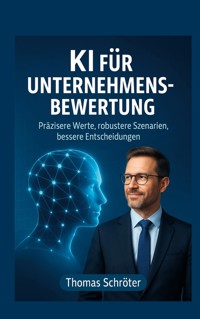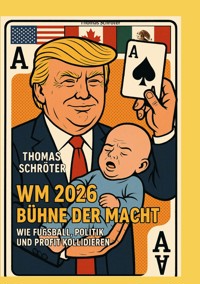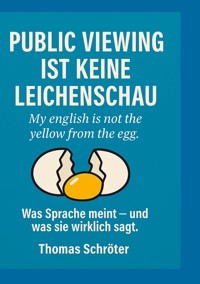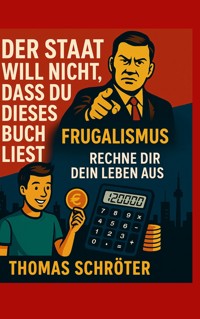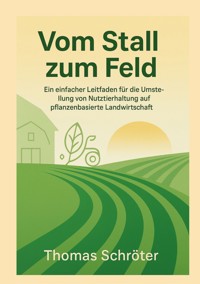
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist ein praxiserprobter Fahrplan für Höfe, die von Tierhaltung auf eine rein pflanzenbasierte Landwirtschaft umstellen möchten; ohne Fachjargon, in klarer, leicht verständlicher Sprache. In 20 Kapiteln führst du deinen Betrieb Schritt für Schritt durch Standortanalyse, Fruchtfolge, Bodenaufbau, Beikraut und Nährstoffmanagement, Wassermanagement, Technik, Pflanzengesundheit, Kulturen (Leguminosen, Getreide, Öl und Eiweißpflanzen, Feldgemüse, Dauerkulturen/Agroforst), Lager/Reinigung/Trocknung, Vermarktung, Organisation/Finanzen bis zum dreijährigen Umsetzungsfahrplan. Herzstück sind Checklisten, SOPs, Formblätter, Rechenhilfen und Vorlagen im Anhang; sofort druckfertig. Jede Empfehlung ist so gewählt, dass sie mit vorhandener Technik startet und sich wirtschaftlich skalieren lässt. Ziel: bedeckte, lebendige Böden, planbare Erträge, stabile Qualität und ein ruhiger Betriebsalltag; ganz ohne tierische Betriebsmittel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1 Warum umstellen
Kapitel 2 Startinventur deines Hofes
Kapitel 3 Wohin mit den Tieren Wege der verantwortungsvollen Abgabe
Kapitel 4 Recht, Finanzen und Risiko sicher planen
Kapitel 5 Fläche, Fruchtfolge und Anbauziele festlegen
Kapitel 6 Boden verstehen humusaufbauende Landwirtschaft
Kapitel 7 Gründüngung und Zwischenfrüchte
Kapitel 8 Nährstoffmanagement ohne Gülle und Mist
Kapitel 9 Wassermanagement Bewässerung Drainage Erosion
Kapitel 10 Technik und Maschinen für den Pflanzenbetrieb
Kapitel 11 Pflanzengesundheit ohne tierische Betriebsmittel
Kapitel 12 Körnerleguminosen Erbse Ackerbohne Lupine Soja
Kapitel 13 Getreide Weizen Roggen Gerste Hafer Dinkel
Kapitel 14 Öl und Eiweißpflanzen Raps Sonnenblume Lein Hanf
Kapitel 15 Feldgemüse Grundlagen für Einsteiger
Kapitel 16 Dauerkulturen Beeren Streuobst Nüsse Agroforst
Kapitel 17 Lager, Reinigung und Trocknung
Kapitel 18 Vermarktung Absatzwege und Preise
Kapitel 19 Organisation Arbeitszeit Kennzahlen Finanzierung
Kapitel 20 Umsetzungsfahrplan Drei Jahre vom Start zur stabilen rein pflanzenbasierten Landwirtschaft
Anhang Übersicht und Vorlagen
Vorwort
Dieses Buch erklärt in einfacher Sprache, wie du deinen Hof von Nutztierhaltung auf eine rein pflanzenbasierte Landwirtschaft umstellst. Schritt für Schritt. Ohne Fachjargon. Mit klaren Aufgaben, Beispielen und Checklisten. Du musst kein Experte sein. Wichtig ist nur, dass du die Reihenfolge einhältst und dir für jeden Schritt genügend Zeit nimmst.
Viele Betriebe stehen vor ähnlichen Fragen. Was passiert mit den Tieren. Wie ernähre ich den Boden ohne Gülle. Welche Kulturen passen zu meiner Fläche. Wie finanziere ich die Umstellung. Dieses Buch gibt dir Antworten und einen machbaren Plan. Du kannst heute mit der Bestandsaufnahme beginnen.
Das Ziel ist ein Hof, der von Pflanzen lebt und wirtschaftlich trägt. Du sparst Zeit bei der Stallarbeit, reduzierst Risiken, verbesserst die Bodenfruchtbarkeit und öffnest dir neue Märkte. Fange an. Klein. Sicher. Mit einem Plan.
So nutzt du dieses Buch
Lies zuerst die Kapitel 1 bis 5. Danach wählst du einen Umstellungsfahrplan in Teil E. Anschließend arbeitest du Kapitel 6 bis 18 passend zu deinem Plan durch und ergänzt bei Bedarf Teil D. Am Ende nutzt du die Anhänge, um deine Unterlagen zu strukturieren.
Am Rand jedes Kapitels stehen drei Elemente
Ziel des Kapitels.
Aufgaben in der richtigen Reihenfolge.
Checkliste zur Kontrolle.
Wenn du nicht alles beim ersten Mal schaffst, ist das normal. Wiederholen ist erlaubt. Wichtig ist, dass du die Checkliste vor dem nächsten Schritt abhakst.
Kapitel 1 Warum umstellen
Dieses Kapitel hilft dir, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Am Ende kennst du deine eigenen Gründe, deine Chancen und deine Grenzen. Du hast einen kurzen Text auf einer Seite, der erklärt, warum du deinen Hof auf eine rein pflanzenbasierte Landwirtschaft umstellen willst. Mit diesem Text kannst du später mit deiner Familie, mit deiner Bank, mit Beraterinnen und Beratern und mit möglichen Handelspartnern sprechen.
Worum es bei der Umstellung wirklich geht
Eine Umstellung bedeutet nicht nur, dass keine Tiere mehr auf dem Hof leben. Es ist eine Veränderung des ganzen Systems. Arbeit, Zeitabläufe, Maschinen, Gebäude, Böden, Kulturen, Vermarktung, Finanzierung und Kommunikation verändern sich. Viele Dinge werden einfacher, manches ist neu. Du ersetzt Stallarbeit, Fütterung und Tiergesundheitsmanagement durch Bodengesundheit, Fruchtfolge und Vermarktung pflanzlicher Produkte. Statt Milch oder Fleisch lieferst du Getreide, Leguminosen, Öl und Eiweißpflanzen, Feldgemüse oder Produkte aus einfachen Verarbeitungsschritten wie geschälte Körner, Mehl oder kalt gepresstes Öl. Das Ziel ist ein klarer, stabiler Kreislauf mit gesunden Böden, verlässlichen Erträgen und planbarer Arbeit.
Typische Ausgangslagen
Viele Betriebe denken über eine Umstellung nach, weil die Arbeitsbelastung hoch ist, die Erlöse schwanken oder weil Investitionen im Stall anstehen. Manche Betriebe haben freie Flächenanteile, die heute schon pflanzlich genutzt werden. Andere sehen neue Chancen in der Direktvermarktung, im regionalen Handel oder in Partnerschaften mit Mühlen, Ölmühlen und Lebensmittelhandwerk. Wieder andere möchten bewusster wirtschaften, Ressourcen schonen und Risiken verteilen. Alle diese Ausgangspunkte sind geeignet. Wichtig ist, dass du sie offen benennst und daraus dein eigenes Ziel ableitest.
Nutzen und Chancen in einfacher Sprache
Ohne Stallarbeit hast du planbarere Tage. Melkzeiten, Kalbungen, Tierarzttermine und Fütterungsfenster entfallen. Stattdessen konzentrierst du dich auf Bodenpflege, Saat, Pflegegänge und Ernte. Das senkt Spitzenbelastungen in vielen Wochen des Jahres. Du bist weniger abhängig von Tierpreisen, Futterzukauf und tierbezogenen Vorschriften. Du kannst Flächen gezielt für Leguminosen nutzen, die Stickstoff aus der Luft binden und deinen Boden versorgen. Du öffnest dir neue Märkte für Menschen, die regionale pflanzliche Lebensmittel suchen. Du schaffst dir die Möglichkeit, alte Ställe sinnvoll zu nutzen, etwa als Lager, Trocknung, Werkstatt oder Verkaufsraum.
Risiken ehrlich ansehen
Jede Umstellung hat Risiken. Erträge in den ersten Jahren können schwanken, bis Böden und Fruchtfolgen stabil laufen. Umbauten und neue Technik kosten Geld. Vermarktung muss zuverlässig sein. Manche Nachbarn oder Partner stellen Fragen oder sind skeptisch. Wenn du diese Punkte früh ansprichst, sie mit Zahlen hinterlegst und Gegenmaßnahmen planst, werden sie beherrschbar. Später in diesem Buch findest du einfache Werkzeuge dafür. Für dieses Kapitel genügt, die drei größten Risiken zu benennen und jeweils eine klare Gegenmaßnahme zu notieren.
Deine persönliche Begründung Schritt für Schritt
Nimm dir eine Stunde Zeit und schreibe auf, warum du umstellen willst. Nutze dafür ein leeres Blatt oder eine neue Datei. Arbeite in vier kurzen Blöcken, jeweils wenige Sätze.
Erstens schreibe deine drei wichtigsten Gründe. Das können Gesundheit, Arbeitszeit, Wirtschaftlichkeit, Bodenfruchtbarkeit, Umweltgedanken oder Marktchancen sein. Schreibe in Alltagssprache und bleibe konkret.
Zweitens beschreibe dein Zielbild in drei Jahren. Welche zwei bis drei Hauptkulturen möchtest du anbauen. An wen möchtest du verkaufen. Wie sollen die Gebäude genutzt werden. Wie soll sich dein Arbeitsalltag anfühlen.
Drittens notiere deine größten Sorgen. Denke an Vermarktung, an Umbaukosten, an
Ertragsschwankungen, an die Frage, wohin die Tiere gehen und wie der Übergang organisiert wird. Es geht hier nicht um Lösungen, nur um Klarheit.
Viertens formuliere einen Satz für dich selbst, der dich durch schwierige Tage trägt. Dieser Satz verbindet deine Gründe mit deinem Zielbild. Lies ihn laut vor. Er soll dich motivieren.
Gespräch mit Familie und Partnern
Eine Umstellung trägt besser, wenn alle Beteiligten sie verstehen. Lege deinen begründeten Text auf den Tisch. Höre zu, bevor du erklärst. Frage aktiv nach, was Sorgen macht und was Hoffnung macht. Halte die wichtigsten Punkte in einem kurzen Protokoll fest. Notiere, wer welche Fragen bis wann klärt. So baust du Vertrauen auf. Wenn du mit einer Bank oder Förderstelle sprichst, hilft dir genau dieses Protokoll, weil es zeigt, dass du strukturiert arbeitest.
Ein einfacher Plan für die ersten zwei Wochen
In der ersten Woche sammelst du alle offenen Gedanken. Schreibe jeden Tag zehn Minuten an deinem Begründungstext und lasse ihn wachsen. In der zweiten Woche führst du ein Familiengespräch und ein kurzes Telefonat mit einer Vertrauensperson außerhalb des Hofes. Am Ende der zwei Wochen steht ein Text von einer Seite, ein kurzes Protokoll und eine Liste mit drei Risiken und drei Gegenmaßnahmen in Stichworten. Mehr ist in diesem Schritt nicht nötig. Alles Weitere folgt in den nächsten Kapiteln.
Beispiel aus der Praxis
Betrieb Huber bewirtschaftet fünfundvierzig Hektar mit mittleren Böden und hält fünfzig Milchkühe. Die Melkstandanlage ist älter und bräuchte in den nächsten Jahren eine größere Investition. Die Arbeitstage sind lang, besonders in den Wintermonaten. Familie Huber entscheidet sich für eine Umstellung auf erbsen und lupinenbasierte Fruchtfolgen mit Hafer und Dinkel.
Der alte Boxenlaufstall wird in zwei Etappen zur Lagerhalle und Werkstatt umgebaut. Ziel nach drei Jahren sind stabile Erträge, Lieferbeziehungen zu einer regionalen Mühle und zu einer kleinen Ölmühle sowie ein Hofverkauf an zwei Nachmittagen pro Woche. Die größten Sorgen sind Preisrisiken und
Ertragsschwankungen. Gegenmaßnahmen sind Vertragsanbau mit Mindestpreisen und konservative Ertragsannahmen im Finanzplan. Der Übergang bei den Tieren wird mit frühzeitiger Reduktion, klaren Abnahmevereinbarungen und kleinen
Transportgruppen organisiert. Das Familienprotokoll hält fest, wer welche Gespräche führt und wann die nächste Entscheidung ansteht.
Mini Fragen und Antworten
Muss ich sofort alles ändern. Nein. Du kannst die Umstellung in Etappen planen. Zuerst die Entscheidung und der Plan, dann der geordnete Ausstieg aus der Tierhaltung, dann der Aufbau der Fruchtfolge und der Vermarktung.
Brauche ich sofort neue Maschinen. Nicht zwingend. Viele Betriebe kommen in den ersten Jahren mit vorhandener Technik aus und ergänzen gezielt. In Kapitel Technik findest du einfache Empfehlungen.
Wie erkläre ich die Umstellung nach außen. Sprich von Boden, von regionaler Ernährung und von planbarer Arbeit. Halte es einfach und freundlich. Wer fragt, bekommt klare Antworten.
Check zum Abschluss des Kapitels
Du hast einen Begründungstext auf einer Seite mit deinen drei wichtigsten Gründen und deinem Zielbild in drei Jahren. Du hast drei größte Sorgen notiert und je eine Gegenmaßnahme benannt. Du hast ein kurzes Protokoll eines Familiengesprächs oder eines Gesprächs mit deinen engsten Partnerinnen und Partnern. Wenn dir noch etwas fehlt, nimm dir heute Abend weitere zehn Minuten und ergänze es. Erst wenn dieser Check erfüllt ist, gehst du zum nächsten Kapitel.
Ausblick auf das nächste Kapitel
Als Nächstes erfasst du den Ist Zustand deines Hofes. Du legst eine einfache Inventur an, die aus Flächen, Maschinen, Gebäuden, Tieren, Verträgen und einer kurzen Liquiditätsübersicht besteht. Diese Inventur ist die Grundlage für deinen Fahrplan und für jedes spätere Gespräch mit Bank, Handel und Förderung.
Kapitel 2 Startinventur deines Hofes
Dieses Kapitel führt dich Schritt für Schritt durch eine einfache Bestandsaufnahme. Am Ende weißt du genau, welche Flächen, Maschinen, Gebäude, Verträge und Finanzen du hast. Nur mit diesem Überblick kannst du sicher planen. Du brauchst dafür keine Spezialsoftware. Ein Notizbuch oder eine einfache Textdatei genügt. Wenn du gern am Computer arbeitest, lege dir einen übersichtlichen Ordner an und speichere alle Dateien dort ab.
Worum es bei der Inventur geht
Eine Inventur ist eine Liste deines Hofes in verständlicher Sprache. Sie zeigt, was vorhanden ist, was fehlt und was du umnutzen kannst. Sie ist nicht perfekt und nicht endgültig. Sie ist ein Arbeitsdokument, das du später ergänzt. Wichtig ist nicht die Genauigkeit auf den letzten Zentimeter, sondern der rasche Überblick, mit dem du Entscheidungen treffen kannst.
So bereitest du dich vor
Lege dir Papier, Stift oder eine leere Datei bereit. Nimm deinen Flächenübersichtsplan, die letzten Dünge und Ernteaufzeichnungen, die Maschinenpapiere, die wichtigsten Verträge und die Kontoauszüge der letzten zwölf Monate zur Hand. Wenn dir etwas fehlt, notiere eine Lücke und gehe weiter. Lücken füllst du später.
Ordnerstruktur, die sich bewährt hat
Erstelle einen Hauptordner mit dem Namen Inventur. Darin legst du Unterordner an. Fläche. Maschinen. Gebäude. Tiere. Verträge. Finanzen. Förderung. Fotos. In jeden Unterordner kommt eine einfache Datei mit der Übersicht sowie vorhandene Nachweise. So findest du alles schnell wieder und kannst Kopien an Bank, Beratung oder Handel schicken, ohne neu zu suchen.
Flächenliste anlegen
Erstelle eine Liste aller Schläge. Zu jedem Schlag hältst du fest. Lage und Name. Größe in Hektar. Bodenzahl oder Bodenart, so weit bekannt. Wasserverfügbarkeit wie Oberflächenwasser, Brunnen oder Bewässerungsmöglichkeit. Besonderheiten wie Hanglage, Vernässung, Schlagteiler, angrenzende Wege. Bisherige Kulturen der letzten fünf Jahre und die groben Erträge. Geplante Nutzung im ersten Umstellungsjahr, wenn du dazu schon eine Idee hast.
Wenn du keine Bodenzahlen zur Hand hast, beschreibe in einfachen Worten, wie sich der Boden anfühlt und verhält. Schwer und bindig oder leicht und sandig. Hält Wasser gut oder trocknet schnell aus. Diese Einschätzung reicht für die ersten Entscheidungen.
Fruchtfolge und Erträge der letzten Jahre
Schreibe für jeden Schlag die Reihenfolge der Kulturen der vergangenen Jahre auf. Erntezahlen müssen nicht auf das Kilogramm genau sein. Notiere Durchschnittserträge, wie du sie aus deinen Ablieferungen kennst. Erkenne Muster. Wo waren Leguminosen schon einmal erfolgreich. Wo gab es Krankheitsdruck. Wo waren Ausfälle durch Staunässe oder Trockenheit. Aus dieser Übersicht leitest du später eine stabile neue Fruchtfolge ab.
Boden und Wasser kurz beschreiben
Notiere pro Schlag, ob es Verdichtungen gibt, ob du Spuren von Erosion beobachtet hast, ob Drainagen vorhanden sind und ob sie funktionieren. Halte fest, ob dir eine Bodenprobe aus den letzten zwei Jahren vorliegt. Wenn nicht, plane sie für den nächsten Winter ein. Schreibe dazu, ob Bewässerung technisch möglich ist und ob sie wirtschaftlich in Frage kommt. Ein Satz pro Schlag genügt.
Maschinenbestand erfassen
Erstelle eine Liste aller Maschinen. Traktorengröße und Baujahre. Sätechnik. Striegel. Hacke. Pflug, Grubber oder andere Bodenbearbeitung. Erntetechnik. Transport. Trocknung und Reinigung. Zubehör wie Frontladerwerkzeuge. Zu jeder Maschine notierst du den Zustand in einfachen Worten. Gut, ausreichend oder reparaturbedürftig. Schreibe dazu, ob die Maschine für den Pflanzenbau weiter nutzbar ist. Oft genügt vorhandene Technik, ergänzt um wenige Anbaugeräte.
Gebäude und Lager erfassen
Liste alle Gebäude mit Größe, Bauart und Zustand. Wohnhaus, Stall, Nebengebäude, Hallen, Silos, Güllebehälter, Dunglager, Werkstatt, Kühlraum, Hofladen, Büro. Notiere zu jedem Gebäude, wofür es künftig nutzbar ist. Der ehemalige Stall kann Lager, Trocknung, Verpackung oder Werkstatt werden. Silos können Getreidelager oder Materiallager werden. Schreibe dazu, ob Umbauten nötig sind und ob Genehmigungen zu erwarten sind. Plane grob in Etappen. Erst Lager und Trocknung, dann Schönes.
Tierbestand und Übergang
Notiere den aktuellen Tierbestand nach Art und Anzahl. Füge eine Spalte mit dem geplanten Weg hinzu. Abgabe an Lebenshof, Abgabe an ausgewählte Betriebe, natürliche Bestandsreduzierung. Schreibe einen Zieltermin pro Gruppe. Dies verbindet die Inventur mit dem späteren Übergangsplan. Lege die Tierpapiere und Gesundheitsnachweise in den Ordner Tiere.
Verträge zusammentragen
Sammle alle laufenden Verträge. Lieferverträge für Milch oder Fleisch. Pachtverträge mit Laufzeit und Kündigungsfristen. Dienstleistungsverträge zum Beispiel mit Maschinenringen. Darlehensverträge mit Restlaufzeit und Zinsen. Versicherungen. Notiere pro Vertrag die wichtigsten Eckpunkte auf einer halben Seite und hefte den Volltext in den Unterordner Verträge. Markiere in deiner Übersicht, welche Verträge von der Umstellung betroffen sind und bis wann du sie kündigen oder anpassen musst.
Finanzen übersichtlich darstellen
Lege eine einfache Gewinn und Verlust Übersicht der letzten zwölf Monate an. Dafür reicht eine grobe Einteilung. Einnahmen aus Verkauf, Förderung und Nebentätigkeiten. Ausgaben für Futter, Tierarzt, Lohnarbeiten, Diesel, Pacht, Kredite, Instandhaltung, Versicherung, Strom und Sonstiges. Notiere zusätzlich deine aktuellen Kontostände und eine grobe Liquiditätseinschätzung. Wie viele Monatskosten kannst du aus vorhandenen Mitteln bestreiten. Ziel sind drei bis sechs Monate Puffer für die Umstellung.
Förderungen und Programme
Schreibe auf, welche Förderungen du erhältst und welche Programme in Frage kommen, wenn du auf pflanzliche Erzeugung umstellst. Bioförderung, Agrarumweltmaßnahmen, Investitionsförderung für Lager und Trocknung, Förderungen für Beratung. Du musst hier noch nichts beantragen. Wichtig ist, dass du erkennst, welche Wege offenstehen und welche Fristen gelten.
Personal und Arbeitszeit
Notiere, wer regelmäßig mitarbeitet. Familienmitglieder, Angestellte, Saisonkräfte. Schreibe in wenigen Sätzen, welche Arbeitsspitzen es heute gibt und welche Arbeitsspitzen in Zukunft zu erwarten sind. Saat und Ernte statt Melkzeiten, Pflegegänge statt Fütterung. Diese Übersicht hilft dir später, Arbeitspläne zu glätten und Schulungen einzuplanen.
Fotodokumentation anlegen
Gehe einmal über den Hof und mache klare Fotos von den wichtigsten Bereichen. Gebäude außen und innen. Lager. Maschinen. Schläge mit typischen Stellen, zum Beispiel mit Verdichtungsproblemen. Lege die Fotos in den Ordner Fotos ab und benenne sie verständlich. Diese Bilder helfen bei Gesprächen mit Bank, Beratung und Handwerkern und zeigen später deinen Fortschritt.
Typische Lücken und wie du damit umgehst
Es ist normal, dass dir Daten fehlen. Schreibe Lücken sichtbar in deine Dateien. Beispiel. Bodenproben für Schlag sieben fehlen. Drainageplan unklar. Vertrag X wird neu angefordert. Setze dir ein Datum, bis wann du die Lücke schließt. So behältst du den Überblick, ohne stehen zu bleiben.
Beispiel für eine einfache Flächenkarte auf einer Seite
Oben steht Hofname und Datum. Darunter folgt eine Liste mit zehn Schlägen, Größe, kurzer Bodenbeschreibung, Wasserhinweis und geplante Kultur im ersten Umstellungsjahr. Am Rand steht eine Notiz. Drainage Schlag drei prüfen. Schlag fünf für Lupine vormerken. Schlag acht für Hafer mit Zwischenfrucht. Diese eine Seite reicht, um mit Beratung und Handel erste Gespräche zu führen.
Schneller Zwei Wochen Plan für die Inventur
Am ersten Tag legst du die Ordnerstruktur an. Am zweiten Tag erfasst du alle Schläge grob. Am dritten Tag ergänzt du die letzten fünf Jahre Kulturen und Erträge. Am vierten Tag schreibst du die Maschinenliste. Am fünften Tag erfasst du die Gebäude. Am sechsten Tag sortierst du die Verträge. Am siebten Tag trägst du Finanzen grob zusammen. In der zweiten Woche machst du Fotos, ergänzt Lücken und führst ein kurzes Gespräch mit einer Vertrauensperson oder Beraterin. Wenn etwas mehr Zeit braucht, ist das in Ordnung. Wichtig ist der gleichmäßige Fortschritt.
Mini Fragen und Antworten
Brauche ich genaue Ertragszahlen. Nein. Schätze mit gesundem Menschenverstand und nutze deine Ablieferungsbelege als Orientierung. Für die Planung reichen grobe Werte, die du später verfeinerst.
Reicht eine Handskizze für die Schläge. Ja. Eine klare Skizze mit Namen und Größen ist besser als lange Unklarheit. Du kannst später einen digitalen Plan ergänzen.
Muss ich jede Maschine auflisten. Ja, aber kurz. Schreib Baujahr und Zustand in drei Worten. Gut, ausreichend oder reparaturbedürftig. Mehr ist jetzt nicht nötig.
Checkliste zum Abschluss
Flächenliste für alle Schläge mit Größe, Bodenbeschreibung, Wasserhinweis, Kulturhistorie und erster Idee für die künftige Nutzung liegt vor. Kurze Notizen zu Boden und Wasser je Schlag liegen vor. Verdichtungen, Erosion, Drainage, Bewässerung.
Maschinenliste mit Zustand und Eignung für den Pflanzenbau ist erstellt.
Gebäudeübersicht mit möglicher künftiger Nutzung und grobem Umbauplan ist erstellt.
Tierbestand mit geplanter Abgabe oder Reduktion ist notiert.
Vertragsübersicht mit Laufzeiten und Fristen liegt vor.
Einfache Finanzübersicht der letzten zwölf Monate und grobe Liquiditätseinschätzung sind erstellt.
Förderungen und mögliche Programme sind als Liste erfasst.
Personal und Arbeitszeitspitzen sind beschrieben.
Fotodokumentation der wichtigsten Bereiche ist angelegt.
Offene Lücken sind sichtbar markiert und mit einem Datum versehen.
Wenn du diese Punkte abgehakt hast, bist du bereit für das nächste Kapitel. Dort klären wir, wohin die Tiere gehen, wie du den Übergang respektvoll und rechtlich sauber gestaltest und wie du die frei werdenden Gebäude frühzeitig sinnvoll einplanst.
Kapitel 3 Wohin mit den Tieren Wege der verantwortungsvollen Abgabe
Dieses Kapitel zeigt dir einen klaren, machbaren Weg, wie du deinen Tierbestand geordnet, respektvoll und rechtlich sauber reduzierst und abgibst. Am Ende hast du einen Zeitplan, eine Liste geeigneter Abnehmerinnen und Abnehmer, vorbereitete Unterlagen, einen Transportplan, einfache Verträge und ein Protokoll für jede Tierübergabe. Du weißt außerdem, wie du frei werdende Stallflächen sinnvoll einbindest, damit die Umstellung ruhig und ohne
Zeitdruck gelingt.
Worum es wirklich geht
Die Tiere sind Lebewesen. Eine erfolgreiche Umstellung beginnt damit, dass jede Entscheidung am Wohl der Tiere ausgerichtet ist und zugleich deinen Betrieb wirtschaftlich schützt. Es gibt mehrere gute Wege. Du kannst Tiere an geprüfte Betriebe mit hoher Haltungsqualität abgeben, Tiere auf Lebenshöfe vermitteln, Bestände über Nichtnachbelegung und natürlichen Abgang geordnet reduzieren und besondere Lösungen wie Patenschaften oder Hofabnahmeverträge nutzen. Dein Ziel ist ein geplanter und dokumentierter Übergang ohne hektische Ad-hoc Entscheide.
Der einfache Sechs Schritte Fahrplan
Erstens Bestandsbild erstellen. Du teilst den Tierbestand nach Gruppen, Alter, Gesundheitsstatus und Papieren ein und vergibst Zieltermine für die Abgabe.
Zweitens Empfängerkreis aufbauen. Du erstellst eine Liste möglicher Abnehmerinnen und Abnehmer und bewertest sie nach klaren Kriterien.
Drittens Recht und Dokumente klären. Du legst alle Nachweise, Tierpässe, Registrierungen und Impfprotokolle bereit und prüfst, welche Meldungen vor und nach der Abgabe nötig sind.
Viertens Verträge vorbereiten. Du nutzt kurze, eindeutige Vereinbarungen für jede Abgabe und ein Übergabeprotokoll mit Gesundheitsangaben.
Fünftens Transport verantwortungsvoll organisieren. Du planst Routen, Zeiten, Besatzdichten, Ruhepausen und die Absicherung bei Ausfällen.
Sechstens Ställe umstellen. Du senkst Belegung, passt Fütterung und Betreuung im Übergang an und planst früh die Umnutzung der Gebäude, damit Leerstand und Kosten nicht drücken.
Zeitplan über ein halbes Jahr
In den ersten dreißig Tagen sammelst du Bestandsdaten, baust die Kontaktliste auf, führst zwei bis drei Hoftermine mit möglichen Abnehmerinnen und Abnehmern durch und triffst Grundsatzentscheidungen über die Reihenfolge der Abgabe.
In den Tagen dreißig bis neunzig setzt du die ersten Abgaben um, beginnst mit Gruppen, bei denen die Umstellung am einfachsten ist, und reduzierst die Nachbelegung. Parallel regelst du Umbauten, die keine Genehmigung brauchen, etwa einfache Trennwände und Lagerflächen.
In den Tagen neunzig bis einhundertachtzig schließt du die Abgabe ab, erledigst Restmeldungen, entleerst Futter und Betriebsmittel, überführst geeignete Silos in die pflanzliche Lagerlogistik und stellst die Pflegepläne für die frei werdenden Gebäude auf.
Bestand sauber gliedern
Teile den Tierbestand in Gruppen, die du in der Praxis getrennt bewegen würdest. Bei Rindern zum Beispiel laktierende Kühe, hochtragende Tiere, Trockensteher, Färsen, Kälber. Notiere je Gruppe Anzahl, Altersspanne, Besonderheiten, Ohrmarken oder Identifikationen, Impf und Gesundheitsstatus und die voraussichtliche Abgabeoption. Eine Seite pro Gruppe genügt. Diese Gliederung verhindert Fehler, wenn mehrere Transporte laufen, und erleichtert die Dokumentation.
Mögliche Abnehmerinnen und Abnehmer
Geeignete landwirtschaftliche Betriebe mit hoher Haltungsqualität und nachvollziehbarer Fütterung. Prüfe Plätze, Stallklima, Weideflächen, Arbeitsroutine und Tierärztin oder Tierarzt. Lass dir das Betriebsregister zeigen und sprich offen über deine Ziele.
Lebenshöfe mit klarer Kapazitätsplanung und transparenten Finanzen. Bitte um Einsicht in Belegungspläne, Pflegekonzepte und Notfallfonds. Vereinbare Patenschaften nur, wenn die Versorgung dauerhaft gesichert ist.
Spezielle Aufnahmestellen für einzelne Tierarten. Bei Geflügel und Schweinen sind geprüfte Netzwerke wichtig. Frage nach Erfahrungswerten, Transportwegen und Quarantänevorschriften.
Regionale Netzwerke, die Vermittlung und Monitoring kombinieren. Eine Zwischenstation mit Quarantäne kann sinnvoll sein, wenn Bestände zusammengeführt werden.
Einfache Auswahlkriterien
Platz und Betreuung pro Tier sind ausreichend und klar belegt. Fütterung, Weidegang oder Auslauf, Stallklima und Beschäftigung sind nachvollziehbar geregelt. Tierärztliche Betreuung ist benannt und erreichbar. Transportwege sind kurz und planbar. Verträge und Protokolle sind selbstverständlich. Nachbetreuung und Austausch nach der Übergabe sind willkommen.
Rechtliche und organisatorische Punkte in einfacher Sprache
Vor der Abgabe prüfst du Tierpässe, Registrierungen, Meldungen an die zuständigen Stellen, Impf und Behandlungsdokumentation, Wartezeiten nach Behandlungen und Identifikationen je Tier. Du klärst, ob besondere tierseuchenrechtliche Vorschriften gelten oder ob Sperrfristen relevant sind. Alle Meldungen, die den Bestand betreffen, erfolgen zeitnah und vollständig. Nach der Abgabe passt du deine Bestands und Melderegister an und hebst Unterlagen geordnet auf. Eine klare Ablage vermeidet Rückfragen Monate später.
Gesundheit und Biosicherheit