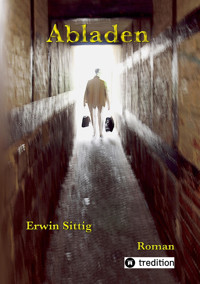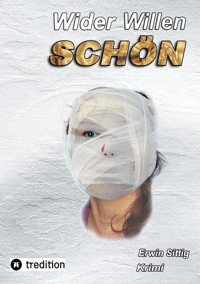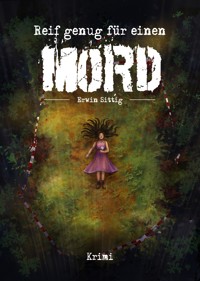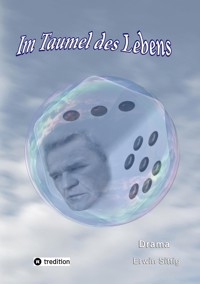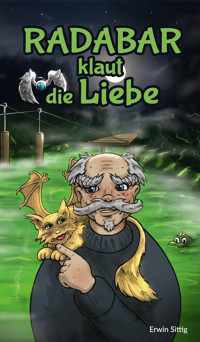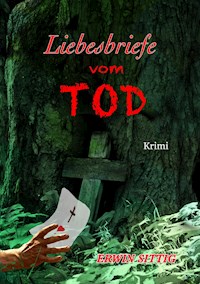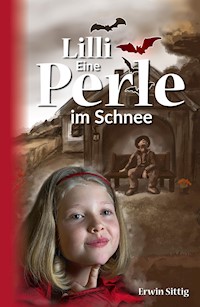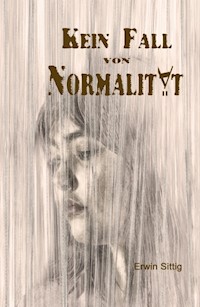7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Einbruch bei Prof. Radloff bringt den Verdacht auf, dass er seine Patienten durch Genmanipulationen zu heilen versuchte. Obwohl es den Anschein hat, als hätte er damit Erfolg gehabt, weisen die Ereignisse darauf hin, dass unberechenbare Nebenwirkungen aufgetreten sein könnten. Schuf er Menschen mit Killerinstinkten? Müssen Menschen sterben, um das Geheimnis des Professors zu wahren? Oder stecken ganz andere Motive hinter den Verbrechen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über den Autor
Der 1953 in Güstrow geborene Autor lebt heute mit seiner Frau in Ludwigsfelde. Sein Studium an der TU Dresden schloss er 1977 als Dipl.-Ing. für Informationstechnik ab.
Neben seiner Arbeit widmete er sich dem Schreiben und der Fotografie. Mit Erreichen des Rentenalters arbeitete er sein Lebenswerk auf und begann mit der Veröffentlichung seiner Bücher.
Es macht ihm Spaß, sich in allen Bereichen der Belletristik auszutoben. So schrieb er neben Kinder- und Jugendbüchern auch Kriminalromane, Abenteuerromane und Fantasygeschichten.
Bei einigen Büchern gestaltete er sein Cover selbst.
Näheres unter https://erwinsittig.de/
Für alle, die sich unverstanden fühlen.
Erwin Sittig
Blicke durch Glasscherben
Kriminalroman
© 2022 Erwin Sittig
https://erwinsittig.de
ISBN Softcover: 978-3-347-70335-3
ISBN Hardcover: 978-3-347-70336-0
ISBN E-Book: 978-3-347-70337-7
Covergestaltung: Erwin Sittig
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Blicke durch Glasscherben
Kapitel 1
Das schmiedeeiserne Tor, das den Zugang zum Park verwehrte, war ein Kunstwerk, das mit beeindruckenden Ornamenten bestach, die in höchster Präzision gestaltet waren. Um dieses Werk zu krönen, hatte der Künstler an den nach oben auslaufenden Stäben goldene Pfeilspitzen installiert. Eine Menge Fotografen waren dessen Charme erlegen und setzten diese Pracht seit vielen Jahren mit immer neuen Perspektiven in Szene.
Verankert war das Tor in mit Sandstein verkleideten Pfeilern, die ihm mit warmen Beigetönen schmeichelten. Das goldfarbene Schild, das auf einem der Pfeiler verschraubt war, trotzte dem diesigen Wetter ein geheimnisvolles Leuchten ab. In schwarzen Lettern wies es darauf hin, dass sich hinter dem prachtvoll gestalteten Tor ein Heim für betreutes Wohnen eingerichtet hatte. Bei diesem ersten Eindruck drängte sich jedem vordergründig der Gedanke auf, dass man schon einigermaßen gut betucht sein musste, wenn man hier Angehörige unterbringen wollte. Die Sonne mühte sich gerade damit ab, sich vom Horizont abzuheben, doch ihre Kraft reichte noch nicht aus, den dichten Nebel zu durchdringen. Würde man das Tor öffnen, um das Grundstück zu erschließen, käme man nach ein paar hundert Metern zu einem alten, hervorragend instand gehaltenem Gutshaus. Die mit Kopfsteinpflaster befestigte Straße führte direkt vor das große Eingangsportal, das man über eine beeindruckende, geschwungene Treppe erreichen konnte. Über dem Portal präsentierten sich auf jeder Etage breite Vorsprünge mit aufwändig gestalteten Balustern. Die weit ausladenden Balkone spendeten dem Ankömmling ausreichend Schutz vor Sonne und Regen. Der Nebel zog vom nahegelegenen See herüber, doch auch die Wiesen des Parks waren noch gut gefüllt mit der Feuchtigkeit der letzten Tage. Man konnte keinen Meter weit sehen. Lediglich ein paar erleuchtete Fenster kündeten vom Erwachen des Morgens, der zur Arbeit rief.
Leise drangen Wortfetzen vom Balkon der obersten Etage herab, obwohl die Türen geschlossen waren.
Frau Fink, eine der Betreuerinnen, eilte forsch den Flur entlang. Sie hatte noch die Nacht im Gesicht und hätte gern etwas weitergeschlafen. Doch die Pflicht rief. Eine Pflicht, bei der sie die Dankbarkeit vermisste. Konnten ihre Schutzbefohlenen überhaupt einschätzen, was sie leistete? Sie bremste ihren Schritt, als sie die junge Frau im Bademantel erblickte, die auf sie zusteuerte.
„Was schleichst du so früh hier herum? Frühstück gibt es erst in zwei Stunden“, blaffte sie die Frau an.
„Ich konnte nicht schlafen. Dann habe ich Sie gehört.“
„Schön, dass du so ein gutes Gehör hast. Jetzt verschwinde wieder in dein Bett, aber zügig!“
Ihrer Stimme war anzuhören, dass sie nicht ihren Traumjob gefunden hatte. Und das sollte jeder spüren. Besonders wenn sie vor Arbeitsantritt gestört wurde.
„Frau Fink?“, sagte die Frau in singendem Ton.
„Was denn noch?“
„Ich dachte, es würde Sie interessieren, wo Ihr Lieblingshalstuch ist, das Sie seit gestern vermissen.“
„Sag schon, wenn du es weißt. Ich habe meine Zeit nicht auf dem Jahrmarkt gewonnen!“
„Wenn ich nicht irre, hängt es hier draußen auf dem Balkon.“
„Wie sollte es dahingekommen sein?“, entgegnete sie mürrisch und warf einen zweifelnden Blick zur breiten Tür, die dort hinführte.
Sie öffnete sie. Kalte Luft drang herein und sie fröstelte augenblicklich. Am liebsten hätte sie dem sofort ein Ende bereitet, um in die behagliche Wärme des alten Gutshauses zurückzukehren. Doch dieses Tuch liebte sie über alles. Es war ein Andenken aus einem weit zurückliegenden Urlaub, der sie vorübergehend an die große Liebe glauben ließ. Und obwohl sie damals unsäglich enttäuscht worden war, bewahrte sie sich den schönen Teil der Erinnerungen. Dieses Tuch symbolisierte ihre Hoffnung, dass das Leben für sie noch ein paar Tortenstücke bereithalten würde.
Die Säulen, die hinter den Elementen der Balustrade hinauf strebten, um das Dach des Balkons zu stützen, waren mit rustikalen Lampen bestückt worden. An einer dieser Leuchten hatte sich ihr Tuch verfangen. Erreichen könnte sie es nur, wenn sie auf die Abdeckplatte stiege, die auf den Balustern lag.
Sie zögerte. Sollte sie sich dieser Gefahr aussetzen?
„Das ist doch bestimmt so ein dummer Jungenstreich. Oder bist du das gewesen?“, fauchte sie die junge Frau an, die bei dem aggressiven Ton noch weiter unter ihre Kapuze des Bademantels kroch.
„Warum sollte ich so etwas tun? Warten Sie ich hole Ihnen einen Stuhl“, rief sie und kam nach ein paar Sekunden mit diesem zurück. Sie stellte ihn an die Balustrade.
„Bitte“, sagte sie freundlich.
Frau Fink sah den Stuhl an, dann ihr geliebtes Tuch und entschloss sich endlich, den Balanceakt zu wagen. Dabei ließ sie ihrem Ärger freien Lauf und schimpfte vor sich hin.
„Das wird ein Nachspiel haben. Wehe, wenn mir der Schuldige zwischen die Finger gerät!“
Mit wackligen Beinen betrat sie den Stuhl und klammerte sich an die Säule. Dann stellte sie einen Fuß auf die Abdeckplatte und zog sich unbeholfen nach oben. Zitternd stand sie dort, immer noch die Säule mit beiden Armen umklammernd. Um an das Tuch zu kommen, musste sie sich auf die Zehenspitzen stellen und eine Hand emporstrecken. In dem Moment, als sie mit den Fingern das Halstuch berührt hatte, spürte sie einen kräftigen Stoß. Sie torkelte und versuchte krampfhaft wieder Halt zu finden, doch ein zweiter Angriff nahm ihr jede Chance. Sie sah entsetzt in das Antlitz der jungen Frau. Vielleicht war es die Überraschung, in deren Gesicht ein Lächeln gesehen zu haben, jedenfalls kam nur ein kurzer Schrei über ihre Lippen, der ungehört verhallte. Die Angreiferin hörte den dumpfen Aufprall auf den Steinen und beugte sich über die Brüstung. Der Körper ihres Opfers lag verdreht auf dem Boden. Auf Grund des Nebels erkannte sie nicht, ob sich eine Blutlache gebildet hatte. Sie sah jedoch, dass sich Frau Fink bewegte. Nicht besonders stark, doch es signalisierte ihr, dass die sich ins Leben zurückkämpfte. Aufgeregt lief sie, während sie jeweils zwei Stufen auf einmal nahm, die zwei Etagen hinunter.
Als sie die Tür öffnete, schaute sie in die ängstlichen Augen der Erzieherin, die um ihr Leben bettelten. Doch diese Frau hatte ihr schon genug Ärger eingebrockt. Und dem setzte sie jetzt die Krone auf, indem sie sich weigerte, zu sterben. Kurzentschlossen stürzte sie auf sie zu, fasste sie bei den Haaren und riss den Kopf ruckartig nach hinten. Sie hörte die Wirbel knacken und betrachtete mit einem erleichterten Seufzer ihr Werk. Der Tod hatte dieser Frau die Bosheit genommen. Die geöffneten Augen starrten hilfesuchend ihrem Schöpfer entgegen, vor dem sie sicher schon stand, um sich für ihr Leben zu rechtfertigen. Sie genoss den Augenblick einen Moment. Dann drehte sie sich um und rannte ins Haus zurück. Sie würde im Bett liegen, wenn ihre Mitbewohnerinnen sie zum Essen abholten. Später würde sie mit betroffenem Gesicht diesen schrecklichen Unfall bedauern. Genau wie alle anderen, die um die arme Frau Fink herumstehen und die feuchten Spuren der Tat verwischen würden.
*
Zwei Tage später schlich eine Gestalt durch die 20 Kilometer entfernte Stadt. Es war ein junger Mann mit einem schwarzen Kapuzenshirt, das er tief ins Gesicht gezogen hatte. Der nahezu vollständig ausgebildete Vollmond unterstützte das warme Licht der Straßenlaternen. Die milden Frühlingstemperaturen verleiteten den Mann nicht dazu, die Kapuze in den Nacken zu streifen. Sie gab ihm Sicherheit. Sie wahrte seine Intimsphäre. Niemand hatte ihn jemals, ohne diese Kopfbedeckung zu Gesicht bekommen, falls er das Haus verließ. Doch selbst wenn er unbeschwert durchs Leben gehen könnte, heute hätte er dieses Outfit gewählt. Sein Vorhaben sollte im Verborgenen bleiben. Noch war die Nacht still. Der Mann wusste, dass die Singvögel frühestens eine Stunde vor Sonnenaufgang ihre Konzerte anstimmten. Wenn alles gut ginge, würden sie vielleicht seine erfolgreiche Mission mit einem Ständchen belohnen, während er seinen Rückweg anträte.
Er hatte das Villenviertel erreicht. Den Weg zu seinem Ziel hätte er blind beschreiten können. Unzählige Male hatten ihn seine Schritte hier hergeführt, ohne es selbst zu wollen. Ein Motorengeräusch verriet ihm das Nahen einer sehr langsam fahrenden Limousine. Er brauchte sich nicht umsehen, um zu wissen, dass sich ein Streifenwagen näherte. Ohne Hast verbarg er sich hinter einer schulterhohen Hecke, die selbstverständlich picobello gepflegt war und keinerlei Lücken im Bewuchs darbot. Vermutlich erledigte diese Arbeit ein Gärtner, denn diese Leute hatten keine Zeit für derart belanglose Tätigkeiten. Wer in dieser Gegend eine Villa ergattert hatte, war angesehen und oft auch stadtbekannt oder darüber hinaus. In diesem Viertel fuhr die Polizei fast stündlich Streife und das ohne erkennbaren Tourenplan. Für die meisten Hausbesitzer Grund genug, auf eine Alarmanlage zu verzichten. Ein Glücksfall für ihn. Denn Prof. Dr. Leopold Radloff, bei dem er einzubrechen gedachte, verzichtete ebenfalls auf zusätzliche Sicherheit. Den Einbruch hatte er bereits vor langer Zeit geplant, bevor er wusste, was er dort zu suchen hatte. Heute wusste er es. Schon als Jugendlicher hatte er sich einen Abdruck des Sicherheitsschlüssels angefertigt, während der Professor in einem anderen Raum mit seinen Eltern sprach. Es war ihm unverständlich, warum sie ihn ausgerechnet von diesem Mann behandeln ließen, den er wie die Pest hasste. Das war Jahre her. Hoffentlich hatte in der Zwischenzeit niemand das Schloss ausgetauscht. Als die Luft wieder rein war, bog er in die Sackgasse ein, an deren Ende die Villa des Professors lag. Die Außenbeleuchtung war eingeschaltet. Wer einen so exotischen Vorgarten hatte, verspürte offensichtlich den Drang, dass er selbst bei Nacht für jeden zu bewundern sein müsse. Besonders der Elefantenfuß mit seinen riesigen Puscheln und der Blauregen, dessen gewaltiger Stamm in beeindruckender Weise den Eingangsbereich einrahmte, stachen ihm ins Auge. Das bunte Blumenmeer, das der Frühling schon hervorgelockt hatte, war farblich fein abgestimmt. Die Villa selbst strahlte in makellosem Weiß, um zum Bewuchs einen deutlichen Kontrast zu bilden. Die knallig blauen Fensterrahmen drückten vermutlich die Sehnsucht nach dem Meer aus. Doch dafür hatte der Kapuzenmann keinen Blick übrig. Sein Zeitplan war straff. Eine Stunde, dann musste alles Geschichte sein. Der Streifenwagen würde spätestens zu dieser Zeit wieder vorbeifahren. Am Weg, dessen Basaltplatten zum Haus führten, war ein protziges Schild an einer weißen Holzkonstruktion installiert. Professor Dr. Radloff, Humanmedizin stand in großen chrombeschichteten Lettern darauf.
Der Mann sah es sich verächtlich an. Ihm war ein Rätsel, was die Arbeit des Professors mit Humanismus zu schaffen haben sollte. Seine Augen huschten über die Gartenanlage. Jeder Zentimeter Erde war mit weißen und schwarzen Kieseln abgedeckt, je nachdem, was sie zur Geltung bringen sollten. Kein Platz für Pflanzen, die hier nicht hingehörten. Unkraut und Wildwuchs waren nicht willkommen. Er fühlte sich ebenso wie dieses Unkraut, dem hier keine Chance gegeben wurde. Genug der Gefühlsduselei. Seine Aktion duldete keine Verzögerung.
Die Tür mit ihren Glaselementen, die durch kunstvolle Facettenschliffe aufgewertet wurde, nahm seinen Schlüssel widerstandslos in ihrem Schloss auf. Jetzt war alles Routine. Er kannte die Räumlichkeiten im Detail. Kunstgegenstände jeglicher Form schwebten an ihm vorbei. Er registrierte sie unbewusst aus den Augenwinkeln heraus. Sie waren für ihn nicht von Interesse. Zielstrebig bewegte er sich zu den Praxisräumen. Der Schrank mit den Patientenakten stand am gewohnten Platz. Die oberen Schübe waren nicht verschlossen. Während er einige Akten durchblätterte, gelangte er zu der Erkenntnis, dass er hier nicht fündig werden würde. Da er damit gerechnet hatte, dass die prekären Fälle besser gesichert waren, hatte er sich Werkzeug mitgebracht. Den Schrank des Professors hatte er noch vor Augen gehabt, als er sich im Möbelhaus das Modell vorführen ließ. Einen Experten zu finden, der solche Sicherheitsschränke mühelos knacken könnte, war nicht sehr schwer. Die Fähigkeit war ihm leicht zu vermitteln. Ein paar Handgriffe, ein kurzer, kräftiger Schlag, und das Fach sprang auf. Das Geräusch kam ihm intensiver als erwartet vor. Die gläserne Tür zum Praxisraum war nicht dazu geeignet, um die Schallwellen zu dämmen. Instinktiv hielt er die Luft an und lauschte. Er hoffte, dass der Professor einen guten Schlaf und ein schlechtes Gehör hatte. Hastig blätterte er durch die Patientenakten und atmete erleichtert aus, als er auf die gesuchten Namen stieß. Er nahm sie heraus und stopfte sie unter sein Shirt. Ohne das Fach wieder zu schließen, es war ohnehin ersichtlich, dass er aufgebrochen wurde, rannte er durch die Tür. Im Eingangsbereich sah er eine Person im Schlafanzug die Treppe herunterkommen. Er sah nur flüchtig hin, damit sein Gesicht durch die Kapuze verborgen blieb. Es gab jedoch keinen Zweifel, dass er den Professor vor sich hatte. Der Mann lebte schon viele Jahre allein hier. Seine Frau hatte er in ein Pflegeheim einweisen lassen, da ihm die Zeit fehlte, sich selbst um sie zu kümmern. Außerdem war es seinen Patienten nicht zumutbar, hier eine kranke Person erleben zu müssen. Schließlich suchten sie bei ihm Heilung. Womöglich würde der Gedanke aufkommen, dass er hier versagt hätte. Und so löste er dieses Problem mit Geld. Das war immer die sauberste Lösung.
Der Kapuzenmann beschleunigte seine Schritte, doch der Professor zerrte an seinem Ärmel, um ihn aufzuhalten. Instinktiv senkte er den Kopf und rammte ihn auf die Brust des Professors. Der taumelte zurück, stolperte über die unterste Stufe und krachte rückwärts auf die Treppe. Ein kurzer Schmerzensschrei und ein klägliches Stöhnen nährten die Hoffnung, dass sein Opfer diesen Sturz überleben würde. Hastig öffnete er die Tür, orientierte sich in allen Richtungen und verschwand annähernd lautlos in der hell erleuchteten Straße. Er achtete darauf, stets an den etwas höher bepflanzten Grundstücksgrenzen entlangzuschleichen, um sich gegebenenfalls in ihrem Schatten verbergen zu können. Bei Erreichen der ersten Weggabelung hatten ihn immer noch keine Hilfeschreie des gestürzten Professors erreicht. Sorge beschlich ihn. War er vielleicht doch zum Mörder geworden. Als die ersten Vögel ihren fröhlichen Gesang anstimmten, wertete er dies als hoffnungsvolles Zeichen.
*
Pia Liebig hatte im Sprechzimmer Platz genommen. Sie war der Einladung Ihrer Therapeutin, Frau Helene Dorn, gefolgt. Es war Routine, dass alle Schutzbefohlenen des Wohnheimes in regelmäßigen Intervallen zum Gespräch geladen wurden. Auch wenn die meisten Bewohner freiwillig hier lebten, so waren sie doch Patienten. Überwiegend waren es deren Eltern, die den kostspieligen Aufenthalt in dem luxuriösen Heim für betreutes Wohnen finanzierten. Man erwartete eine umfassende fachliche Betreuung und turnusmäßige Berichte zur Entwicklung der Angehörigen.
Pia, eine junge Frau von 24 Jahren, schaute lächelnd durch eine gelbliche Glasscherbe, um den Raum zu analysieren. Als das Skelett in ihr Blickfeld geriet, verfinsterte sich ihr Blick. Sobald sie es als harmlos eingestuft hatte, fand sie zu ihrem Lächeln zurück. Obwohl sie sehr häufig in diesem Büro saß, vollführte sie diese Prozedur jedes Mal. Es war ein Spleen von Pia, ihre Welt, egal ob Mensch, Tier oder Pflanze, durch eine Scherbe zu betrachten. Sie behauptete, dass sich dadurch das Wesen der Dinge offenbart. Sie erkannte augenblicklich, ob etwas gut oder böse, harmlos oder gefährlich war. In ihrer Hosentasche führte sie stets drei bis vier dieser Glasscherben mit sich. Die Kanten hatte sie zuvor an rauen Steinen glattgeschliffen, um Schnittverletzungen zu vermeiden. War ihr erster Blick mit Zweifeln behaftet, holte sie eine zweite Scherbe heraus, um ihr Urteil zu überprüfen.
In Kombination mit ihren weinroten, struppigen Haaren, die nur bis zum Nacken reichten, wirkte sie etwas verrückt. Doch ein Blick in ihre Augen und die sanftmütigen Gesichtszüge überzeugten jeden, dass mit ihr alles in Ordnung war. Es gab sogar erste Nachahmer, die voller Überzeugung behaupteten, durch eine Scherbe nun auch die Menschen erkennen zu können. Sie sahen, was sie hinter der Maske versteckten.
Pia hatte sich angewöhnt, entweder weite Pluder- oder Palazzohosen anzuziehen, damit die Scherben genug Bewegungsfreiheit hätten. Gewöhnlich trug sie lockere Blusen dazu und gelegentlich einen Loopschal. Als Schuhwerk kamen nur Sportschuhe infrage, die einen lautlosen Gang ermöglichten.
Frau Dorn kündigte sich schon von weitem an. Ihre harten Hacken hallten über den Flur. Erwartungsvoll wendete Pia ihren Blick zur Tür.
„Wie immer pünktlich, Pia“, begrüßte sie die junge Frau. „Kannst du das nicht auch den anderen beibringen?“, sagte sie scherzhaft.
„Sie hatten nur Glück, dass ich nichts Wichtigeres vorhatte“, konterte Pia und lächelte ihre Therapeutin an. Erneut hob sie die Scherbe und sah hindurch.
„Werde ich deiner Prüfung standhalten?“
„Sie haben heute Schatten auf der Seele. Sie sollten sie abstreifen. Das macht krank.“
„Fein beobachtet Pia. Leider ist das nicht so einfach. Du weißt, was vor ein paar Tagen geschehen ist.“
„Es ist geschehen. Doch heute ist heute. Die Sonne hat die Schatten längst ausgelöscht. Wo haben Sie ihre her?“
„Einen Menschen zu verlieren, ist nicht angenehm. Sie war eine Kollegin. Es ist tragisch, wegen eines Halstuchs zu sterben.“
„Ich habe sie durch meine Scherbe angesehen. Es war nichts Gutes, was da zum Vorschein kam.“
„Willst du sagen, dass sie den Tod verdient hat?“
„Niemand verdient den Tod. Uns wurde das Leben geschenkt und Geschenke sollte man in Ehren halten. Haben sie es denn verdient, den Schatten dieser unangenehmen Frau weiter mit sich herumzutragen?“
„Meinst du nicht, dass dir die Scherben auch falsche Bilder vermitteln können?“
„Nein. Ich habe mehrere Scherben. Sie sagen die Wahrheit. Sie haben auch Ihre Schatten gezeigt. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht noch mehr Schatten einfangen. Daraus schlüpft das Böse.“
Pia hatte das voller Überzeugung vorgetragen, die von jedem Gesichtsmuskel unterstützt wurde.
*
Frau Dorns Gedanken schweiften ab. Das Mädchen hatte schon immer in den abstrakten Testbildern die unmöglichsten Sachen gesehen. Gelegentlich erkannte sie darin sogar Gefühle. Der Fall Pia Liebig war jedem Arzt, jedem Therapeuten ein Rätsel. Ursprünglich hatte man sie als Autistin eingestuft, die auch ADHS-belastet war. Die Akten aus Kindertagen waren eindeutig. Alle Symptome waren vorhanden. Ihre Konzentrationsfähigkeit war gestört, Unpünktlichkeiten und Trödeln waren dominierend, die Feinmotorik ließ zu wünschen übrig und emotional war sie instabil. Der Zugang zu einem normalen Gefühlsleben war ihr nicht möglich, so dass soziale Kontakte immer mit Schwierigkeiten behaftet waren. Irgendwann gab es einen unerklärlichen Knick zum Besseren, denn diese Krankheit galt als unheilbar. Den Einsatz von Medikamenten lehnte die Familie strikt ab. Doch selbst nach diesen positiven Veränderungen blieb Pia unzuverlässig. Da es nicht absehbar war, dass sie je in einem Beruf Fuß fassen könnte, bezahlten die Angehörigen diesen Heimplatz für betreutes Wohnen. Wohlwissend, dass dies für ihr gesamtes Leben so sein würde.
Das Mädchen hatte sich dahingehend stabilisiert, dass sie eine umfangreiche Gefühlswelt entwickelt hatte und zu sozialen Kontakten fähig war, was nicht ins Krankenbild passte. Dennoch blieb sie unzuverlässig, da spontane Eingebungen, jede vorherige Planung über den Haufen warfen.
Nun saß sie vor ihr. Ein liebenswertes Mädchen, das im Heim anerkannt war. Ihre ganze Art führte dazu, dass sie die Menschen entwaffnen konnte, sei es mit Worten oder einem unschuldigen Lächeln.
Pia sorgte sich um ihre Therapeutin, dass die Last der Schatten sie erdrücken könnte. Sie teilte ihr dies mit. Frau Dorn lächelte sie an.
Das Mädchen fühlte sich zu ihr hingezogen. Sie war schon 63 und wirkte fast wie eine junge Frau. Obwohl sie ergraut war, hatte sie ein nahezu faltenfreies, schmales Gesicht. Ihre Haare hatte sie zu zwei Zöpfen geflochten, was den aufkommenden Eindruck des Alters verscheuchte. Manchmal wünschte sie sich, Frau Dorn käme in ihr Zimmer und würde sie in den Schlaf singen. Die eigene Mutter hatte sich das Leben genommen, als Pia 12 Jahre alt war. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass sie der Wunsch nach mütterlichen Kontakten gelegentlich hinwegtrug. Die Stimme ihrer Therapeutin riss sie aus ihren Tagträumen. Frau Dorn saß nicht mehr auf ihrem Bett, sondern auf dem Bürostuhl im Sprechzimmer.
„Mal davon abgesehen, dass du mir meine Schatten nehmen möchtest, was hättest du Frau Fink gewünscht?“
„Dass sie etwas realistischer ist“, entgegnete Pia. „Sie hatte sich eingebildet, ein Schmetterling zu sein und zu spät bemerkt, dass sie nicht fliegen kann.“
„Es war ein Unfall, Pia. Sie hatte nicht versucht zu fliegen. Ihr Seidenschal war vom Wind weggetragen worden und an der Lampe hängengeblieben. Beim Versuch, ihn zu fassen ist sie abgestürzt.“
„Wer zu sehr an seinem Besitz hängt, kann schnell mal vergessen, dass man nicht fliegen kann. Sie würde noch leben, wenn ihr das Tuch egal gewesen wäre.“
„Du meinst sie hätte die Gefahr besser eingeschätzt, wenn der Schal nicht diese Bedeutung für sie gehabt hätte?“
„Schmetterlinge können fliegen, weil sie nichts mit sich herumschleppen. Darum sind sie so leicht und der Wind trägt sie überall hin. Sie müssen nur ihre Segel richtig setzen. Ich brauche auch nichts. Manchmal lasse ich mich vom Wind treiben. Wo ich hin möchte, werde ich immer weich landen.“
„Also leidest du nicht unter diesem schrecklichen Unfall?“
„Unter welchem Unfall? Frau Fink ist an ihrer Dummheit gestorben. Sie wird daraus gelernt haben.“
Es war offensichtlich, dass es sinnlos wäre, das Gespräch weiter auszudehnen. Erfreulich war, dass dieses Ereignis keine Psychose bei dem Mädchen auslösen würde. Pia ruhte in sich selbst. Es hätte sie gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Das Mädchen war in ihrem Kokon sicher. Man erwartete vom Fachpersonal, dass alle Gefahren von ihren Schützlingen ferngehalten werden. Bei ihrem nächsten Termin sah das schon kritischer aus. Ida Stuwe war ein komplett anderer Fall. In ihren Augen zeigte die Frau schizophrene Krankheitssymptome, die ihre Eltern nicht wahrhaben wollten. Die Entwicklung einer Angstpsychose wäre bei ihr nicht auszuschließen.
„Dann danke ich dir für deine Zeit, Pia. Bleib schön vorsichtig und fliege uns nicht davon.“
„Keine Sorge, ich werde immer zu ihnen zurückfinden.“
Pia verabschiedete sich lächelnd mit einem kräftigen Händedruck und verließ den Raum. Auf dem Flur wartete Ida. Augenblicklich erstarb Pias Freundlichkeit. Sie hatte Ida schon oft durch die Scherben betrachtet. Welche davon sie auch verwendet hatte, es versetzte sie in Angst, was sie dann sah.
„Na du Freak. Hat dir die Dorn deine Hirngespinste ausgetrieben?“, fragte Ida mit voller Verachtung.
Pia starrte sie an. Sie war nur ein paar Jahre älter, wirkte aber schon wie eine alternde Frau. Ihre strähnigen, ungewaschenen Haare verstärkten diesen Eindruck. Ohne auf sie zu reagieren, rannte Pia davon. Sie fühlte sich am wohlsten, wenn ein möglichst großer Abstand zwischen ihnen bestand.
Kapitel 2
Der Streifenwagen parkte direkt vor der Villa des Professors Radloff. Die Polizisten betrachteten ehrfurchtsvoll den Vorgarten mit all seinen seltenen Pflanzen. Sie kannten kaum eine davon und fühlten sich in eine andere Welt versetzt. Beide waren sich einig, dass der Mann hierfür einen sündhaft teuren Gartenarchitekten engagiert haben musste. Vermutlich wird der mehr gekostet haben, als sie zusammen in einem Jahr verdienen. Zaghaft beschritten sie den fast steril wirkenden Natursteinweg, der zur Haustür führte. Einbruchspuren waren nicht zu erkennen. Sie klingelten. Den Professor kannten sie aus einigen Pressemitteilungen, die ihn als einen der führenden Genforscher auswiesen. Bei der Herfahrt hatten sie schon gewitzelt, ob sie sich auf einen genmanipulierten Kampfhund einstellen sollten. Jetzt, da sie die Schritte des nahenden Professors hörten, spürten sie doch ein unwohles Gefühl in der Magengegend. Durch die Facettenscheiben zeichnete sich ein verzerrtes Bild des alten Mannes ab. Ihnen waren Fotos bekannt, auf denen er immer schnittig und herrisch aussah. Davon war nicht mehr viel übrig. Er wirkte wesentlich älter und das Weiß der Haare hatte inzwischen die dunklen Partien fast vollständig verdrängt. Dennoch stand eine gepflegte Erscheinung in sportlicher Kleidung vor ihnen, die auf das Preisschild verzichten konnte. Selbst das ungeübte Auge erkannte, dass nur edelste Stoffe diesen Mann einhüllten. Sein Auftreten stellte von Anfang an klar, dass er etwas zu sagen hatte, mehr als seine Besucher.
„Da sind sie ja endlich. Ich hatte bereits vor einer Stunde angerufen“, maulte er.
„Wir waren gerade im Einsatz, als wir informiert wurden. Wir mussten den Fall erst abschließen“, rechtfertigten sie sich.
Radloff brabbelte etwas in seinen Vollbart, was sich anhörte wie „Sie sind ja nie da, wenn man sie braucht“ und lief voraus.
„Folgen sie mir. Ich zeige Ihnen alles.“
„Vielleicht sollten wir erst mit der Spurensuche an der Einbruchstelle beginnen. Ist der Täter durch ein Fenster eingedrungen?“
„Nein. Durch diese Tür.“
„Stand sie offen?“
„Gott bewahre. Der Kerl muss einen Schlüssel gehabt haben. Weiß der Teufel, woher.“
„Wer besitzt alles einen Schlüssel zu ihrem Haus?“
„Niemand.“
„Und ihre Reserveschlüssel? Haben Sie schon nachgeschaut?“
„Halten sie mich für senil?“
„Sie haben den Mann gesehen? Ist auszuschließen, dass es eine Frau war?“
„Mein Gott, was schickt man mir hier für Leute. Sie bezweifeln, dass ich Männlein und Weiblein unterscheiden kann? Haben sie noch alle beieinander?“
„Einbrecher tarnen sich ja gern. Und nicht immer ist eindeutig, ob die Statur zu einem bestimmten Geschlecht passt. Sie haben sein Gesicht gesehen?“
„Nein. Er hatte eine Kapuze auf, die er tief herunter gezogen hatte. Als er mich angriff, hielt er den Kopf gesenkt. Und stieß ihn gegen meinen Brustkorb. Hab mir einige Prellungen zugezogen. Ich kann mir aber denken, um wen es sich handelt.“
„Wie das?“
„Kommen Sie mit, dann wird es Ihnen klar.“
Sie folgten ihm durch das Foyer, das mit Kunstschätzen übersät war, und konnten diesen Überfluss gar nicht fassen.
„Hat er Wertgegenstände gestohlen?“
„Nein. Der Kerl hatte es nur auf ein paar Akten abgesehen.“
Radloff zog den unteren Schub auf.
„Wir würden Sie bitten, nichts zu verändern. Das muss sich erst die Spurensicherung ansehen.“
„Das können Sie sich sparen. Er hat Handschuhe getragen. Außerdem gehe ich davon aus, dass er seine eigene Akte ebenfalls mitgehen ließ.“
„Das werden wir überprüfen.“
„Hab ich schon. Es fehlen die Akten von Pia Liebig, Ernst Schäler und Paul Weber.“
„Sie haben schon die Schränke durchsucht?“
„Bevor ich Sie rufe, muss ich doch klären, was fehlt. Die Frage hätten Sie mir doch sowieso gestellt.“
„Wir dachten, Sie haben gleich nach dem Einbruch angerufen?“
„Und darum sind Sie so überaus schnell gekommen, um den Täter noch vor Ort zu stellen. Richtig? Wollen Sie mich verarschen? Sie lassen sich alle Zeit der Welt, aber dem Opfer gestehen Sie keine Zeit zu?“
„Wann fand der Einbruch denn statt?“
„Weiß nicht mehr. So gegen 5 Uhr. Oder etwas früher.“
„Wir haben es jetzt 10 Uhr.“
„Der Einbruch war gestern gegen 5 Uhr.“
„Sie haben einen ganzen Tag gewartet?“
„Ich musste meine Verletzungen behandeln. Außerdem wollte ich sicher sein, was entwendet wurde und welche Auswirkungen das haben kann. Die drei Fälle habe ich zuerst auf dem Computer durchleuchtet.“
„Worum geht es dabei?“
„Das geht Sie gar nichts an. Ist geheim.“
„Wir können Ihnen nur helfen, wenn wir in alles eingeweiht sind.“
„Würden Sie das dem Verteidigungsminister auch sagen? Wie naiv sind Sie eigentlich? Hier haben Sie die zwei Adressen, wo die Patienten zur damaligen Zeit gewohnt haben. Schreiben Sie die zur Fahndung aus, wenn nötig.“
„So viel kann ich Ihnen schon mal sagen, dass wegen eines so geringfügigen Deliktes keine Fahndung ausgelöst wird. Es ist nichts Wertvolles gestohlen oder beschädigt worden. Wir werden die Verdächtigen aufsuchen und alles daran setzen, sie zu finden, falls sie ihren Wohnort gewechselt haben. Aber ohne Einsatz der Spurensicherung werden wir dem Täter unter Umständen nichts nachweisen können, zumal Sie ihn nicht erkannt haben.“
„Sind Sie geistesgestört? Es wurde nichts von Wert gestohlen? Meine Akten sind außerordentlich wertvoll. Nur, weil Ihr Spatzenhirn das nicht zu fassen vermag, können Sie den Fall nicht bagatellisieren.“
„Überlegen Sie, was Sie sagen, Professor Radloff. Zwingen Sie mich nicht, wegen Beamtenbeleidigung gegen Sie vorzugehen.“
„Herrlich. Unser Freund und Helfer. Jetzt wird auch noch das Opfer zum Täter gemacht. Da kann ich doch meine gezahlten Steuergelder gleich auf den Müll werfen.“
„Ich fasse mal kurz zusammen“, begann der Polizist, der bisher allein das Wort ergriffen hatte. „Sie möchten keine Spurensicherung im Haus haben, Sie wollen Ihre Unterlagen nicht offen legen, es gab, außer der Beschädigung des Aktenschrankes, keinen materiellen Schaden und sie vermuten nur, wer der Eindringling sein könnte. Sie, als Mann der Logik, werden verstehen, dass wir unter diesen Umständen, ihren Verdacht prüfen können, aber umfangreiche Ermittlungen niemals rechtfertigen können. Es sei denn, Sie ändern Ihre Meinung und kooperieren.“
„Verstehe ich das richtig? Sie wollen mich erpressen? Verschwinden Sie aus meinem Haus! Sie werden noch bereuen, so respektlos hier aufgetreten zu sein. Das wird für Sie Konsequenzen haben. Schauen Sie sich schon mal nach einem neuen Job um. Ich ziehe die Anzeige hiermit zurück und regele die Angelegenheit selbst.“
„So einfach ist das nicht, Herr Radloff.“
„Professor Radloff, bitte! Sie werden sehen, wie einfach das ist.“
„Diese Anzeige ist registriert, Herr Professor Radloff. Und was aktenkundig ist, bleibt auch aktenkundig. Wir werden auf jeden Fall die Verdächtigen aufsuchen. Guten Tag.“
Er wandte sich ab, um den Tatort zu verlassen.
„So einfach entwischen Sie mir nicht. Sie sagen mir sofort Ihren Namen!“
„Aber gerne. Ich bin Polizeimeister Gernold Wiesel.“
„Sie waren Polizeimeister“, korrigierte Radloff.
*
Aufgebracht liefen die beiden Polizisten zum Streifenwagen, während der Professor sie durch ein Fenster beobachtete.
„Was ist das für ein arrogantes Arschloch“, schimpfte Gernold Wiesel vor sich hin.
„Du solltest ihn nicht unterschätzen, Gernold“, bemerkte sein Partner.
„Da oben werden Strippen gezogen, von denen wir uns nichts vorstellen können.“
„Das ist nicht dein Ernst, Dirk. Hältst du unseren Chef für korrupt?“
„Vielleicht nicht korrupt, aber vorsichtig, womöglich auch ängstlich.“
„Ich habe das ungute Gefühl, dass hier etwas vertuscht werden soll. Was für einen Grund sollte Radloff haben, nicht zu kooperieren? Wenn er schon den Vergleich mit dem Verteidigungsminister strapaziert, hat er indirekt zugegeben, dass er was zu verheimlichen hat. Lass uns die Personen aufsuchen, deren Akten verschwunden sind, bevor sie mich von dem Fall abziehen.“
„Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Das bringt die da oben noch mehr gegen dich auf, falls Radloff die Macht besitzt, die er angedeutet hat.“
„Wir sind offiziell im Einsatz und verfolgen eine Anzeige. Noch hat mir niemand verboten, dem Fall weiter nachzugehen. Es ist sogar meine Pflicht. Wenn es dir zu heiß ist, ziehe ich es alleine durch.“
„Ist ja gut. Wir sind Partner.“
In der Zentrale erfuhren sie, dass es zwei Ernst Schäler im Ort gab. Glücklicherweise war einer mit größter Wahrscheinlichkeit auszuschließen, da er schon im Greisenalter war. Nachdem er mitgeteilt hatte, dass sie zur Klärung eines Sachverhaltes den Mann besuchen würden, hängte Dirk das Lautsprechermikro des Funkgerätes wieder in die Halterung und tippte die durchgegebene Adresse ins Navi.
Vierzig Minuten später hielten Sie vor dem Altbaublock in Plattenbauweise, in dem Ernst Schäler, zusammen mit seinen Eltern wohnte.
Der Zustand des Gebäudes lud nicht gerade zum Wohnen ein. Kein Mieter schien sich für den Müll zu interessieren, den man achtlos auf den schmalen, bepflanzten Streifen entlang der Hauswand warf. Ein Großteil der Pflanzen war vertrocknet, oder niedergetreten. Das Klingeltableau, mit einem Lautsprecher für die Gegensprechanlage, war zerkratzt und beschmiert. Die meisten Mieter hatten hinter den vergilbten Folien ihre Namen in lieblos hingekritzelten Buchstaben hinterlassen. Ein paar wenige hatten die ausgedruckte Form gewählt. So auch die Schälers.
Auf das Klingelzeichen meldete sich eine knarrige Herrenstimme.
„Was liegt an?“
„Wir möchten Ernst Schäler ein paar Fragen stellen. Ist er zuhause?“
Der Summer ertönte, ohne dass nachgefragt wurde. Einen Fahrstuhl gab es nicht. Sie quälten sich durch das muffig riechende Treppenhaus bis in die vierte Etage. Vor der Tür lag ein abgewetzter Abtreter mit dem Spruch: „Herzlich willkommen“. Dieser erschien in großen Buchstaben. „wäre übertrieben“ stand klein darunter.
Gerold beabsichtigte gerade den Klingelknopf zu betätigen, als die Tür aufgerissen wurde. Ein dürres Männlein in Jogginghose und Turnhemd schaute sie überrascht an, als er die Uniform registrierte. Gleich darauf änderte er seinen Blick auf gelangweilt.
Gernold zückte seinen Dienstausweis.
„Ich bin Polizeimeister Gernold Wiesel und das ist mein Kollege …“
„Wie kann man sein Kind Gernold nennen?“, nuschelte er.
„Kommen Sie rein. Mein Sohn ist gerade aufgestanden. Hat er was ausgefressen?“
„Nein. Nur eine Routinebefragung. Vielleicht kann er uns in einem Fall weiterhelfen.“
„Ist ein kluges Kerlchen. Bestimmt kann er das. Auch wenn er nur als Nachtwächter arbeitet. Er hätte studieren können. Ich habe immer gesagt …“
„Danke. Wir möchten ihn gern allein sprechen, haben wenig Zeit.“
Verärgert, weil er unterbrochen wurde, riss er die Tür zum Zimmer seines Sohnes auf und rief teilnahmslos: „Du hast Besuch.“
„Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du anklopfen sollst?“, schimpfte der.
Als er die Polizisten sah, nahm er Haltung an und zupfte an seinem Schlafanzug, um ein angemessenes Bild abzugeben. Hinter ihm sahen sie das ungemachte Bett. Der junge Mann war von stattlicher Statur. Sein breites Kreuz endete in einem Stiernacken und die Muskeln zeigten an, dass sein Nachtzeug bald zu klein sein würde.
Dennoch vervollständigte er das übliche Klischeebild nicht durch eine Glatze, sondern durch eine halblange Frisur. Auch seine Größe, die nicht mehr als 1,70 m ausmachte, sprach gegen das Bild eines Bodybuilders. Sein Gesicht war bartlos.
Ein paar Trainingsgeräte bereicherten das Zimmer. Ansonsten waren die Möbel im Raum akkurat ausgerichtet, ebenso, wie die Utensilien auf seinem Schreibtisch vor dem Computerschirm. Ein angenehmer Kontrast zur unordentlichen Wohnung der Eltern. Die Mutter hatte den Kopf neugierig in den Flur geschoben und zog ihn gleich wieder zurück, als sie die Uniformen erkannte.
„Entschuldigen Sie die Unordnung. Ich hatte geschlafen. Um sechs war Schichtende und um sieben bin ich erst ins Bett gekommen.“
„Dann sind Sie schon so früh auf den Beinen?“
„Habe das Klingeln gehört.“
„Entschuldigung, dass wir Sie geweckt haben. Sollen wir später wiederkommen?“
„Nicht nötig. Werde sowieso nicht mehr schlafen können, wenn die Polizei hier war.“
„Wieso das? Haben Sie etwas zu verbergen?“
„Ich verberge niemals etwas. Es ist nur so, dass es eine Weile braucht, wenn die Ordnung gestört ist, um alles wieder neu zu strukturieren.“
„Das verstehe ich. Wir wollen auch nicht lange stören.“
Gernold sah kurz zum Vater, bis der verstand und sich zurückzog. Sie schlossen die Tür und sprachen leise weiter.
„Bei Professor Dr. Radloff ist eingebrochen worden. Es wurden einige Krankenakten gestohlen. Unter anderem auch Ihre. Können Sie sich vorstellen, was den Einbrecher daran interessiert haben könnte?“
„Wer war der Einbrecher? Ein Patient?“
„Wie kommen Sie darauf? Warum sollte ein Patient die Akten stehlen?“
„Wenn ein Patient die gleichen Symptome wie ich hätte, würde mich interessieren, wie ihn der Professor behandelt hat. Besonders, wenn dort bessere Erfolge erzielt wurden.“
„War Ihre Behandlung denn erfolgreicher als bei anderen?“
„Ich hatte eine ausgeprägte Form von Autismus. Der Professor hat ein Wunder vollbracht. Man vertraut mir den Job eines Nachtwächters in einem großen Speditionsunternehmen an. Wird alles durch modernste Technik überwacht. Davon hatten wir nie zu träumen gewagt. Ich helfe sogar gelegentlich bei Computerproblemen aus.“
„Hatte der Professor nur Patienten mit Ihrem Krankheitsbild?“
„Er behandelte alles Mögliche. Viele mit Autismus oder ADHS, aber auch mit beidem. Bis hin zur Schizophrenie erstreckte sich sein Betätigungsfeld.“
„Ich hatte gelesen, dass die Krankheiten eigentlich nicht heilbar sind.“
„Das ist richtig. Aber dem Professor gelang es, die Symphtome so weit abzumildern, dass ich ein selbständiges Leben führen kann.“
„Wissen Sie, wodurch er das erreicht hat?“
„Nein. Ich will es auch nicht wissen. So wie es ist, ist es gut.“
„Warum wohnen Sie dann noch bei Ihren Eltern. Sie sagten, dass sie selbständig leben könnten.“
„Es ist die Angst, dass meine Macken zurückkehren könnten. Außerdem verdient man als Nachtwächter nicht so viel, dass man sich davon eine eigene Wohnung leisten könnte. Sie wissen ja, wie die Preise explodieren.“
„Gibt es Patienten, bei denen die Behandlung schief gegangen ist und sich der Zustand verschlechtert hat?“
„Dazu kann ich nichts sagen. Die meisten ziehen sich nach der Behandlung zurück. Es gibt keine Gemeinschaft von Ehemaligen, falls Sie das erhofft hatten. Wessen Akten wurden denn gestohlen?“
„Tut uns leid. Wir dürfen Ihnen keine Details zu den Ermittlungen mitteilen.“
„Okay. Ich sage Ihnen jetzt ein paar Namen. Sie müssen nichts sagen, nur ein Nicken andeuten. Fritz Wussow, Julio Gonzales, Paul Weber, Hanna Herz, Julia Sturm, Pia Liebig, Chantal Schmidt, Gerd Hunkemüller.“
Gernold und Dirk hatten mit keiner Wimper gezuckt. Zumindest bildeten sie es sich ein.
„Neben meiner Akte entwendete man also die von Paul Weber und von Pia Liebig.“
Seine Augenbrauen zogen sich zusammen, als ob er angestrengt nachdenken würde.
„Das können wir nicht bestätigen“, versicherten beide im Gleichklang.
„Das müssen Sie nicht. Ich weiß es.“
„Würde es einen Sinn machen, ausgerechnet diese Akten auszuwählen?“
„Kann ich nicht sagen. Wir drei hatten eins gemeinsam. Wir litten alle als Kind an Autismus in Kombination mit ADHS.“
„Sind alle …“
„Da kann ich mich nur wiederholen. Wir pflegen keine Kontakte untereinander. Wem inwieweit geholfen werden konnte, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich kenne die meisten nur von den Begegnungen im Wartezimmer.“
Mehr schien der junge Mann nicht offenbaren zu wollen. Oder wusste er tatsächlich nichts?
Sie bedankten und verabschiedeten sich. Ernst bildete erneut seine Denkerfalten aus, während ihnen sein undeutbarer Blick folgte.
Als sie wieder im Hausflur waren, ließen sie die Ereignisse erst mal sacken.
„Hast du ihm zugenickt?“, fragte Gernold.
„Wo denkst du hin? Vielleicht hast du mit den Augen geblinzelt.“
„Auf keinen Fall. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder er beherrscht die Kunst Körpersprache zu lesen, so dass er vielleicht Änderungen der Haut oder den Durchfluss in den Adern registriert, oder er hat die Akten entwendet. Doch lass uns erst noch zu diesem Paul Weber fahren, bevor wir voreilige Schlüsse ziehen.“
*
Der junge Mann vor ihm, war extrem angespannt. Nervös kaute der an seiner Unterlippe, als wäre er sich nicht sicher, ob er sein großes Geheimnis vor ihm ausbreiten solle. Claudius Fisell hatte schon viele Anrufe von unterschiedlichsten Informanten erhalten, die ihm die größte Story aller Zeiten in Aussicht stellten. Das war nicht verwunderlich, arbeitete er doch als überaus erfolgreicher Reporter an einer der bekanntesten Tageszeitungen der Region. Normalerweise hätte er, bei den dürftigen Informationsschnipseln, einem Treffen nicht zugestimmt. Seine Zeit war wahrlich knapp bemessen. Des Öfteren beschwerte sich seine Freundin, dass sie kein richtiges Privatleben hätten. Doch dieser Mann erzeugte bei dem Telefonat eine derart aufgeladene Stimmung, dass sie sich augenblicklich auf ihn übertragen hatte. Hinzu kam, dass er keinerlei finanzielle Forderungen an ihn stellte, was absolut ungewöhnlich war. Der Anrufer schlug das Redaktionsbüro als Treffpunkt vor, doch Claudius bevorzugte eine öffentlich einsehbare Lokalität. Er hasste es, wenn seine Kollegen von seinen Themen Wind bekamen, bevor sie ausgegoren waren. Ein Café in der Flaniermeile der Stadt hatte sein Informant abgelehnt. Er würde sich nur mit ihm treffen, wenn sie von neugierigen Blicken verschont blieben. Die kleine Kneipe lag in einer Seitenstraße. Eine Gegend, in die er sich nie verirrte. Bereits als er den Fuß in die Gasse setzte, fühlte er sich in einen Edgar-Wallace-Film versetzt, was ihm einen Schauer über den Rücken laufen ließ. Die Dunkelheit beherrschte den schmalen Weg. Eine einzige Laterne, über dem Eingang zur Kneipe, spendete ein warmes Licht, das unruhige Schatten warf. Die Fahne eines Fußballfans, ein quietschendes Werbeschild eines Schuhmachers, und Pflanzen in Balkonkästen, die mit dem Wind spielten, sorgten dafür, dass der Lichtschein der Lampe keine Ruhe fand. Einen kleinen Lichtteppich, der aus dem Fenster der Kneipe fiel und ungestört wirken durfte, könnte man als Einladung in eine sichere Zuflucht auffassen. Wenn jedoch die Erwartung von etwas Ungewöhnlichem durch das Hirn schlich, wandelte sich der Eindruck in etwas Bedrohliches. Die Erinnerung, dass er von dieser Bedrohung lebte, sie offen legte und sich seit Jahren mit ihr in friedlicher Koexistenz befand, vertrieb alle Zweifel. Dies war nicht London, es gab keinen Killer, der die Stadt unsicher machte und ihn hatte niemand einzuschüchtern versucht. Wieso dann diese für ihn untypischen Anwandlungen? Je näher er seinem Ziel kam, um so mehr Farbe gaben die alten Mauern preis. Die Farben des Todes verzogen sich, als er den schweren metallenen Türdrücker hinunterdrückte. Seine abgegriffenen Zonen präsentierten das jungfräuliche Messing, das einmal das gesamte Prachtstück geziert hatte. Dieser Fakt signalisierte, dass die Kneipe keinen Mangel an Gästen kannte.
Beim Öffnen schlug ihm ein beachtlicher Geräuschpegel entgegen, der von angeregten Gesprächen und Gelächter dominiert wurde. Die rauchgeschwängerte Luft ließ glücklicherweise einen Blick auf die rustikale Einrichtung zu, an denen dicht gedrängt fast nur Kerle saßen. Ein kleiner Tisch, neben dem Zugang zu den Toiletten, war sein Ziel. Hier saß der Mann, wie angekündigt, in schwarzem Kapuzenshirt, das er über den Kopf gezogen hatte. Er saß mit dem Rücken zum Saal, so dass ihn niemand erkennen konnte. Zügig schritt Claudius aus und setzte sich wortlos auf den gegenüberliegenden Platz, so dass er die Gäste im Blick hatte. Der Mann schaute kurz auf und senkte den Kopf dann wieder.
Claudius erschauderte. Obwohl das Gesicht seines Gegenübers im Schatten lag, offenbarte sich ihm der Grund für dessen Lichtscheuheit. Entzündungen, Flechten und Ausschläge ließen wenig Platz für gesunde Haut.
„Hallo. Ich bin Claudius Fisell. Mit wem habe ich es zu tun?“
Pause. Der junge Mann schien sich zunächst zu sammeln. Erst danach sah er ihn an. Wache und dennoch leidende Augen.
„Ich möchte meine Identität nicht preisgeben.“
„Man wird mich nach meinen Quellen fragen. Was haben Sie anzubieten?“
Der Kapuzenmann musterte seinen Tischgenossen, als wolle er sich vergewissern, ob dies der richtige Mann wäre, um sein Vorhaben voranzubringen. Er schätzte ihn Mitte dreißig. Seine runde Brille, mit Metallrand und makellos sauberen Gläsern, verriet den Intellektuellen. Er hatte volles strohblondes Haar, das er zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte, und ein pausbäckiges Wohlstandsgesicht. Sein taubenblauer Anzug ließ durch das geöffnete Jackett ein veilchenblaues Hemd erkennen. Vielleicht etwas gewagt. Er engte sich nicht durch eine Krawatte ein, so dass er einigermaßen leger wirkte. Kurzanalyse: selbstbewusst, herausfordernd abgeklärt. War das die Mischung, die ihm dienlich wäre? Wenn er sein eigenes Erscheinungsbild dagegen setzte, lagen Welten dazwischen. Unscheinbar, unsicher, gehemmt. So würde er sich beschreiben. Niemand würde ihm zuhören, geschweige denn ihn ernst nehmen. Claudius Fisell war die Stimme, die die volle Aufmerksamkeit einforderte und auch bekam. Ihr sonorer Klang hatte ihn sofort gefesselt.
„Hier haben Sie die Quelle.“
Er legte einen Aktenordner auf den Tisch. Claudius reagierte nicht. Er sah sich in der Kneipe um, ob irgendjemand Interesse an ihnen zeigte. Die Kellnerin kam ins Blickfeld und steuerte auf sie zu.
„Noch ein Bier?“, fragte sie den Kapuzenmann, der sich krampfhaft an seinem fast leeren Glas festhielt.
„Nein, danke“, antwortete er, ohne sie anzusehen. So entging ihm, dass sie genervt die Augen verdrehte.
„Und Sie?“
Mit angespanntem Mund starrte sie erwartungsvoll auf Claudius.
„Ich brauche nichts, danke.“
Er lächelte sie schuldbewusst an.
„Junger Mann. Wir sind hier nicht in einer Bahnhofshalle. Sie können noch so lange warten, ihr Zug wird nicht kommen. Stattdessen nehmen Sie einem Gast, der hier beköstigt werden möchte, einen Platz weg.“
„Also gut. Bringen Sie mir ein stilles Wasser.“
„Wir sind auch kein Bauernhof mit Tränke. Vertragen Ihre Geschmacksknospen auch normale Kost?“
Sie bemühte sich um ein möglichst abfälliges Gesicht, um zu zeigen, was sie von so feinen Pinkeln hielt.
„Wäre ein Apfelsaft für Sie in Ordnung?“
„Natürlich. Wenn es Ihr Wunsch ist. Soll ich ihn einpacken, oder haben Sie noch Zeit, ihn zu trinken?“
„Sie können mir das Getränk auch schicken lassen. Soll ich Ihnen meine Adresse aufschreiben?“
Schnippisch zog sie ab, ohne darauf zu reagieren.
„Was ist das?“, wandte sich Claudius an sein Gegenüber.
„Eine Krankenakte.“
„Ich bin kein Gutachter.“
„Schauen Sie hinein. Wenn ich es verstanden habe, werden sie es vermutlich auch hinkriegen. Es geht um Genmanipulationen am Menschen. Soweit ich weiß, ist das verboten, oder?“
„Forschungen dazu sind keineswegs verboten.“
„Und wenn es sich um Routine in einer Arztpraxis handelt? Diese Akte dokumentiert den Fall eines Mädchens, das an Autismus litt. Sie war normale Patientin. Kein Forschungsobjekt, das von oben abgesegnet wurde.“
Claudius nahm die Akte und blätterte darin.
„Pia Liebig. Kennen Sie die Frau?“
„Das ist nicht von Bedeutung. Es gab noch mehr Fälle.“
„Sind Sie einer davon?“
War klar, dass der Kerl eins und eins zusammenzählen konnte. Damit hatte er gerechnet.
„Es geht nicht um meinen Fall. Ich möchte den Mann zur Strecke bringen. Er soll nicht noch mehr Schaden anrichten.“
„Welchen Schaden hat Frau Liebig dabei genommen?“
„Das kann ich nicht sagen. Lesen Sie die Akte. Darin steht, dass sie angeblich vom Autismus geheilt wurde, jedoch zu Aggressionen neigt, sobald sie Unrecht ertragen muss.“
„Das ist nichts Ungewöhnliches. Viele reagieren aggressiv, wenn man sie ungerecht behandelt.“
„Vor ein paar Tagen gab es einen tödlichen Unfall in dem alten Gutshaus, wo man sich für betreutes Wohnen einkaufen kann. Ich bin mir sicher, dass es das Werk dieser Pia Liebig war.“
„Haben Sie Beweise?“
„Zum Beispiel diese Akte.“
„Warum engagieren Sie keine Detektei?“
„Leider habe ich nicht genug Geld. Sonst hätte ich es getan.“
„Und wieso sollte der Fall unsere Zeitung interessieren?“
„Ein Skandal im Gesundheitswesen, gepaart mit einem Mord sollte jedes Blatt interessieren. Besonders unter dem Gesichtspunkt, dass wir vielleicht nur die Spitze vom Eisberg sehen, würde uns jedes Zögern mitschuldig machen.“
Die Kellnerin knallte den Apfelsaft auf den Tisch, so dass er überschwappte. Die Akte bekam auch ihren Anteil ab.
Claudius schickte ihr einen Blick, der ihr einen Schrecken einjagte. Sie quälte sich ein „Entschuldigung“ heraus und machte abrupt auf dem Absatz kehrt.
„Es kann sein, junger Mann, dass es eine Geschichte wird, die uns das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ebenso liegt es im Bereich des Möglichen, dass es nur eine Menge heißer Luft ist.“
Der Kapuzenmann war enttäuscht. Zornig griff er zur Akte und sprang auf.
„Wenn Sie nicht interessiert sind, werden es andere sein. Vielleicht macht es meine Geschichte wahrscheinlicher, wenn ich sie für viel Geld anbiete. Ich habe mich in Ihnen getäuscht. Habe mir tatsächlich eingebildet, dass ein seriöser Journalist dem nachgehen muss. Es liegt in seiner Verantwortung, Zweifel daran auszuräumen.“
„Warten Sie“, rief ihm Claudius nach. „Ich habe nicht NEIN gesagt. Setzen Sie sich bitte wieder.“
Zögernd stand er am Tisch.
„Folgender Vorschlag: Ich lese mir die Akte in Ruhe durch, mache ein paar Recherchen und gebe sie Ihnen zurück, falls sich die Vorwürfe als haltlos erweisen. Haben wir einen Deal?“
„Okay. Aber schieben Sie es nicht auf die lange Bank.“
Er reichte ihm die Akte, ohne sich zu setzen.
„Wie kann ich Sie erreichen, wenn ich Fragen habe?“, fragte Claudius.
„Ich rufe Sie ein Mal die Woche in der Redaktion an.“
Claudius übergab ihm seine Karte.
„Hier haben Sie meine Durchwahl. Nicht, dass Sie mir die gesamte Redaktion aufschrecken. Ich bestehe aber darauf, dass Sie mir auch ihre Nummer geben. Nur falls ich Fragen habe und nicht weiter komme.“
„So läuft das nicht. Wenn Sie wollen, könnte ich auch zweimal in der Woche anrufen, falls Ihnen das weiterhilft.“
Claudius lehnte dankend ab.
Der Kapuzenmann schritt hinaus in die Dunkelheit. Sein unsteter Blick tastete konzentriert die Umgebung ab. Dennoch bemerkte er die Person nicht, die bei seinem Erscheinen im Schatten eines zurückgesetzten Hauseingangs verschwand.
Kapitel 3
Die letzten Gespräche hatte Frau Dorn am späten Nachmittag abgeschlossen. Der Tod Frau Finks hatte die Bewohnerinnen und Bewohner des Heims in unterschiedlichster Weise berührt. Einige müssten, bezüglich dieses Themas, weiter betreut werden. Im Großen und Ganzen war aber Ruhe eingekehrt. Die Untersuchungen waren eingestellt und sie konnte sich wieder ausschließlich ihrer Arbeit widmen. Entspannt schweifte ihr Blick über ihre Schützlinge, die sich zum Mittagessen versammelt hatten. Es waren immer die Gleichen, die sich zueinander hingezogen fühlten. Seltsamerweise gab es keine durchmischten Gruppen. Die jungen Frauen und Männer schienen sich zu meiden. Sie schob es ihren Krankheiten zu, die eine strenge Ordnung einforderten. Viele der Patienten wurden von Professor Radloff vermittelt. Sie wusste, dass er sich vorrangig dem Kampf gegen Autismus und ADHS verschrieben hatte. Unter ihnen gab es Fälle, bei denen nicht vorstellbar war, dass sie von dieser Krankheit beherrscht worden waren. Einige der Symptome waren nur noch in abgeschwächter Form erkennbar, andere untypische kamen hinzu. Doch sämtliche Schützlinge hatten eines gemeinsam. Sie würden ein normales Leben mit allen Pflichten und Rechten nicht bewältigen können.
Pia hatte den sanftmütigen Kern um sich geschart. Sie saß am Tisch, eingehüllt von einer Traube ihrer Anhängerinnen. Diese boten eine Art Schutz gegen das Böse, das Pia mit Hilfe ihrer Scherben entlarvt hatte. Es gab immer mehr Mädchen, die den Blick durch eine Glasscherbe trainierten und schworen, ebenfalls das Böse erkennen zu können. Wenn Helene Dorn in Ruhe darüber nachdachte, kam sie nicht umhin, Pias Einschätzungen zu den Bewohnern zuzustimmen. Sie stimmte zwar nicht dem Urteil zu, dass etwas Böses in ihnen wäre, doch gewisse Charaktereigenschaften, die einen schwierigen, reizbaren oder streitsüchtigen Menschen ausmachten, sah sie auch, in dem von Pia verurteilten Personenkreis.
Für Ida Stuwe war Pia ein besonders rotes Tuch. Sie wurde derart von ihrem Scherbentick genervt, dass sie ständig Streit mit ihr suchte. Eventuell steckte auch etwas Eifersucht dahinter, da die junge Frau so beliebt war. Frau Dorn sah in ihrem Verhalten gelegentlich leichte Anzeichen von Schizophrenie. Dennoch wagte Ida keine direkten Angriffe auf Pia, sobald sich die Mädchen ihres Freundeskreises in ihrer Nähe aufhielten.
In letzter Zeit hatte sich Pia besonders Reni Schuster unter ihre Fittiche genommen. Obwohl die Frau 7 Jahre älter war als sie, hatten sie schnell einen Draht zueinandergefunden. Reni trat stets schüchtern und übervorsichtig auf. Vor einigen Mädchen fürchtete sie sich. Auch vor Ida. Traurigkeit und Fröhlichkeit machten mit ihr, was ihnen beliebte. Von einer Sekunde auf die andere wechselte sie diese Zustände. Häufig fing sie grundlos zu weinen an und beruhigte sich erst wieder, wenn Pia sie in die Arme nahm, sie hin und her wiegte und beruhigend auf sie einsprach. Unter diesem Gesichtspunkt war Pia eine große Hilfe für Frau Dorn, die sonst noch mehr Arbeit hätte. Ida hatte sich mit einer anderen Bewohnerin angefreundet, die von Pia ebenfalls als das Böse identifiziert worden war.
Elke Simmel bemühte sich, nicht aufzufallen. Sie war still und beobachtete alles sehr genau. Bei Streitigkeiten ihrer Mitbewohner verzog sie sich in eine Ecke. Hätte man sie im Auge behalten, wäre offenkundig, dass sie sich diebisch darüber freute, wenn man jemanden niedermachte, den sie verabscheute. Seit Elke sich Ida angeschlossen hatte, war diese etwas besonnener geworden. Dennoch funkelten Idas Augen herausfordernd zu Pia hinüber. Doch die hatte sich entschieden, dass es diese Person nicht gäbe. Niemals schickte sie einen Blick in deren Richtung.
Momentan hatte Frau Dorn, die mit ihrem Löffel gegen ein Glas schlug, die uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Sie hatte eine Veranstaltung organisiert, über die sie alle potentiellen Interessierten informieren wollte.
„Wir alle haben in den letzten Tagen unschöne Erfahrungen gemacht. Einige von euch belastet dies besonders. Für heute Nachmittag habe ich eine Klangheilerin eingeladen. Mit ihren tibetischen Schalen erzeugt sie Klänge, die tief in euch eindringen und harmonisierend und entspannend wirken. Ihr werdet überrascht sein. Bitte tragt euch in diese Liste ein, wenn ihr teilnehmen möchtet.“
Die Frauen und Männer waren für jede Abwechslung dankbar und so hatte sich bald eine lange Schlange gebildet, die jedoch fast nur aus weiblichen Bewohnern bestand. Pia musste Reni dazu überreden, da sie wieder mal Ängste vor dem Unbekannten entwickelte.
*
Pünktlich fanden sich alle im großen Saal ein. Es waren unzählige Liegen aufgebaut, die mit weißen Handtüchern belegt waren. Die entspannte Haltung würde den Geist vorbereiten. Darum hatten sie in lockerer, nicht einzwängender Kleidung erscheinen sollen. Pia achtete darauf, dass sich Reni eine Liege neben ihr sicherte.
Bereits beim Eintritt schwebten sphärische Klänge durch den Raum, die beruhigend wirkten. Diese Musik würde sie durch die gesamte Veranstaltung begleiten. Gedämpfte Lichter verstärkten das Gefühl der Behaglichkeit.
Die Dame, die sich schon hinter den Klangschalen postiert hatte, sprach ein paar einleitende Worte. Sie erklärte, dass sich durch die Töne der tibetischen Klangschalen die linke und rechte Gehirnhälfte harmonisch verbinden würden. Der Klang würde ebenso Verspannungen lösen und den Körper entgiften. Nicht selten würden emotionale Blockaden gelöst. Die positive Wirkung hielte noch lange an, nachdem die Schwingungen schon verklungen seien.
„Also nehmen Sie eine entspannte Haltung auf den Liegen ein, schließen die Augen und geben sich ganz der Musik und den Klängen hin.“
Nach anfänglichem Gemurmel stellte sich Ruhe ein. Pia nahm Renis Hand, die sich sofort krampfhaft um ihre schloss. Ein leichtes Zucken signalisierte, dass sie sich noch nicht vollends beruhigt hatte. Pia redete beruhigend im Flüsterton auf sie ein.
„Die Klänge sind wie herumfliegende Bienen, die dir frische Luft zufächeln. Sie streifen über jeden Bereich deiner Seele, und versuchen, ihr Heilung zu bringen. Manchmal locken sie auch die Ängste hervor und vertreiben sie. Dann musst du sie rauslassen und darfst sie nicht festhalten.“
Renis Griff wurde lascher. Nach ein paar Minuten erschlaffte ihre Hand. Jetzt lauschten sie gemeinsam den Tönen, deren Schwingungen tief in den Körper drangen.
Nach einer Weile hörte Pia ein leises Schluchzen. Sie schaute zu Reni, der Tränen übers Gesicht liefen. Ihre Geräuschpalette verwandelte sich in ein Wimmern.
„Unsere Heulsuse hat wieder ihren grossen Auftritt“, kam aus der Ecke, wo Ida und Elke lagen.
„Bitte meine Damen. Bewahren Sie absolute Ruhe.“
Die Leiterin kam zu Reni herüber und ermutigte sie, allen Schmerz herauszulassen. Sie würde sich anschließend sehr viel wohler fühlen. Langsam schlich sie zu ihren Klangschalen zurück und ließ den nächsten Gong ertönen.