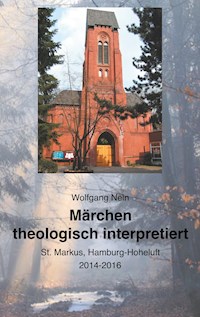Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Das Ja zum Leben und zum Menschen
- Sprache: Deutsch
Seit zweitausend Jahren wird in Predigten immer wieder das Gleiche erzählt. Das ist auch sinnvoll und nötig. Manches wird wohl immer wieder gesagt werden müssen: Geht friedfertig miteinander um! Vergelte das Böse nicht mit Bösem! Nimm das Leben in Dankbarkeit an! Lass dich nicht von Illusionen leiten, aber höre nicht auf zu hoffen. Erkenne deine Grenzen, aber überschreite sie mit deinen Träumen. Glaube - trotz vieler enttäuschender Erfahrungen - an das Gute im Menschen und an die Liebe. Sei barmherzig mit anderen und mit dir selbst. Lass im Zweifel Gnade vor Recht ergehen. Und lass dich leiten von dem Vertrauen, dass auch in deinem Leben die Mitte der Nacht der Anfang eines neuen Tags sein kann. Christliche Predigten wiederholen und bekräftigen seit zweitausend Jahren das Ja zum Leben und zum Menschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Alltagswelt und Himmelreich
11. Januar 1987
1. Sonntag nach Epiphanias
Matthäus 4,12-17
Das wahre Wunder: seine göttliche Menschlichkeit
1. Februar 1987
4. Sonntag nach Epiphanias
Matthäus 14,22-33
Die gute Saat ist aufgegangen
22. Februar 1987
Sexagesimae
(2. Sonntag vor der Passionszeit)
Markus 4,26-29
Dieser Schuldspruch ist ein Freispruch
8. März 1987
Invokavit
(1. Sonntag in der Passionszeit)
Bethlehemkirche
1. Mose 3,1-19
Der Mensch – ein ethischer Versager
17. April 1987
Karfreitag
1. Mose 3,1-19
Christlicher Glaube ohne Auferstehung?
20. April 1987
Ostermontag
Lukas 24,6.30-45
Durst nach Leben
31. Mai 1987
Exaudi
(6. Sonntag nach Ostern)
Johannes 7,37-39
Das Menschenmögliche ist längst nicht alles
7. Juni 1987
Pfingstsonntag
Johannes 16,5-15
Gott passt nicht in die Kirche
14. Juni 1987
Trinitatis
Jesaja 6,1-13
Zweierlei Sünder
5. Juli 1987
3. Sonntag nach Trinitatis
Lukas 15,1-3.11b-32
Was suchen wir?
19. Juli 1987
5. Sonntag nach Trinitatis
Johannes 1,35-42
Wir sind entlastet und beauftragt
8. November 1987
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
Bittgottesdienst für den Frieden
Römer 6,19b-23
Heiland für Leib und Seele und die ganze Welt
24. Dezember 1987
Heiligabend
Lukas 2,1-20
Hirten werden zu Königen
24. Dezember 1987
Heiligabend
Lukas 2,8-17.20
Gott, Lenker der Geschichte?
31. Dezember 1987
Altjahrsabend
2. Mose 13,20-22
Mit zweierlei Hoffnung ins neue Jahr
3. Januar 1988
2. Sonntag nach dem Christfest
Jesaja 61,1-3.11.10
Priester, König, Richter, Gottes- und Menschensohn
24. Januar 1988
Letzter Sonntag nach Epiphanias
Offenbarung 1,9-18
Als Lämmer feiern und als Wölfe leben?
14. Februar 1988
Estomihi
(Sonntag vor der Passionszeit)
Amos 5,21-24
Er hat sich nicht verhärten lassen
27. März 1988
Palmsonntag
(6. Sonntag der Passionszeit)
Jesaja 50,4-9
Er hat sich selbst zum Sündenbock gemacht
1. April 1988
Karfreitag
Jesaja (52,13-15;)53,1-12
Das Ja-Wort ist kein Abschluss, sondern ein Anfang
24. April 1988
Jubilate
(3. Sonntag nach Ostern)
Konfirmation
Apostelgeschichte 17,27
Aus dem Herzen heraus tun, was gut ist
15. Mai 1988
Exaudi
(6. Sonntag nach Ostern)
Jeremia 31,31-34
Unser Leben als Lobpreis Gottes
29. Mai 1988
Trinitatis
Epheser 1,3-14
Christsein ist mehr als Pflichterfüllung
17. Juli 1988
7. Sonntag nach Trinitatis
Philipper 2,1-4
Mut zum öffentlichen Bekenntnis
31. Juli 1988
9. Sonntag nach Trinitatis
Jeremia 1,4-10
Wie können wir vor Gott bestehen?
14. August 1988
11. Sonntag nach Trinitatis
Galater 2,16-21
Gebet – Bekenntnis menschlicher Grenzen
9. Oktober 1988
19. Sonntag nach Trinitatis
Jakobus 5,13-16
Sich mit den Gegebenheiten arrangieren?
23. Oktober 1988
21. Sonntag nach Trinitatis
Jeremia 29,1.4-7.10-14
Trotz Hiobsbotschaften gilt die gute Nachricht
6. November 1988
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
Hiob 14,1-6
Hoffen ohne Illusionen
13. November 1988
Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres
Bittgottesdienst für den Frieden
Hesekiel 37,1-6
Mitte der Zeit – auch in unserem jährlichen Alltag
27. November 1988
1. Advent
Lukas 1,67-79
„Dennoch!“
4. Dezember 1988
2. Advent
Jesaja 35,3-10
Weg der Sehnsucht
11. Dezember 1988
3. Advent
Simeonkirche
Jesaja 40,1-8(9-11)
Himmel und Erde kommen einander nahe
25. Dezember 1988
1. Weihnachtstag
Johannes 3,31-36
Das Leben – Blick in ein großes Geheimnis
1. Januar 1989
Neujahr
Psalm 31,16a
Sehnsucht nach dem ganz anderen?
22. Januar 1989
Septuagesimae
(3. Sonntag vor der Passionszeit)
Matthäus 9,9-13
Wollen und nicht können
12. Februar 1989
Invokavit
(1. Sonntag der Passionszeit)
Lukas 22,31-34
Noch einmal von vorn anfangen
26. März 1989
Ostersonntag
Markus 16,6
Wer ist Christ?
2. April 1989
Quasimodogeniti
(1. Sonntag nach Ostern)
Konfirmation
1. Johannes 4,19
Singt dem Herrn ein neues Lied
23. April 1989
Kantate
(4. Sonntag nach Ostern)
Singegottesdienst
Psalm 96
Die tiefe Sehnsucht nach einer Einheit
4. Mai 1989
Himmelfahrt
Johannes 17,20-26
Dass es die Kirche gibt, ist ein Wunder
14. Mai 1989
Pfingstsonntag
4. Mose 11,11-12.14-17.24-25
Ist der Einladende eines Besuches nicht wert?
18. Juni 1989
4. Sonntag nach Trinitatis
Partnerschaft St. Markus – Uyole, Tansania
Lukas 14,15-24
Mit der Hoffnung die Resignation überwinden
2. Juli 1989
6. Sonntag nach Trinitatis
Jesaja 43,1-7
Finden und gefunden werden
23. Juli 1989
9. Sonntag nach Trinitatis
Matthäus 13,44-46
Eine weiß die Vergebung wertzuschätzen
6. August 1989
11. Sonntag nach Trinitatis
Lukas 7,36-50
Spuren der Hoffnung in der Geschichte
27. August 1989
14. Sonntag nach Trinitatis
1. Mose 28,10-19a
Neue Sicht – Freude, Skepsis, Ablehnung
17. September 1989
17. Sonntag nach Trinitatis
Partnergemeinde Heilgeist, Stralsund
Johannes 9,35-41
Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei!?
5. November 1989
24. Sonntag nach Trinitatis
Singlegottesdienst
1. Mose 2,18
Warten mit Vorbereitung
3. Dezember 1989
1. Advent
Hebräer 10,(19-22)23-25
Bibelstellen
Vorwort
Seit zweitausend Jahren wird immer wieder das Gleiche erzählt – in der Predigt. Zumindest wird dabei immer auf das eine Buch zurückgegriffen – die Bibel. Manche finden das langweilig. Es gibt aber zahllose Themen des täglichen Lebens und des Lebens überhaupt, die auch seit zweitausend Jahren und mehr immer dieselben sind und die immer wieder anzusprechen wichtig ist.
„Du sollst nicht lügen“ zum Beispiel, eines der zehn Gebote. Wir können uns dieses Thema nicht gleichgültig sein lassen. Lügen schadet dem Lügenden, es schadet dem Belogenen und es schadet der Gemeinschaft, der Gesellschaft und den weltweiten Beziehungen. Das Lügen beginnt im Kleinkindalter, mit jedem neugeborenen Kind von neuem; es setzt sich fort bei dem Jugendlichen, dem Erwachsenen und endet auch nicht im Alter. Manche probieren es mal aus, anderen ist es zur Gewohnheit geworden. Lügen zerstört Vertrauen in den zwischenmenschlichen Beziehungen im Kleinen wie im Großen, zwischen einzelnen Menschen und ganzen Nationen. Es ist eine große und nie endende Aufgabe, gegen das Lügen anzuarbeiten.
Es könnte einer sagen: „Dass wir nicht lügen sollen, wissen wir doch; das braucht nicht ständig wiederholt zu werden.“ Wir wissen es, aber wir tun es trotzdem – oft auch, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollen und es auch missbilligen. Es geht insofern nicht nur darum, das immer wieder zu wiederholen, was wir bereits wissen. Es geht auch darum, immer wieder, wie der Volksmund sagt, den „inneren Schweinhund“ zu bekämpfen und den Rücken dafür zu stärken, dass wir uns wirklich so verhalten, wie wir es eigentlich für gut und richtig, für sinnvoll und notwendig halten.
Die Predigt hat unter anderem eben diese Aufgabe: die guten inneren Einsichten und Kräfte zu stärken. Das ist eine Daueraufgabe. Wo diese Aufgabe nicht wahrgenommen wird, werden die Konsequenzen schnell spürbar – wie zum Beispiel bei jemandem, der ein Klavierstück eigentlich auswendig spielen kann, aber wenn er eine Zeit lang nicht übt, wird er diverse Fehler machen. Das Thema „Du sollst nicht lügen“ ist nur ein Beispiel.
Ein anderes Thema ist zum Beispiel die Vergeltung. Wir wissen, dass es nicht gut ist, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, und dass es noch schlechter wäre, auf eine Untat mit einer doppelt schweren Untat zu antworten. Aber sich von dieser Einsicht im konkreten Verhalten leiten zu lassen, ist nicht so einfach. Unsere spontanen Empfindungen drängen uns oft in eine andere Richtung. Und nicht selten sind wir auch unsicher, ob eine gehörige Vergeltungsmaßnahme nicht doch die bessere Alternative wäre. Es ist darum gut und nötig, dass wir immer wieder zum Verzicht auf Vergeltung angehalten werden, dass der Sinn dieses Verzichts immer wieder plausibel gemacht wird und wir den Nutzen und Segen von Alternativen aufgezeigt bekommen. Auch bei diesem Thema hat die Predigt eine große und nie endende Aufgabe.
Hinzu kommt, dass weltweit betrachtet in vielen Ländern Vergeltung keineswegs kritisch gesehen, sondern im Gegenteil weiterhin als geradezu selbstverständliche Art des Umgangs mit Untaten angesehen wird – mit den bekannten negativen Folgen.
Um noch ein drittes Thema zu nennen, welches langweilig erscheinen mag, aber zeitlos ist und der ständigen Aufmerksamkeit bedarf: die Dankbarkeit. „Danke“ ist eines der wichtigsten Wörter. Das lernen wir schon als Kind. Das Danken aber nicht nur als formelle Form der Höflichkeit zu praktizieren, sondern es als Grundhaltung dem Leben gegenüber zu verstehen und zu praktizieren, das ist keineswegs selbstverständlich, aber von großer, grundlegender Bedeutung für unser Verhältnis zu den Dingen des Lebens und den Umgang mit ihnen. Auch diesbezüglich hat die Predigt eine nie endende Aufgabe.
Die Predigt ist nicht, wie einer sagte, die „institutionalisierte Belanglosigkeit“. Die Predigt ist vielmehr sinnvoll und nötig.
Wolfgang Nein, Juli 2017
Alltagswelt und Himmelreich
11. Januar 1987
1. Sonntag nach Epiphanias
Matthäus 4,12-17
Dieser Text enthält viele interessante Aspekte. Ich möchte nur auf drei Dinge zu sprechen kommen: die öffentliche Brisanz des Auftretens Jesu, die Verbindung des Auftretens Jesu mit geschichtlichen Erwartungen des Volkes Israel und schließlich die Verkündigung Jesu vom Anbruch des Himmelreiches, verbunden mit dem Aufruf zur Buße.
Zunächst also einige Worte zur öffentlichen Brisanz des Auftretens Jesu. Der Täufer Johannes war von Herodes Antipas ins Gefängnis gesteckt worden, weil er sich Kritik an der Lebensführung des Herrschers erlaubt hatte. Herodes Antipas hatte seinen Bruder Philippus die Frau ausgespannt und damit gegen das jüdische Gesetz verstoßen.
Jesus sieht in der Gefangennahme des Johannes offenbar auch eine Bedrohung für sich selbst, denn er begibt sich an einen anderen Ort – nach Kapernaum am Galiläischen Meer.
Beide, Johannes und Jesus, rufen öffentlich zur Buße auf. Sie tun dies also nicht im kleinen privaten Kreise, sondern in aller Öffentlichkeit. Und sie rufen nicht nur in allgemeiner und abstrakter Form zur Buße auf, sondern sie benennen konkrete Verhaltensweisen konkreter Personen. Das hat beide in Gefahr gebracht und ihnen schließlich das Leben gekostet.
Nicht, dass sie Unrecht begangen hätten oder dass sie berechtigte Anliegen gewalttätig durchzusetzen versucht hätten – nein! Was sie Leib und Leben kostete, war dies: dass sie es wagten, öffentlich Kritik zu üben, dass sie es wagten, auch oberste religiöse und politische Autoritäten zu kritisieren und mit ihrer Kritik überhaupt die in ihrer Gesellschaft vorhandenen Grundhaltungen infrage zu stellen.
Das gezielt eingesetzte Wort ist, gerade wenn es die Schwachstellen, die Unwahrhaftigkeiten und Ungerechtigkeiten einer Gesellschaft, bestimmter Kreise und Einzelner aufzudecken vermag, eine gewaltige Macht und für den, der dieses Wort einsetzt, eine erhebliche Gefährdung. Die enthüllende Wahrheit kann nicht mit offenen Armen rechnen. Wer die Macht dazu hat, wird sie zu verhindern suchen.
Johannes und Jesus waren keine Anpasser und keine Duckmäuser. Sie besaßen das, was wir Zivilcourage und Mut nennen. Sie fühlten sich berufen, die Stimme der Kritik zu erheben. Sie taten es unter Einsatz ihres Lebens. Und sie taten es zugunsten der Schwachen und Stimmlosen. Solche Menschen braucht eine Gesellschaft, solche Menschen, die sich nicht dem Druck der Mächtigen beugen, sondern der Wahrheit Stimme verleihen, stellvertretend für die vielen Ängstlichen, die leiden und doch nicht aufbegehren.
Nachdem Johannes festgesetzt worden ist, tritt Jesus auf, vorsichtig, aber bestimmt. Matthäus lässt ihn bei seinen öffentlichen Auftritten dieselben Worte wie Johannes sagen: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.“
Das also ist das eine, das wir diesem Text entnehmen können: Johannes und Jesus – uns interessiert vor allem der Letzte –, also Jesus hat eine öffentliche Wirkung erzielt, die Menschen aufhorchen und aufschrecken ließ und die ihn für manche zur „persona non grata", zur unliebsamen Person machte, die besser beiseitegeschafft gehörte, ein Zeichen wohl dafür, dass sich manche ertappt fühlten.
Die Wirkung, die Jesus mit seinem Auftreten und seinen Worten erzielt hat, wird christliche Verkündigung auch heute erzielen, wenn sie zum Kern der Sache kommt, wenn sie die Wahrheit deutlich ausspricht und die in unserer Gesellschaft heute verbreiteten Unwahrhaftigkeiten und Ungerechtigkeiten anprangert, wie zum Beispiel diese: dass der ökonomische Gewinn, entgegen allen gegenteiligen Beteuerungen doch an die oberste Stelle aller Werte gesetzt ist und um seinetwillen Bedenken ethischer Art zurückgestellt werden.
Wenn wir dieses Thema öffentlich ausbreiten unter Benennung konkreter Verhaltensweisen und Personen, dann können wir uns sicher sein, dass wir uns damit heftigsten Anfeindungen aussetzen. Wenn wir schweigen, haben wir unsere Ruhe. Wir könnten sie aber nicht mit gutem Gewissen haben.
Sollen wir also im Sinne Jesu unsere Stimme öffentlich erheben? Ja, wir sollen es. Aber wir sind nicht wie Jesus, nämlich frei von aller Schuld, sondern sind selbst schuldbeladen. So muss unsere Kritik immer zugleich uns selbst gelten. Hier liegt ein großes Hemmnis. Aber wenn wir es mit dem christlichen Glauben ernst meinen, dürfen wir nicht – aus Sorge um uns selbst - unausgesprochen lassen, was wir als Wahrheit erkannt haben. Diese anzusprechen, dazu macht der christliche Glaube Mut, der Glaube an die Vergebung Gottes.
Wir sind nicht wie Jesus, das soll noch einmal gesagt werden; denn damit komme ich zum Zweiten: Matthäus stellt die Einzigartigkeit Jesu heraus, indem er mit Zitaten aus dem Alten Testament aufzeigt, dass in ihm der vom Volk Israel erwartete Messias erschienen ist, der Retter und Erlöser, der allem Elend ein Ende bereiten würde.
Indem Matthäus so die religiösen Erwartungen seines Volkes auf diese Person Jesus bezieht, verleiht er ihm eine höchste Autorität, gibt er seinem Auftreten und seinen Worten eine letzte Verbindlichkeit. Der Kritik Jesu an den Menschen und der Gesellschaft seiner Zeit verleiht er damit eine unabweisbare Ernsthaftigkeit.
Dass viele damalige jüdische Zeitgenossen der Interpretation des Matthäus und der anderen Christgläubigen nicht folgten, wissen wir. Nur eine Minderheit sah in Jesus den erwarteten Messias. Und so war es auch nur eine Minderheit, die sich seine Worte zu Herzen nahm.
Matthäus lässt immer mal wieder einfließen, auch in unserem Text, dass es nicht nur und nicht vor allem Juden waren, die die einzigartige göttliche Bedeutung Jesu erkannten. Er formuliert das hier so: „Das Land Sebulon und das Land Naftali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Finstern saß, hat ein großes Licht gesehen; und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen.“
Diese poetischen Worte sind als eine Kritik an seinem eigenen jüdischen Volk zu verstehen, das es in seiner großen Mehrheit nicht vermochte, in Jesus den gottgesandten Erlöser zu erkennen, das deshalb auch nicht seine Botschaft ernst nahm, geschweige denn seine Kritik akzeptierte.
Welches war nun der Inhalt der Botschaft, der Verkündigung Jesu? Ich komme damit zum Dritten. Sie ist hier in unserem Text zusammengefasst in dem einen Satz: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.“ Das Himmelreich oder wie es an anderen Stellen des Neuen Testaments oft heißt, das „Reich Gottes“; damit ist dasselbe gemeint. Aber was ist gemeint? Das lässt sich nicht so klar und eindeutig beantworten. Aber im Reden vom Himmelreich kommt doch eines zum Ausdruck: Es ist ganz anders als das Reich unserer Welt. Beide stehen in einem Gegensatz zueinander: die Welt, in der wir leben, und die himmlische Welt, das Reich Gottes, die Welt unserer Sehnsucht.
Wie schwer es auch immer sein mag, diese Letzte zu beschreiben, so einfach scheint es dagegen, unsere Welt, das von Menschen beherrschte Reich, in Worte zu fassen. Gewiss ist in der Vorstellung vom Reich Gottes alles das enthalten, woran es in unserer Welt so sehr mangelt, wonach wir uns aber umso heftiger sehnen. So mögen wir im Umkehrschluss von den Defiziten unserer Welt auf das schließen, was sich im Reden vom Reich Gottes an Vorstellungen verdichtet hat.
Was ist es, woran es hier mangelt? Es mangelt an so vielem: an einer grundlegenden Sicherheit und Gewissheit. Unser ganzes Dasein ist so undurchschaubar und so unbeherrschbar. Wir wissen nicht, woher wir kommen und wohin wir gehen; wir wissen nicht einmal, wie uns geschieht. Das Verstehen unserer Welt und unserer selbst ist in enge Grenzen gefasst. Im täglichen Leben mag uns das wenig berühren, aber in manchen Momenten des Nachdenkens kann das zu einer bedrückenden Einsicht werden. Wir können den Sinn unseres Lebens nicht erfassen und wir haben keine sicheren Antworten auf die Fragen nach dem richtigen Verhalten. Wir haben eine Ahnung vom Guten und vom Bösen. Wir erleben das Schreckliche, das Menschen zu tun imstande sind. Und wir meinen, das Gute zu wissen. Aber wir meinen oft, das Gute zu tun, und richten doch Schaden an und leisten dem Bösen Vorschub. Wir haben oft guten Willen, aber vermögen ihn nicht in die Tat umzusetzen. Wir tun, was wir nicht wollen, und können das oft nur mit ungläubigem Staunen über uns selbst zur Kenntnis nehmen. Wir wollen die Dinge des Lebens beherrschen und entwickeln all unsere Fähigkeiten und erfahren am Ende umso deutlicher unsere Ohnmacht. Wir sind stolz auf das, was wir zu leisten vermögen, und rühmen uns unserer Freiheit. Aber mit unserem Können wächst auch unsere Verantwortung, und mit unserer Verantwortung wachsen auch unsere Versäumnisse. Was wir auch tun, es bringt uns keine Ruhe. Wir können uns nicht selbst am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Wir spüren unsere Angewiesenheit und unsere Abhängigkeit. Die Lösung all unserer Probleme können wir uns nicht selbst geben.
Die letzten Fragen können wir stellen, aber wir können sie nicht selbst beantworten. Wir haben Wünsche, doch wir können sie uns nicht selbst erfüllen.
Im Reden von Himmelreich, vom Reich Gottes spricht sich all dies aus: eine tiefe Einsicht in unser Dasein, in die grundlegenden Mängel unseres Daseins und Soseins und in die letztliche Unverfügbarkeit unseres Lebens.
Es sind aber nicht nur diese bitteren Einsichten, sondern es ist auch eine große Hoffnung, die im Reden vom Himmelreich zum Ausdruck kommt: dass es also doch etwas anderes gibt und geben wird als das, was wir vorfinden und worin wir gefangen sind: die Sehnsucht nach dem ganz anderen, wo all das heil ist, was in unserer Welt zerrissen und zerbrochen ist, wo wir entlastet sind von allem, was uns hier bedrückt, wo wir zur Ruhe kommen und die Geborgenheit finden, die wir hier noch vermissen. Wann und wo und wie uns dieses Reich unserer Sehnsucht zuteilwird, das ist eine für uns unbeantwortbare Frage. Es ist jedenfalls kein mit unseren Händen erschaffbares Reich. Es ist etwas, das uns nur aus anderer Hand zuteilwerden kann.
Neutestamentliche Überzeugung ist, dass mit Jesus dieses Reich des Himmels, das Reich Gottes, angebrochen ist. „Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen“ – manche haben diese Ankündigung als einen Irrtum bezeichnet; denn die Welt ist danach geblieben, wie sie zuvor gewesen ist. Von großen Veränderungen, die von vielen in einem ganz konkreten Sinne erhofft worden waren, ist nichts zu erkennen.
Aber andere haben diese Ankündigung anders ausgelegt: Mit dem Auftreten Jesu ist das Himmelreich den Menschen nahegekommen. In seiner Person ist es angebrochen. Er ist ein Teil des Reiches Gottes, ein Vorgeschmack auf die Vollendung. In seiner Person ist das Heil zur Wirklichkeit geworden, nach dem wir uns sehnen. Darum ist er unser Heiland, der Christus. Er hat getan, was wir zu tun nicht vermögen. Er hat ohne den Makel der Schuld in reiner Form geliebt. Er hat gegeben, wonach uns im Letzten begehrt. Jesus Christus ist das Himmelreich. Uns, die wir im Finstern saßen, ist ein Licht aufgegangen. Auf dieses Licht gehen wir zu mit größerer Gewissheit als zuvor.
Das wahre Wunder: seine göttliche Menschlichkeit
1. Februar 1987
4. Sonntag nach Epiphanias
Matthäus 14,22-33
Der jüdische Gelehrte Pinchas Lapide hat vor drei Jahren ein kleines Buch veröffentlicht mit dem Titel: „Er wandelte nicht auf dem Meer.“ Lapide hat unseren Predigtabschnitt in der Fassung des Evangelisten Markus untersucht, die die ursprüngliche Version ist. Er ist dabei zu dem Schluss gekommen, den er dann für den Titel seines Buches verwendet hat.
„Jesus wandelte nicht auf dem Meer“ – diese Behauptung können wir nicht einfach ignorieren. Mancher mag diese Behauptung vielleicht als eine Verletzung der Autorität der Bibel empfinden, als mangelnden Respekt gegenüber dem Text unserer Heiligen Schrift. Für andere hat die Behauptung Lapides vielleicht eine befreiende Wirkung, in dem Sinne etwa: „Endlich hat es jemand ausgesprochen! Das kann ja gar nicht wahr sein, dass Jesus übers Wasser gelaufen ist.“
Fest steht, dass der Text in seiner jetzigen Form, sowohl in der Fassung von Matthäus wie von Markus, uns sagen will: „Jesus wandelte auf dem Meer.“ Und das Wunderhafte dieses Ereignisses spielt für beide Evangelisten eine wesentliche Rolle.
Das Wunderhafte soll den göttlichen Charakter Jesu herausstellen. Er ist kein Mensch wie jeder andere. Er kann, was Menschen sonst nicht können. Er trägt göttliche Züge. Dies wird von den Jüngern auch so empfunden. Sie fallen vor Jesus nieder und sagen: „Du bist wahrhaftig Gottes Sohn.“
Lapide vermutet, dass in der ursprünglichen mündlichen Erzählung nur davon die Rede war, dass Jesus am Meer entlangging, also am Ufer entlang. Er kann diese Vermutung mit sprachlichen Argumenten schlüssig begründen. Übersetzt man nämlich die griechische Formulierung für „auf dem Meer“ zurück ins Aramäische, in der diese Episode ursprünglich erzählt worden ist, so kommt man auf eine Formulierung, die im Aramäischen, der Sprache Jesu, nur bedeuten konnte: „Er ging am Ufer entlang.“ Erst durch die Übersetzung ins Griechische, der Sprache des Neuen Testaments, wurde die Formulierung mehrdeutig und gab damit Raum zur wunderhaften Ausgestaltung der ursprünglich vielleicht ganz realistischen Schilderung.
Ich will diese Überlegungen von Lapide jetzt gar nicht weiter ausführen, sondern einmal grundsätzlich die Frage stellen: „Kommt es für unseren Glauben darauf an, dass Jesus wirklich auf dem Meer gewandelt ist?“ Einige werden darauf antworten: „Ja, denn gerade in diesem Wunder, wie in den vielen anderen über Jesus berichteten Wundern, erweist sich Jesus als der Gott-Mensch. Hätte er all diese Wunder nicht vollbracht, wäre er eben nur einer wie alle anderen gewesen.
Diesem Argument ist entgegenzuhalten, dass in jener Zeit auch von zahlreichen anderen Menschen Wundertaten berichtet wurden, die auch auf diese Weise als göttliche Wesen beschrieben werden sollten. Bei den Griechen gab es mehrere Legenden, die von einem Gehen auf dem Wasser handelten. Mit diesem Wunder konnte Jesus also noch nicht als die einzigartige Persönlichkeit dargestellt werden, als die wir ihn ansehen sollen und ansehen.
Davon abgesehen gibt es Menschen, die einem so spektakulären Ereignis wie einem solchen Wunder nichts abgewinnen können, was für ihr persönliches Leben von Bedeutung wäre.
Die wunderhafte Durchbrechung der Naturgesetze wäre für sie vielleicht geeignet, momentanes Staunen auszulösen, vielleicht noch Bewunderung für die betreffende Person, aber damit hätte es sich dann. Muss für solche Menschen das Neue Testament, das voller Wundererzählungen ist, letztlich wertlos sein? Nein, und dies möchte ich jetzt nachdrücklich betonen, obwohl dies vielleicht gar nicht mehr nötig ist, weil inzwischen selbstverständlich ist: Von den Wundern hängt unser Glaube nicht ab. Sie sind als Ausdrucksmittel jener Zeit zu verstehen, um das ganz Besondere, das schier Unglaubliche und Unfassbare irgendwie in Worte und Bilder zu fassen.
Zu fragen ist also nach dem Besonderen, dem Ungewöhnlichen, dem zutiefst Beeindruckenden und Berührenden an Jesus, das Menschen seiner Zeit dazu brachte, ihn mit Wundererzählungen unterschiedlichster Art als Gott-Mensch, als Gottes Sohn zu beschreiben. Das Einzigartige an Jesus sind nicht seine Wunder, dass Einzigartige an ihm ist dasjenige in seinem Wesen, seinem Reden und seinem Handeln, was zu den wundersamen Berichten über ihn geführt hat.
Wenn wir uns daraufhin seine vielen Wundertaten einmal ansehen, werden wir feststellen: Das Einzigartige an Jesus ist seine Menschlichkeit, seine Menschlichkeit im besten Sinne des Wortes. Sie trägt geradezu göttliche Züge. Sie ist das eigentliche Wunder. Jesus hat viele Kranke geheilt, auf sonderbare Weise, oft nur durch ein Wort und oft aus der Ferne, ohne den Patienten auch nur zu sehen; so schildern es uns die Evangelien.
Man könnte sagen: „So etwas ist Unsinn“ – und den Text als unbrauchbar beiseitelegen. Damit würde man die eigentliche Aussage der Heilungsgeschichten aber verfehlen. Denn das, was sie uns zu allererst sagen wollen, ist dieses: Jesus hat sich der Kranken angenommen, um die sich sonst keiner mehr kümmerte. Er hat sich der hoffnungslosen Fälle angenommen; denn für ihn gab es so etwas nicht: einen hoffnungslosen Fall. Denjenigen, die von anderen bereits abgeschrieben waren, wie den seit achtunddreißig Jahren Gelähmten, und den Blindgeborenen zum Beispiel, denen hat er sich zugewandt und hat ihr Schicksal gewendet. Kranke, die wegen ihrer Krankheit außerhalb der menschlichen Gemeinschaft, isoliert von ihren Familien, Freunden und Bekannten, ein Leben als Ausgesetzte führen mussten, hat er geheilt und so in die menschliche Gemeinschaft zurückgeführt.
Es ist diese Menschlichkeit, die ihn auszeichnet, dieses Erbarmen mit den Hilflosen, den Schwachen, den Allerschwächsten, und nicht nur den Kranken. Seine Barmherzigkeit umfasste auch die Gestrauchelten, die vor dem Gesetz schuldig Gewordenen, die aufgrund ihres zweifelhaften Verhaltens Verachteten und die aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung gering Geschätzten.
Darin zeigt sich gerade das ganze ungewöhnliche und einzigartige Ausmaß seiner Menschlichkeit: dass er auch noch diejenigen in seine Barmherzigkeit einbezog, die es eigentlich gar nicht verdient gehabt hätten, sogar selbst diejenigen noch, die ihm feindlich gesonnen waren. Diese Menschlichkeit ist der durchgängige Charakterzug Jesu. Sie ist durch alle Evangelien, durch das ganze Neue Testament belegt. Erstaunen hierüber und die Dankbarkeit hierfür ist in allen Texten zu spüren.
In einer Welt, in der es auch damals an Grausamkeiten nicht mangelte, musste eine solche Haltung der Liebe zu den Menschen wie ein wahres Gottesgeschenk erscheinen. Und so ist es auch heute: Wo wirkliche Liebe praktiziert wird, da empfinden wir sie als ein Geschenk des Himmels.
Die Menschen jener Zeit haben dieses Wunder der Menschlichkeit nicht anders darzustellen vermocht als mit den Ausdrucksmitteln ihrer Zeit, eben mit diesen Wunderberichten. Sie haben damit Menschen zu überzeugen versucht: „Seht, dieser Jesus, der so gut zu den Schwächsten und Ärmsten war, er war nicht irgendein Mensch, er war ein göttliches Wesen, Sohn Gottes.“ Wer durch die Menschlichkeit Jesu noch nicht zutiefst berührt und erfasst war, der sollte durch den Erweis seiner gottgleichen Fähigkeiten, seiner Macht über die Naturgesetze überzeugt werden.
Ich wünschte manchmal, die Zeitgenossen Jesu und die Anhänger der ersten Generationen hätten es bei der schlichten Schilderung seiner Menschlichkeit belassen. Denn die Wunder sind für viele nicht eine Hilfe, sondern ein Hindernis für ihren Glauben. Sie lenken den Blick vom Eigentlichen weg. Nicht der Inhalt fesselt die Aufmerksamkeit, sondern die Verpackung. Manche betrachten sogar das spektakulär Wunderhafte als den eigentlichen Inhalt. Ohne diese Wunder wäre für sie die Menschlichkeit Jesu vielleicht zwar noch ganz bemerkenswert. Sie hätte letztlich aber doch keine großartige und andauernde Bedeutung. Gerade die Menschlichkeit Jesu, die aus allen Unmenschlichkeiten unserer Welt, aus der gewohnten Gleichgültigkeit, der Resignation und dem Zynismus hervorleuchtet, gerade die uneingeschränkte, bedingungslose und durch nichts zu zerstörende Menschlichkeit Jesu ist das Göttliche am Wesen Jesu, das, was uns zu trösten vermag in Situationen der Not, der Enttäuschungen, der Bitterkeit.
Die ersten christlichen Gemeinden hatten bittere Not zu leiden. Sie lebten in einer feindseligen Umgebung. Sie waren wegen ihres Glaubens sowohl von jüdischer wie von heidnischer Seite bedrängt. Sie machten bitterste Erfahrungen mit ihren Mitmenschen, und der Einzelne wird immer wieder in Zweifel an dem Sinn der Menschlichkeit Jesu geraten sein.
Denn das ist das eigentlich Schwierige am Glauben. Es ist wohl leichter zu glauben, dass Jesus über das Wasser gelaufen, als dass er wirklich so vorbehaltlos menschlich gewesen sei. Die ersten Gemeinden mögen sich so empfunden haben, wie es in unserem Text bildhaft geschildert ist: wie ein Boot auf hoher See, gefährdet durch den Wellengang, den Wind von vorn, vom Untergang bedroht. Wer sollte in solcher Situation nicht von existenzieller Angst und von Zweifeln an der Menschlichkeit erfasst werden! Die Gemeinden werden sich daran erinnert haben, dass es für Jesus keine hoffnungslosen Situationen gegeben hatte und dass er sich vieler in schier hoffnungslosen Situationen angenommen hatte.
Dieses Wissen gab ihnen Zuversicht, und sie machten sich gegenseitig Mut mit Erzählungen über Jesus, die ihnen überliefert waren. Beim Weitererzählen haben sie manche Züge Jesu vielleicht überzeichnet, in guter Absicht freilich, den Glauben an diesen Einen zu bewahren und zu stärken, den Glauben an die Menschlichkeit in einer Welt voller Unmenschlichkeit, den Glauben an die Hoffnung in einer Welt voller hoffnungsloser Situationen.
Ob Jesus nun auf dem Meer gewandelt ist oder nicht, bei dieser Frage sollten wir uns nicht aufhalten. Dass die Liebe zu den Menschen durch ihn gelebt worden ist, das ist das wahre Wunder, der Erweis seiner Göttlichkeit. Das zu glauben und ihm darin nachzugehen, dazu sind wir berufen.
Die gute Saat ist aufgegangen
22. Februar 1987
Sexagesimae
(2. Sonntag vor der Passionszeit)
Markus 4,26-29
Dieses Gleichnis von der selbstwachsenden Saat ist ein Gleichnis der Hoffnung, des Vertrauens und des Trostes angesichts unserer menschlichen Grenzen und Schwächen. Versetzen wir uns zunächst einmal zurück in die Zeit Jesu und versuchen wir, das Gleichnis aus seiner Zeit und der damaligen Lebenssituation heraus zu verstehen, bevor wir uns nach der Anwendung für uns persönlich heute fragen.
Zwei Merkmale der Zeit Jesu möchte ich ins Gedächtnis rufen. Das eine ist die unter den Juden verbreitete Erwartung des Messias, des endzeitlichen Befreiers und Erlösers. Messias, das ist die alttestamentliche Bezeichnung für den König, genauer: den Gesalbten; wir würden in unserem Kulturkreis sagen: den Gekrönten.
Der König hat für das Wohlergehen des Volkes im umfassenden Sinne zu sorgen. So verstanden die Juden den von ihnen erwarteten endzeitlichen Messias: Er sollte ihnen die nationale Befreiung bringen, die Befreiung von den politischen Besatzungsmächten. Immer wieder ist Israel von fremden Völkern unterworfen worden. Er sollte Frieden bringen im vollen Sinne des Wortes, nicht nur einen begrenzten Waffenstillstand. Und Frieden schließlich auch nicht nur für das Volk Israel selbst, sondern für die ganze Völkergemeinschaft. Mit dem Auftreten des Messias würde die Herrschaft Gottes selbst über alle Menschen anbrechen.
Dies ist das eine: die jahrhundertealte Erwartung des Messias, die es jetzt zu bedenken gilt. Das andere ist die konkrete politische Situation zur Zeit Jesu: Die Juden lebten unter der römischen Besatzungsmacht. Und da gab es Befreiungsbewegungen. Ich nenne die Zeloten, eine Abspaltung der pharisäischen Bewegung. Die Zeloten waren angesichts der römischen Besatzungsmacht nicht bereit, weiter geduldig auf die Ankunft des erwähnten endzeitlichen Messias zu warten. Sie wollten durch aktives Eingreifen die Erfüllung der messianischen Hoffnung beschleunigen und herbeiführen. Sie entfachten politische Unruhen, riefen zum Widerstand gegen die Römer und zum Aufstand auf.
Man muss sich nun in dieser politisch hoch gespannten Situation Jesus mit seinen Anhängern vorstellen. Von ihm behaupteten einige, er sei der Messias, oder, um das griechische Wort zu verwenden: Er sei der Christus, der endzeitliche Erlöser und würde das Volk Israel befreien.
Wir können uns leicht ausmalen, dass manche sich darüber lustig gemacht haben: Was sollte dieser Jesus in den politischen Wirren jener Zeit ausrichten können?! Andere fanden die Anwendung des Messiastitels auf Jesus anmaßend bis gotteslästerlich. Ihm sollte das schließlich zum Verhängnis werden. Er wurde deswegen hingerichtet. Jedenfalls gab Jesus nicht die Figur ab, die man sich offenbar unter dem Messias vorstellte. Von dem Messias im Sinne der jüdischen Erwartungen musste man politische Befähigung und Macht erwarten. Wie anders sollte er die nationale Befreiung herbeiführen können?
Das Neue Testament schildert uns Jesus dagegen als einen Menschen ohne jegliche Anzeichen direkten politischen Engagements, geschweige denn politischer Macht. Wie sollte eine so unscheinbare Gestalt – und seine Anhänger waren auch nicht beeindruckender –, wie sollte eine so unscheinbare Gestalt die Befreiung des Volkes von politischer Unterdrückung und täglicher Not herbeiführen und damit dem Reich Gottes unter den Menschen den Weg ebnen? Wenn Jesus – wie vor ihm Johannes – den Anbruch des Reiches Gottes verkündete, konnte das von vielen nur mit ungläubigem Staunen oder Verärgerung zur Kenntnis genommen werden.
Und da erzählt nun Jesus dieses Gleichnis. „Seht euch doch mal den Bauern an: Der sät die kleinen unscheinbaren Samenkörner aus. Und was tut der Bauer dann? Er legt sich hin und schläft. Tage und Nächte vergehen. In dieser Zeit geht der Same auf und wächst ohne weiteres Zutun des Bauern. Der Halm kommt heraus, dann die Ähre, schließlich ist der ganze Weizen da.“ Wer hätte es dem unscheinbaren Saatkorn angesehen, dass da so etwas bei herauskommen würde, eine volle Frucht?! Und wer hätte gedacht, dass trotz der Untätigkeit des Bauern so etwas Wunderbares wie dieser Weizen entsteht? Aus dem kleinen Unscheinbaren entfaltet sich Großes, Leben Spendendes. Und all dies ohne Zutun des Menschen dank einer anderen, von Menschen unabhängigen Kraft.
Dieses Gleichnis schildert Jesus, um etwas über sich selbst und sein Wirken auszusagen. Mit diesem Gleichnis will Jesus das Argument derjenigen entkräften, die behaupten, er könne nicht der Messias sein, weil er nicht die entsprechende äußere Erscheinung abgebe, nicht mit äußerer Macht versehen sei und es ihm an politischem Handeln mangele. Positiv formuliert will Jesus mit dem Gleichnis sagen: Das, was da durch ihn in dieser Welt ausgesät wird, das bloße Wort, ist so unscheinbar wie die Saat des Bauern. Aber Großes wird daraus erwachsen. Und sein – Jesu – Verhalten, das Predigen und Heilen mag denen, die das Reich Gottes mit eigenen Händen bauen wollen, der Untätigkeit des Bauern vergleichbar erscheinen.
Aber, man wird am Ende sehen: Das Reich Gottes entsteht ohne menschliches Zutun.
Mit diesem Gleichnis hat Jesus ein starkes Argument in der Hand. Es widerspricht zwar der Veranlagung vieler Menschen, einfach geduldig zu warten auf das, was man so sehr ersehnt. Da möchte man schon lieber selbst Hand anlegen, um den Erfolg zu garantieren. Und wo Großes angekündigt wird, möchte man die entsprechenden überzeugenden Zeichen sehen. Aber mit seinem Beispiel aus der Natur macht Jesus deutlich, dass es auch anders geht. Zuversicht ist auch ohne großartige Zeichen begründet, und geduldig zu warten wird sich letztlich lohnen.
Vielleicht hat Jesus mit diesem Gleichnis nicht jene überzeugen können, die von ihm ohnehin nichts wissen wollten und mit ihm nichts anfangen konnten. Ein Zelot wird sich in seinem Eifer vielleicht nicht gerne haben bremsen lassen. Aber diejenigen, die Jesus nahestanden, deren Erwartungen sich auf ihn richteten, die aber doch immer auch wieder in Zweifel gerieten, ob er wohl der Richtige sei, der Messias, der Christus, für sie konnte dieses Gleichnis eine Stärkung sein. Sie konnten mit diesem Gleichnis ihre eigenen Zweifel und den kritischen Anwürfen der anderen entgegentreten. Für die Urgemeinde war dieses Gleichnis umso wichtiger, als sich die volle Entfaltung des Reiches Gottes weiter verzögerte. Die ersten christlichen Gemeinden waren sehr auf die Geduldsprobe gestellt. „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!“, hatte Jesus wie zuvor Johannes seinen Mitmenschen zu gerufen. Und nun waren schon Jahrzehnte vergangen und noch immer ließ das Reich Gottes auf sich warten. Da mussten schon Zweifel aufkommen. Und die feindselige Umwelt tat ein Übriges, die Zweifel zu nähren. Das Gleichnis war für diese ersten Christen von daher ein notwendiges Bild der Ermutigung, des Trostes, der Hoffnung.
Wir, die wir nun schon fast zwei Jahrtausende weiter sind und immer noch auf das Reich Gottes warten, könnten nun eigentlich völlig entmutigt sein. Aber wir können doch auch feststellen, dass da etwas gewachsen ist. Das Reich Gottes ist wahrhaftig noch nicht auf Erden etabliert. Da ist der Friede im Sinne der jüdischen und christlichen Endzeiterwartung zwar noch nicht zu finden, nicht in Israel, noch sonst wo auf der Welt. Er hat sich auch bisher durch keinerlei Aktivitäten herstellen lassen. Aber die Saat, die da mit Jesus in unsere Welt ausgestreut worden ist, ist dennoch aufgegangen. Da ist in diesen fast zwei Jahrtausenden etwas gewachsen trotz vielerlei Widerstände, auch trotz vielerlei Schläfrigkeit. Das Wort Gottes, wie es durch Jesus in die Welt gekommen ist, hat sich ausgebreitet. Es ist unauslöschlich in unsere weltweite menschliche Gemeinschaft eingepflanzt.
Und da wächst es. Wir haben noch nicht die volle reife Frucht zu sehen bekommen. Die Person Jesu lässt uns allerdings ahnen, wie die Vollendung aussehen könnte. Er ist in seiner Person ein vorweggenommenes Abbild des Reiches Gottes. In ihm ist der Friede verwirklicht, den wir für die ganze Welt ersehnen. Seine Art ist in der Welt lebendig geblieben. Sein Geist lebt fort. Da wird wohl nirgendwo ein Mensch zu finden sein, wie Jesus einer war. Aber in vielen Menschen ist doch der Geist Jesu am Werke, tröstet und stärkt und gibt Kraft, Gutes zu tun.
Wie viele Menschen haben in trostlosen und hoffnungsvollen Situationen zum Neuen Testament gegriffen?! Wie viele Menschen haben nach enttäuschenden Erfahrungen auf Jesus geschaut und haben sich verwandeln lassen, haben sich befreien lassen von dem belastenden Druck der Erfahrungen und haben sich stärken lassen durch seine Verheißungen?! Wie viele Menschen haben sich dank der Worte Jesu von der Vergeltung zur Vergebung bekehrt, von der Gleichgültigkeit zur Barmherzigkeit, vom Hass zur Liebe, von der Verzweiflung zur Hoffnung?! Unsere Welt ist in vielfacher Hinsicht zwar weiterhin voller Schrecken. Aber die Spuren dessen, der die gute Saat ausgestreut hat, sind doch überall zu finden. Die Saat ist aufgegangen. Zarte Pflänzchen überall.
Wir müssen wohl in langen Zeiträumen denken. Das haben Christen lernen müssen. Und Geduld ist weiterhin angesagt. Wenn wir bedenken, dass von einer so unscheinbaren Gestalt wie Jesus und von so allzu menschlichen Gestalten wie seinen Jüngern die Kraft der Liebe Gottes doch auf so viele Menschen gekommen ist über so viele Jahrhunderte hinweg, dann dürfen wir die Aussage des Gleichnisses Jesu wohl bestätigen: Aus Unscheinbarem ist Großes gewachsen; und wir dürfen zuversichtlich sein, dass das Wachsen weitergeht, bis die Frucht reif ist.
Für uns hat sich Jesus als der Messias, der Christus erwiesen. In seiner Person hat das Reich Gottes seinen Anfang genommen. Wir leben auf die Vollendung hin in der Kraft seines Geistes.
Dieser Schuldspruch ist ein Freispruch
8. März 1987
Invokavit
(1. Sonntag in der Passionszeit)
Bethlehemkirche
1. Mose 3,1-19
Die Sündenfallgeschichte gehört zu den bekanntesten biblischen Geschichten. Sie ist leicht nachzuerzählen, weil sie so anschaulich und so konsequent in ihrem Gedankengang ist. Sie bietet aber, obwohl sie so einfach erscheint, eine Menge Ansatzpunkte zum Nachdenken und zur Diskussion. Wir müssen uns für die kurze Zeit der Predigt auf einen Gedanken beschränken. Wir stehen ja nun vom Kirchenjahr her gesehen am Beginn der Fastenzeit, der ernsten Vorbereitung auf Karfreitag und Ostern. Da legt es sich nahe, die Sündenfallgeschichte auf das hin abzuhören, was sie uns über die menschliche Schuld zu sagen hat.
Helmut Thielicke, der bekannte Hamburger Theologe, spricht in seinem Buch „Mensch sein, Mensch werden“ von dem großen Verschiebespiel, durch das Adam und Eva sich von ihrer Schuld zu befreien suchen. Als Gott Adam fragt: „Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe?“, antwortet Adam: „Die Frau, die du mir beigesellt hast, hat mir von dem Baum gegeben, und so habe ich gegessen.“ Adam versucht, die Schuld von sich abzuschieben – zunächst auf die Frau. Aber in dem er sagt: „Die Frau, die du mir beigesellt hast“, schiebt er letztlich die Schuld auf Gott; denn er ist es, der die Frau für ihn geschaffen hat.
Die Frau ist ihrerseits auch nicht bereit, die Schuld auf sich zu nehmen. Sie gibt sie an die Schlange weiter: „Sie hat mich verführt“, sagt sie, „und so habe ich gegessen.“
Wir könnten dieses Verschiebespiel noch weiterführen. Wenn Gott noch die Schlange gefragt hätte: „Warum hast du die Frau verführt?“, was hätte sie wohl geantwortet? Vielleicht mit dem Hinweis darauf, dass Gott selbst sie schließlich mit der gespaltenen Zunge ausgerüstet und ihr den Geist der Verführung mit auf den Weg gegeben hat. So würde dann wiederum die Schuld letztlich bei Gott selbst liegen.