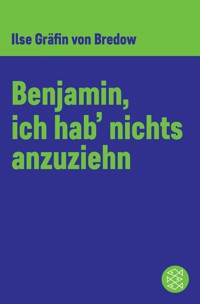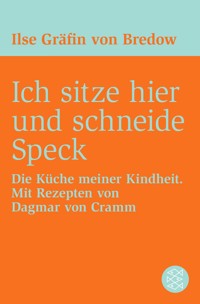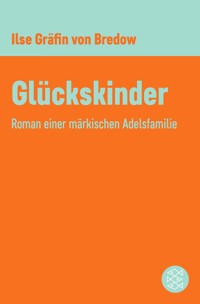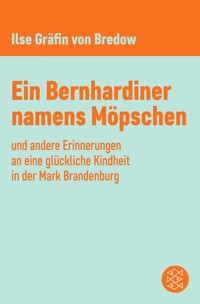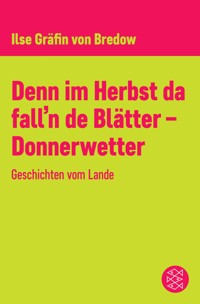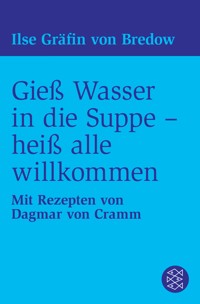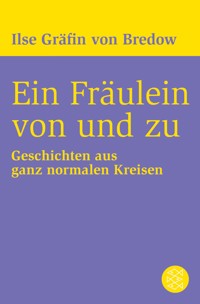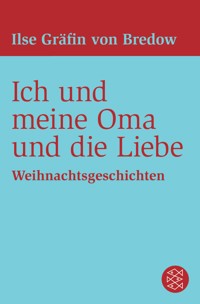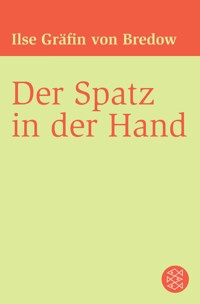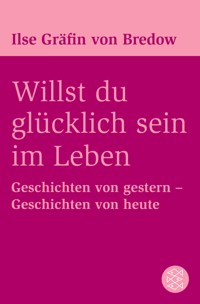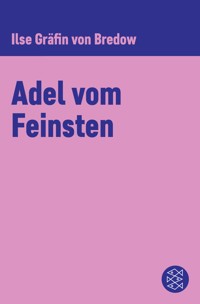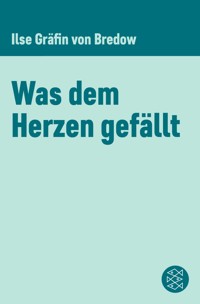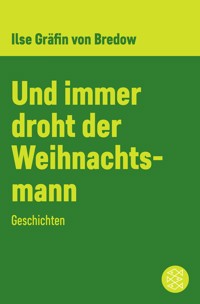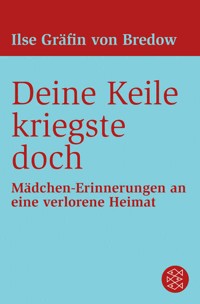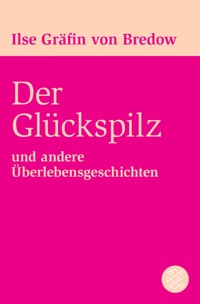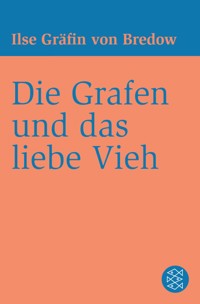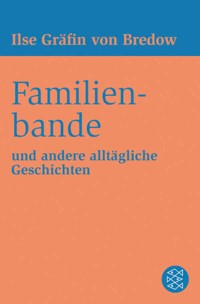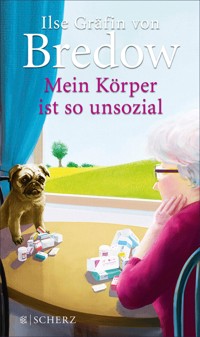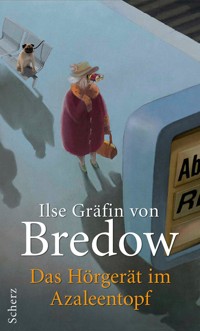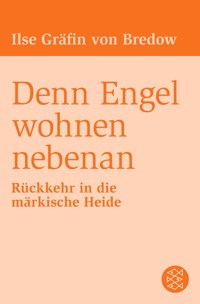
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
›Kartoffeln mit Stippe‹ - das war die unvergesslich schöne, an Erinnerungen reiche Jugendzeit eines Mädchens: das Leben einer gräflichen Familie in einem höchst ungräflichen Forsthaus in der märkischen Heide. Der weltpolitische Umbruch hat es möglich gemacht, dass die große Erzählerin Ilse Gräfin von Bredow an den Ort ihrer Kindheit und Jugend zurückkehrte. In einer einzigartigen Mischung aus Erinnerung und Gegenwart, aus verlorener Zeit und neuer Begegnung dehnt sich ein Panorama von Lebensläufen und Schicksalen, wie es nur jemand schreiben kann, der das alles erlebt, erlitten - und erfühlt hat. Vor unseren Augen entsteht wieder die Welt jener Figuren, die wir in ›Kartoffeln mit Stippe‹ kennen und lieben gelernt haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ilse Gräfin von Bredow
Denn Engel wohnen nebenan
Rückkehr in die märkische Heide
Über dieses Buch
‹Kartoffeln mit Stippe› – das war die unvergesslich schöne, an Erinnerungen reiche Jugendzeit eines Mädchens: das Leben einer gräflichen Familie in einem höchst ungräflichen Forsthaus in der märkischen Heide.
Der weltpolitische Umbruch hat es möglich gemacht, dass die große Erzählerin Ilse Gräfin von Bredow an den Ort ihrer Kindheit und Jugend zurückkehrte. In einer einzigartigen Mischung aus Erinnerung und Gegenwart, aus verlorener Zeit und neuer Begegnung dehnt sich ein Panorama von Lebensläufen und Schicksalen, wie es nur jemand schreiben kann, der das alles erlebt, erlitten - und erfühlt hat.
Vor unseren Augen entsteht wieder die Welt jener Figuren, die wir in ‹Kartoffeln mit Stippe› kennen und lieben gelernt haben.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Nicole Lange, Darmstadt
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490758-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
«Wer nicht den Himmel unten fand, verfehlt auch oben ihn, denn Engel wohnen nebenan, wohin wir immer ziehn.»
Emily Dickinson
1
Es ist ein strahlender Junitag. Der Sommer ’94 hat vielversprechend begonnen. Wir sitzen hinter Luzie Trägenapps Haus im Garten, von dem man einen weiten Blick über die angrenzende Wiese und über ein Stück vom Witzker See hat, und bewundern ihre Blumen. Rittersporn, Löwenmäulchen, Vergißmeinnicht und Levkojen. Luzie klagt über die Quecken mit ihren langen Wurzeln. Sie sind anscheinend sowenig auszurotten wie die Mücken, die meine Vorfahren hier schon vor sechshundert Jahren plagten, als die Bredows dem Teufel im Flug aus dem Sack purzelten und sich im Havelland verstreuten. Doch im Moment lassen sie uns in Ruh.
«Keine Mücken dieses Jahr? Ich weiß wirklich nicht, was ihr immer habt», sage ich.
«Da hättest du mal vor vier Wochen hier sein sollen», sagt Luzie. Nach anfänglichem Zögern sind ’92 sie und ihr Mann Sigmund Mateke wieder von West-Berlin in das Heimatdorf Lochow zurückgekehrt. Auf dem Trägenappschen Grundstück hat sich das Ehepaar ein Häuschen gebaut. Es waren anstrengende Monate gewesen. «Erinnere mich nicht an diese Zeit», sagt Luzie. Die Großstadt vermißt sie nicht. Sie kann sich kaum noch vorstellen, daß sie es so lange in Berlin überhaupt ausgehalten hat.
«Kunststück», sage ich, «bei dieser Lage!»
Die hohen Bäume vom Nachbargrundstück, unserem ehemaligen Forstgarten, geben angenehmen Schatten. Gerade weht eine leichte Brise, so daß wir die selbstgebackenen Windbeutel und den Ausblick doppelt genießen. Leider ist ein Grasmäher dabei, der Wiesenblumenpracht den Garaus zu machen. Auch einige Rehkitze werden wohl, wie früher, in dem dichten Gras ihr Leben lassen müssen.
Außer meiner Schwester gehören zu Luzies Kaffeegästen auch ihre Schwägerin Genia Mateke, ihre Schwester Ilse und ihr Schwager Arno Mateke. Wir sind sozusagen der letzte Rest der «Eingeborenen», ein Häuflein klein, die meisten von uns inzwischen Rentner und von den üblichen Alterszipperlein geplagt. Trotz der Grenze waren wir immer in Verbindung geblieben, auch mit anderen alten Bekannten aus dieser Gegend, mal mehr, mal weniger, wie es die Lebensumstände gerade so mit sich brachten. Lochow, der früher so idyllische Ort mit seinen wenigen Häusern, hat sich im Laufe der Jahre in Richtung Luch gestreckt. Schöner ist er dadurch nicht geworden. Baracken am Ufer des kleinen Sees, ein ausgebrannter Wohnwagen, ein leerer, allmählich zusammenstürzender Kuhstall der LPG und dicht bei dicht Finnenhütten auf unserer ehemaligen Koppel hinter der Scheune.
Meine Schwester und Luzie haben begonnen, von den beschaulichen Zeiten unserer Kindheit zu reden, von den heißen Sommern, wenn uns der Sand fast die nackten Fußsohlen verbrannte, Frauen und Mädchen im Dorf nur Schlüpfer und eine Kittelschürze darüber trugen und meine Mutter auf dem Flügel das Lied vom Nöck spielte. «Komm wieder, Nöck, du singst so schön, wer singt, kann in den Himmel gehn.» Wir Kinder plärrten: «Anneliese Lohse macht sich in die Hose!» Und nach Feierabend ließ jemand am Witzker See sein Horn klagen: «Schön ist die Jugendzeit, sie kommt nicht mehr.» Das Frühjahr, das sich jedesmal Zeit ließ – «Mein Gott, dieses Jahr wird’s ja wohl überhaupt nicht mehr Frühling!» –, und plötzlich, wie durch Zauberhand, waren die Wiesen voller Sumpfdotterblumen, tummelten sich die Kiebitze über der Wiese, wurde alles wieder grün, und die Waldmeisterbowle brachte uns in Schwung. «Waldeslust, Waldeslust, oh, wie einsam schlägt die Brust.» Die Männer von Luzie und Ilse, die Matekes und ihre Vettern und Kusinen hatten ähnliches erlebt. Auch sie sind auf dem Land groß geworden, erst in Wolhynien und dann im Warthegau, wohin sie nach dem Pakt zwischen Stalin und Hitler umgesiedelt worden waren.
Wir reden darüber, wie Luzies Mutter über den Gartenzaun in Richtung unserer Küche rief: «Erna, bei ’ne Weile Brot holen!» Bäcker Scheer aus Ferchesar kam mit Pferd und Wagen nur einmal in der Woche. Das Brot backte sich das Dorf selbst, im Backofen neben unserer Scheune. Den Backofen gibt es nicht mehr, und die Eiche mit den Hornissen vor Trägenapps Haus ist einem Sturm zum Opfer gefallen. Wir reden dies, wir reden das und verklären die Erinnerungen. Im Winter das Schlittschuhlaufen auf dem Witzker See und den überschwemmten Wiesen. Eine endlose Eisfläche dehnte sich und glitzerte im Mondlicht, während der kalte Ostwind uns ins Gesicht blies. Das Fischen mit Aalpuppen und Netzen, und dann der Schnee, der jedes Geräusch erstickte. An unsere Liese, die Kriegsveteranin aus dem Ersten Weltkrieg, können sich allerdings nur noch meine Schwester und ich erinnern. Vor eine Kette Rodelschlitten gespannt, stampfte sie in einem für einen Kaltblüter erstaunlichen Tempo die Waldwege entlang, angefeuert von Gerhard Karge, der auf dem letzten Schlitten die Trommel meines Bruders schlug, dafür allerdings auch in der Kurve die Balance verlor und umkippte. Gerhard Karge ist inzwischen gestorben, wie schon so viele aus meiner Generation. Dann sind wir beim Adventssingen in unserem Haus angelangt, wo man sich um den Flügel versammelte und die Transparente bewunderte, während meine Mutter Weihnachtslieder spielte.
Mir fällt mal wieder Schauriges ein. «Weißt du noch», sage ich zu meiner Schwester, «der Uhrmacher in den zwanziger Jahren? Der reizende alte Herr, der gütige Onkel, von den Kindern geliebt?»
«Keinen Schimmer», sagt meine Schwester abwehrend. Sie ahnt, was kommt, und sieht ihre Kindheit gern als eine heile Welt.
«Das weißt du nicht mehr?» frage ich ungläubig. «Er hat den Bauern die Uhren repariert und so ganz nebenbei mehrere Kinder umgebracht. Auf unseren Streifzügen im Wald haben wir uns mit dieser Geschichte gegenseitig gegruselt.»
«Typisch», sagt meine Schwester. «An so was erinnerst nur du dich. Paß auf, du kleckerst.»
Irritiert sehe ich auf das Tischtuch. «Wo denn?» Ich schiebe den Teller beiseite. Tatsächlich, ein Obstfleck.
«Macht doch nichts», sagt Luzie.
«Du warst schon immer eine Kleckerliese», sagt meine Schwester. Sie ist fast fünfundsiebzig und ich fast zweiundsiebzig, aber die geschwisterlichen Reibereien funktionieren immer noch.
«Noch jemand Kaffee?» fragt Luzie und, vorwurfsvoll: «Ihr eßt ja gar nichts. Greift doch zu!» Das Aufheulen eines Motors läßt uns zusammenzucken. Ein BMW-Fahrer mit Berliner Kennzeichen verwechselt offensichtlich den Plattenweg mit der Autobahn und gerät prompt ins Schleudern. Fast landet er in Luzies Gartenzaun. Entrüstet drehen wir uns nach ihm um. Es ist immer dasselbe mit den Städtern. Und schon fällt mir wieder ein: «Schlimmer als Rüsselkäfer und Waldbrände zusammen!» Alles wie gehabt. Auch das Elternhaus, das uns nun wieder gehört. Nikolai Kolbatsch, der Onkel von Sigmund und Arno Mateke, hat es uns zurückgegeben. Er stammte aus der Ukraine und war mit seiner Familie seit ’40 bei uns. Nach der Enteignung war ihm als Siedler das Grundstück zugeteilt worden. Doch von Anfang an hatte er es nie als sein Eigentum betrachtet und auch bis zu seinem Tode keinen Hehl daraus gemacht, daß er es uns wieder überlassen würde.
«Stimmt», sagt Sigmund, Luzies Mann. «Er hat immer gesagt: ‹Die Grafen kommen wieder. Ist doch ihr Land, oder nicht?› Und er hat sein Versprechen gehalten.»
«Zuletzt hat er auch nicht mehr leben wollen», sagt Luzie. «Seitdem Tante Olga gestorben war, hat er sich ganz in sein Haus verkrochen. Nicht mal mehr den Garten hat er zum Schluß bestellt. Und den Hund hat er auch weggegeben.»
«Glaubst du, daß er sich nach seinem Hof in der Ukraine gesehnt hat?» frage ich.
«Zu Anfang vielleicht nicht, aber zum Schluß, glaub ich, schon.» Wir schweigen. Eine Gedenkminute für Nikolai Kolbatsch. Auch der Grasmäher schweigt. Bleierne Hitze liegt jetzt über dem Land. Für kurze Zeit herrscht Stille. Es ist die Stunde der Roggenmuhme, vor der man uns Kindern angst machte, damit wir nicht durchs Getreide liefen und alles zertrampelten. Nikolai müssen unsere spärlichen Erträge ärmlich vorgekommen sein gegen das, was er auf seinem Hof in der Ukraine geerntet hatte, der Kornkammer Rußlands, wie es hieß.
«Der Onkel Kolla war so ein Mensch», sagt Arno Mateke, Luzies Schwager, und beginnt in seiner bedächtigen Weise, den Onkel zu beschreiben, da bringt ihn ein voll aufgedrehtes Autoradio zum Verstummen, das «Katzenklo, Katzenklo macht jede Katze frisch und froh» oder so ähnlich plärrt, so daß Arnos Promenadenmischung, die heute mal nicht ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgeht, die Schwalben auf den Telefondrähten anzubellen, kläffend aus dem Hof hinter dem Auto herwetzt.
«‹Katzenklo, Katzenklo›, so was Hirnrissiges», lache ich. Aber dann fällt mir ein, daß die Schlager in meiner Kindheit auch nicht viel geistreicher waren: «Es war einmal ein Teddybär, der blies Trompete und noch mehr. Und war man zu ihm grob und barsch, dann blies er den Radetzkymarsch. Oh, Mona!»
«Dreihundert Autos haben wir an einem Wochenende gezählt», sagt Sigmund, «das kann ja noch heiter werden.» Und meine Schwester fügt hinzu: «Gott erhalte uns den Plattenweg.»
«Auf dem man nicht mal radeln kann», ergänze ich bedauernd.
«Da hättest du mal hier sein sollen, als die Russen das Luch noch als Übungsgelände für ihre Panzer benutzten», sagt Ilse Mateke und fügt ohne Übergang hinzu: «Am 24. April ’45 seid ihr weggemacht. Ich weiß es noch wie heute. Vier Tage nach Adolfs Geburtstag. Dein Vater ist noch zu meiner Mutter gekommen und hat gesagt: ‹Frau Trägenapp, geben Sie mir lieber Ihre Mädchen mit. Es wird schlimm werden.› Aber Mutter wollte nicht. Sie konnte sich nicht von uns trennen.»
2
Ich erinnere mich. Nachdem ich mich von der Wehrkreis-Reit- und -Fahrschule abgesetzt hatte und auch meine Schwester, die im Herbst ’44 einen Vetter von uns geheiratet hatte, wieder in Lochow war und die Front allmählich näher und näher rückte, stand Vaters Entschluß, Lochow zu verlassen, fest. Ein Wagen wurde für die Flucht vorbereitet, Kisten und Koffer wurden gefüllt, und wir konnten uns nicht einig werden, was am wichtigsten zum Mitnehmen war. Auf jeden Fall einige Erinnerungsstücke, an denen unsere Herzen hingen, darunter auch der zerbeulte Serviettenring meines Bruders, den er zur Taufe bekommen hatte.
Nachdem wir Kisten und Koffer auf dem Treckwagen verstaut hatten, sich, o Wunder, auch das Oktavheftchen, in dem jeder Gegenstand verzeichnet war, wiederfand und das Haus in dem ganzen Durcheinander die Gemütlichkeit eines Güterwaggons ausstrahlte, hatte es sich Vater plötzlich anders überlegt. Wie sollte Nikolai ohne Pferde die Frühjahrsbestellung machen? Auch würde es womöglich heißen, wir hätten uns aus dem Staube gemacht und den Leuten keine Chance gegeben, mit ihren Kindern wegzukommen.
So wanderte alles wieder zurück in Schränke und Kommoden, und nur meine Mutter fuhr mit dem Treck einer befreundeten Familie voraus. Wir wollten mit den Rädern nachkommen und uns mit ihr, wie es die Situation ergab, entweder in Niedersachsen bei entfernten Verwandten oder in Schönweide, einem Gut in Holstein, treffen.
Am 23. April verwöhnte uns der Staat noch mit einer Sonderration Zucker, die ich aus Rathenow holen mußte. Ich war noch nicht ganz aus der Stadt heraus, da begann die Eisenbahnflak zu schießen. Die Granatsplitter prasselten nur so durch die Bäume, als führe ich durch einen Platzregen. In der Nacht vom 23. zum 24. hörten wir es zum ersten Mal, dieses malmende Geräusch von Panzern. Mein Vater, der es vorher nicht so eilig gehabt hatte, drängte jetzt sehr. Er setzte sich mit meinem Onkel in Stechow in Verbindung, dessen Treck wir uns anschließen wollten. Wir packten unsere Rucksäcke und füllten unsere Feldflaschen mit Rotwein. An den Lenkstangen der Fahrräder befestigten wir Stallaternen.
Möpschen, unseren Bernhardiner, konnten wir nicht mitnehmen. Er war nicht mehr der Jüngste und schon ziemlich steifbeinig. Er wedelte nur kurz, als wir ihn streichelten, zu sehr war er mit der Blutwurst beschäftigt, die wir ihm spendiert hatten. Nikolai würde sich um ihn kümmern.
Wir gingen noch einmal durchs Haus. Waren die Fenster auch verschlossen? Die Schränke sollte man lieber offen lassen, hatten wir gehört. Die würden doch nur aufgebrochen. Während wir von Zimmer zu Zimmer gingen, fühlten wir uns ein bißchen verlegen. Waren wir nicht überängstlich? Friedrich der Große in Öl über Vaters Schreibtisch blickte verächtlich. Das wollten nun Preußen sein. Im Flur zog ich noch einmal Großmutters Spieluhr auf. Vier Porzellanpüppchen im Rokokokostüm, die in einer Rosenlaube auf zierlichen Stühlchen an einem gedeckten Tisch saßen, hoben die Tassen und bewegten ihre Köpfe zu dem Menuett von Boccherini. So saßen und nickten sie wohl noch, als wir uns auf dem Hof vom Dorf verabschiedeten. Wir machten es kurz. Dann radelten wir davon, mit unseren beiden Hausmädchen Irmchen und Erna und dem jungen Münsterländer Buschi.
Schon auf dem Weg nach Ferchesar hatte Erna nach zwei Kilometern die Nase voll und wollte am liebsten wieder umkehren. «Mein Nähzeug hab ick ooch vergessen.» Vater wurde ungehalten. «Seien Sie nicht albern. Los, los, wir müssen uns beeilen!» Erna fügte sich mit muckschem Gesicht.
«Mensch, Erna», sagte ich tröstend. Mit unseren Köchinnen und Hausmädchen hatten wir Kinder immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Sie vertuschten unsere kleinen Sünden und ergriffen unsere Partei, vor allem, wenn sie sich über meine Mutter geärgert hatten. Irmchen und Erna waren die letzten einer langen Reihe. Mit Erna standen meine Schwester und ich auf besonders vertrautem Fuß. Wir waren fast im selben Alter, lasen dieselben Bücher, sangen dieselben Schlager und radelten, wenn irgend möglich, mit ihr ins Kino oder gingen, mit Möpschen im Gefolge, gemeinsam baden. Erna stammte aus Witzke. Ihr Vater betreute die Pumpwerke am Kanal und war Jagdaufseher bei den Jagdpächtern. Nebenbei betrieben ihre Eltern eine kleine Landwirtschaft.
In Ferchesar war von Aufbruch nichts zu merken. Aber auf dem Weg von Ferchesar nach Stechow sah man bereits in östlicher Richtung eine riesige Rauchwolke und das Mündungsfeuer der Artillerie. Auf dem Gut meines Onkels Wilhelm Bredow wartete der Treck schon auf uns. Wir verstauten unsere Rucksäcke, und dann setzten sich die Wagen in Bewegung. Wir, auf unseren Rädern, bildeten das Schlußlicht.
Die Straße nach Rathenow war völlig verstopft, von flüchtendem Militär, endlosen Kolonnen von Ostflüchtlingen auf ihren Treckwagen und vielen kriegsgefangenen Russen, die wenig Lust zu verspüren schienen, sich von ihren Landsleuten befreien zu lassen. Im Wald links und rechts der Straße hatte deutsche Artillerie bereits Stellung bezogen, um die Stadt zu verteidigen. Rathenow selbst wirkte von einem Tag auf den anderen völlig verändert, was nicht an dem vielen Militär und den Flüchtlingen lag. Daran waren wir gewöhnt. Es war das Entsetzen, das die Mauern der Stadt auszuschwitzen schienen, die Angst vor dem, was ihr bevorstand.
Wir passierten die Havelbrücke und kamen gegen Morgen in Briest an, einem kleinen Ort etwa fünfzehn Kilometer von Rathenow Richtung Elbe. Dort machten wir erst mal halt, um die Pferde zu füttern und selbst zu frühstücken.
Meine Erinnerung an diese Zeit hat große Lücken. Ich weiß nur noch, daß wir uns einmal, vor Tieffliegern Schutz suchend, voller Panik zu viert in eine Telefonzelle drängten, während mein Vater auf einer Anhöhe saß und ganz entrückt zusah, wie sie zwei Kilometer von uns entfernt eine kleine Brücke in die Luft jagten. Als er merkte, wohin wir geflüchtet waren, erhob er sich und holte uns dort raus. «Was soll denn der Unsinn?»
In Klietznick, nicht weit von der Elbe, hatten wir, auf der Suche nach einem geeigneten Nachtquartier, erschöpft auf einer kleinen Anhöhe haltgemacht und uns unter einem Schild für einen Augenblick ausgeruht. «Was steht da eigentlich drauf?» fragte meine Schwester schläfrig. Und Erna sagte: «Achtung, Feindeinsicht!» Da gab es auch schon ein merkwürdiges Sausen und Rauschen, und wir rannten, Buschi hinter uns herzerrend, in Deckung. Wir waren unter Artilleriebeschuß geraten. Zum Glück waren die Pferde ausgespannt. Aber einige Flüchtlinge wurden leicht verletzt und einer unserer Treckbegleiter von einem Splitter am Hals getroffen.
Nach diesem Erlebnis zogen wir es vor, im Wald zu übernachten. Aber an Schlaf war nicht zu denken. Es war hundekalt, und die Angst hatte uns voll im Griff. Obwohl die meisten von uns nach fünf Jahren Krieg auf solche Schrecken nicht ganz unvorbereitet waren, nützte das jetzt wenig. Glücklicherweise ist Angst nicht steigerbar. Da gibt es keinen Unterschied, ob es Krieg ist oder Frieden. Dafür bekamen wir sehr schnell, wie die anderen Flüchtlinge auch, einen Instinkt für die Gefahr. Am 25. April, gegen Morgen, hörten wir die Sirenen von Rathenow Feindalarm geben. Jede Überlegung, ob es nicht vielleicht doch besser war, wieder umzudrehen, konnten wir also vergessen.
Ich weiß auch nicht mehr, wie es mein Vater und mein Onkel schafften, mit Hilfe eines Parlamentärs mit den Amerikanern auf der gegenüberliegenden Seite der Elbe Kontakt aufzunehmen und, ebenso wie das Lazarett aus Jerichow, in dem sich viele verwundete amerikanische Kriegsgefangene befanden, die Genehmigung für den Treck zum Übersetzen zu erhalten. Der Treck war inzwischen bei einem Bauern in Klietznick untergekommen und zog am 26. April, vormittags, zum Elbufer, gefolgt von einem endlosen Troß von Flüchtlingen, voran ein Träger mit der weißen Fahne. Doch am anderen Ufer bei den Amerikanern rührte sich nichts. Einige Männer versuchten ihr Glück, auf eigene Faust hinüberzurudern, wurden aber sofort von den Amerikanern heftig beschossen und mußten wieder umkehren.
Erna und ich beschlossen daraufhin herauszufinden, wo der Übernahmeplatz des Lazaretts war. Vielleicht gab es ja dort eine Chance. Wir radelten im Schutze des Deichs in Richtung Jerichow und schauten ab und zu über die Krone, aber von Kähnen oder Fähren war nichts zu sehen. Als der Wiesenweg endete und wir unsere Räder über die Wiese in einen kleinen Wald schoben, begann die Artillerie wieder, sich auf uns einzuschießen. Auf dem Weg nach Jerichow kamen wir an unzähligen Unterständen der Wehrmacht vorbei, gefüllt mit Panzerfäusten, Patronentaschen, Karabinern, Stahlhelmen und Tellerminen. Dann sahen wir ein Hausdach durchs Gebüsch leuchten. War das schon Jerichow? Aber es war nur ein einzelnes Gehöft. Haus- und Stalldach waren ziemlich zerschossen. Da aber auf einer Holzmiete einige Wäschestücke hingen, mußte wohl hier noch jemand wohnen. Wir pirschten uns langsam näher und hatten das Haus fast erreicht, als wir plötzlich einem Amerikaner gegenüberstanden. Er sprach etwas Deutsch, so daß wir uns gut verständigen konnten. Wir versuchten herauszubekommen, wann und wo die Übernahme des Lazaretts erfolgen sollte. Aber er zuckte nur die Achseln. So kehrten Erna und ich zu unserem Treck zurück.
Allmählich glich das Elbufer einem riesigen Heerlager. Von den zugesagten Fähren war immer noch nichts zu sehen. Dafür kamen einige Amis herübergerudert, stolzierten zwischen den Flüchtlingen herum und sparten nicht mit höhnischen Bemerkungen in gebrochenem Deutsch. Erna war ganz empört. «Wie kommen eigentlich diese Lackaffen dazu, unsere Wehrmacht schlechtzumachen?» Zwei Nächte froren und klapperten wir an der Elbe vor uns hin. Dann hieß es plötzlich: Franzosen! Ehemalige französische Kriegsgefangene seien die einzige Chance, hinübergelassen zu werden. Jeder machte sich auf die Suche. Aber die Handvoll Franzosen, die sich unter den Flüchtlingen befand, war schnell vergriffen. Zuerst waren sie über das plötzliche Interesse an ihrer Person ganz perplex. Aber dann, als sie begriffen, um was es ging, wurden sie sehr wählerisch. Sie suchten sich die hübschesten Mädchen zum Beschützen aus. Wir gehörten nicht dazu.
Schließlich gaben wir auf. Vater beschloß, sich mit uns von dem Treck meines Onkels zu trennen und sich über Neumarkt, Havelberg, Sandau, Perleberg, Ludwigslust und Schwerin Richtung Lübeck durchzuschlagen. Das hieß, wir mußten erst einmal wieder fast bis Rathenow zurück, und wir wußten nicht, ob die Russen dort bereits einmarschiert waren. Doch noch immer wurde, in diesem Fall zu unserem Glück, um Rathenow gekämpft.
Zwei unserer Räder waren uns inzwischen gestohlen worden, und so mußten wir teils zu Fuß, teils per Anhalter weiter. Hatten wir uns eingebildet, schlimmer als die letzten Tage könne es nicht kommen, wurden wir schnell eines Besseren belehrt. Das Chaos auf den Straßen war nicht mehr zu überbieten. Von den Tieffliegern zusammengeschossene Trecks, ineinander verkeilte Militärfahrzeuge, flüchtende Soldaten und halbe Kinder in Uniform, die unter der Anleitung eines Leutnants ein Flakgeschütz in Stellung brachten. Die Dorfbewohner gingen fast mit der Mistgabel auf den jungen Offizier los. «Hau bloß ab, du Dussel! Soll auch hier alles in Schutt und Asche gehen?» Der Leutnant verstand die Welt nicht mehr. «Ich will Sie doch nur schützen!»
Besonders eilig hatten es die Repräsentanten des Tausendjährigen Reiches. Sie schafften sich mit schneidigen Kommandos rücksichtslos Platz, ungerührt von dem Anblick der an Chausseebäumen aufgehängten Soldaten, die Schilder um den Hals trugen: «Wer den Tod in Ehren fürchtet, stirbt ihn in Schande.» Die Tiefflieger waren überall. Mal ging ein Munitionszug auf einem Bahnhof in die Luft, mal schossen sie ein Dorf in Brand. Erst die Dunkelheit gab wieder so etwas wie Sicherheit. Sehnsüchtig wartete jeder, von einem Auto mitgenommen zu werden, und kaum hatte man es geschafft, mußte man nach ein paar Kilometern schon wieder aussteigen, weil das Benzin ausgegangen war. Verwundete, die man kurzerhand auf die Straße gesetzt hatte, versuchten, sich mit letzter Kraft an bereits überfüllten Lastwagen hochzuziehen. Man schlug ihnen so lange auf die Finger, bis sie losließen. Niemand kam ihnen zu Hilfe, auch wir nicht. Wir waren zu sehr mit dem eigenen Überleben beschäftigt. Unsere Wünsche schrumpften zusammen. Sie beschränkten sich nur noch auf Essen, Trinken, Schlafen. Wohlig räkelten wir uns in einem Pferdestall auf trockenem Mist, und auch einen Schweinestall empfanden wir als ein durchaus passables Quartier. Als am 30. April jemand im Dunkeln der auf einen Weitertransport wartenden Menge mit getragener Stimme Adolf Hitlers Tod mitteilte, erweckte er damit dieselbe Aufmerksamkeit wie bei einem überfahrenen Huhn. Und Erna lamentierte weiter über ihren Rucksack mit den zwei Broten, den sie irgendwo stehengelassen hatte.
Einer Kusine von uns war es nach der Flucht ähnlich ergangen. Glücklich darüber, der Hölle entronnen zu sein, nahm sie am 2. Mai diese Nachricht im Radio vollkommen unbeteiligt zur Kenntnis und ging laut pfeifend den Flur ihrer Gastgeber entlang. Darüber war der Hausherr aufs tiefste schockiert. «Stellt euch vor, er hatte sich sogar einen schwarzen Schlips umgebunden!»
Obwohl wir dauernd getrennt wurden, weil wir nur noch drei Räder besaßen und immer zwei von uns sehen mußten, auf irgendeinem Fahrzeug Platz zu bekommen, fanden wir uns jedesmal an den verabredeten Treffpunkten wieder zusammen. So auch in einem Café am 1. Mai in Lübeck. Da Erna und ich vor Müdigkeit zweimal unterwegs vom Rad gefallen waren, suchten wir erst einmal Quartier, um ein paar Stunden Schlaf zu bekommen. Eine Familie mit zahllosen Kindern zeigte für unsere Lage großes Verständnis, obwohl sie selbst recht beengt wohnte, und überließ uns ihre Betten.
Am Morgen machten wir uns weiter auf den Weg Richtung Eutin. Ein Lkw nahm uns samt Fahrrädern bis Schwartau mit. Im ersten Gehöft versuchten wir im Stockdunkeln in einer überfüllten Scheune Quartier zu finden. Zähneklappernd hockten wir auf der Diele, mit dem Rücken gegen die Wand. Als wir nach oben klettern wollten, um uns ins Stroh zu legen, wurden wir barsch angefahren: «Bleibt bloß unten, hier ist kein Platz mehr!» Buschi bellte fast ununterbrochen. Und so schlichen wir durch den strömenden Regen in den Kuhstall.
Am nächsten Morgen trennten wir uns. Diesmal sollten Erna und ich samt Buschi per Anhalter weiterfahren. Mittags gegen drei Uhr hatten wir endlich Glück. Ein Lkw mit Anhänger hielt an und wurde von Flüchtlingen gestürmt. Aber erst als wir oben waren, sahen wir, was er geladen hatte: Munition, Benzinfässer, Kisten mit Handgranaten und Panzerfäusten. Kaum waren wir ein paar Kilometer gefahren, tauchten Tiefflieger auf. Wir sprangen hinunter und suchten in dem nahegelegenen Wald Schutz. Das ging so fünfmal. Beim nächsten Tieffliegerangriff brannte schon das Fahrzeug vor uns, und ich sah aus der Munitionskiste, auf der ich mit einem Gefreiten saß, sich blaue Wölkchen ringeln. «Höchste Zeit zum Verduften, Fräulein», sagte der. «Oder möchten Sie auf einer Wolke landen?» Wir warfen unser Gepäck hinunter, aber Erna kletterte noch einmal zurück, weil ein Rucksack fehlte. Es blieb gerade noch soviel Zeit, uns direkt neben dem Wagen in den Chausseegraben zu rollen. Da begann er auch schon zu brennen. Ein Versuch, von dem brennenden Wagen weg über das Feld zu robben, kostete mich fast das Leben. Einer der englischen Jäger erkor mich zum Ziel. Die Maschinengewehrgarbe ging hautnah an mir vorbei. Sie versengte meinen linken Ärmel und durchschlug meinen Rucksack. Die Maschine flog so tief, daß ich das Gesicht des Piloten erkennen konnte. Er mußte längst mitbekommen haben, daß es vor allem Frauen und Kinder waren, auf die er es abgesehen hatte. Aber an Menschenjagd kann man sich schnell gewöhnen. Als er eine Schleife zog, robbte ich in den Graben zurück.
Ein junger Soldat rettete uns das Leben. Er sprang auf den Fahrersitz und fuhr mit dem brennenden Munitionszug los. Nach dreißig Metern flog er mit ihm in die Luft. Stundenlang zischte und krachte es um uns herum. Systematisch schossen die Tiefflieger Fahrzeug um Fahrzeug in Brand oder bombardierten sie. Wir vom Lande hatten bislang für die Bombenflüchtlinge und das, was sie durchgemacht hatten, nur in Maßen Verständnis gezeigt. Ihre Einquartierung wurde als eher lästig empfunden, und die Bürgermeister der Dörfer hatten Mühe, sie unterzubringen. Jetzt waren wir an der Reihe.
Buschi drehte durch. Er biß in Ernas Mantelgurt und zerrte wie ein Verrückter. Weinend irrten Frauen auf der Suche nach ihren Kindern umher und wurden sofort unter Beschuß genommen. In den Einmannlöchern drängten sich vier, fünf Schutzsuchende, ohne Rücksicht auf die unter ihnen Kauernden.
Als es dämmerte, trat endlich Ruhe ein. Jetzt erst sahen wir das ganze Ausmaß der Tragödie. Verkohlte Menschen und Tiere, aufgeplatzte Koffer, deren Inhalt auf dem Acker verstreut war oder in den Bäumen hing.
Gegen elf Uhr nachts erreichten wir Eutin. Die Panzersperren wurden gerade dichtgemacht und an den Straßenbäumen Tellerminen angebracht.
«Mein Gott», sagte ich, «diese Idioten. Jetzt verteidigen sie auch noch die Stadt.»
Wir trotteten durch die menschenleeren Straßen. Die Haustüren waren fest verschlossen, die Fenster verrammelt. Die Stadt duckte sich in Erwartung des Krieges, von dem sie bis dahin verschont geblieben war. Auf der Suche nach einem Quartier wurden wir über den Gartenzaun einer Villa von einem jungen Mädchen angesprochen. «Meine Eltern haben gesagt, ich soll jeden hereinholen, der eine Unterkunft sucht.» Sie öffnete uns die Gartenpforte.
Die Gastfreundschaft in diesem Haus war überwältigend. Es wimmelte von Flüchtlingen, und jeder wurde versorgt, sogar die Soldaten mit Zivilkleidung. Wir durften uns mit Buschi in dem ehelichen Schlafzimmer einquartieren. Kreuz und quer, mit ihm in der Mitte, lagen wir auf den Ehebetten und schliefen tief und fest. Wir wachten nicht einmal auf, als ganz in unserer Nähe eine Panzerfaust explodierte und die Engländer die Kasernen mit Granaten beschossen. Glücklicherweise war, wie wir später erfuhren, Eutin noch rechtzeitig zur offenen Stadt erklärt worden. So waren die Engländer mit ihren Panzern Richtung Plön abgeschwenkt.
Am nächsten Morgen sahen wir uns in der Stadt um, ob vielleicht auch meine Schwester und mein Vater hier gelandet waren. Vergeblich. So machten wir uns zu Fuß auf nach Schönweide, unserem Endziel, zunächst wegen der Tiefflieger auf Nebenwegen bis Malente. Die Dörfer, durch die wir kamen, waren gepflegt, und den Gehöften sah man an, daß hier die Bauern reicher waren als in der Mark. Diese wunderschöne, friedliche Landschaft mit ihren Buchenwäldern und den großen Seen ließ uns das Grauen, das wir erlebt hatten, fast vergessen. Und dann – mitten auf einer Wiese, wie weggeworfener Müll – wieder einmal etwa zwanzig zusammengeschossene Treckwagen und tote Menschen. Das Grauen, die Angst hatten uns wieder eingeholt.
Ganz überraschend kamen uns auf halber Strecke mein Vater und meine Schwester entgegengeradelt. Sie waren schon am Vortage bis Schönweide durchgefahren und so dem Tieffliegerangriff vor Eutin entgangen. Wir verteilten das schwere Gepäck auf die Räder, und am 3. Mai kamen wir gegen Abend bei strömendem Regen auf dem Gut Schönweide an. Man brachte uns im Nachbarhaus des Schlosses, der sogenannten Meierei, unter. Ich teilte mir mit meiner Schwester ein Zimmer.
Nachts hörte ich sie weinen. «Was ist denn?» fragte ich.
«Ich glaube, ich habe die Masern», schluchzte sie. Und so war es auch.
«Immer noch besser als Typhus», versuchte ich sie zu beruhigen.
Mit unserer Ankunft in Holstein war für uns der Krieg praktisch zu Ende und der Tag der endgültigen Kapitulation nur noch ein formeller Abschluß. Trotzdem, am Morgen des 9. Mai war ich früh aufgestanden, um die von den Engländern beschlagnahmte Milch heimlich für uns und die anderen Flüchtlinge abzusahnen. Danach lehnte ich mich, Buschi zu meinen Füßen, gegen die Stallwand und ließ mich von der Morgensonne wärmen. Kein Flugzeug am Himmel, keine Panzergeräusche, keine Detonationen. Es herrschte friedliche Morgenstille, nur ab und zu unterbrochen vom Krähen eines Hahnes und dem Gesang der Lerchen. Die Waffen schwiegen, wie es so pathetisch hieß. Vergessen war, was gerade hinter uns lag. Wir waren noch einmal davongekommen. Nur das allein zählte.
3
Täglich fanden sich auf Schönweide neue Flüchtlinge ein. Bald waren mehr als sechzig Personen zu verpflegen, darunter auch Jungen aus dem Arbeitsdienst, Soldaten und freiwillige Erntehelfer, dazu unsere Gastgeberin und ihre sechs Kinder. Allmählich gingen die alten Kartoffeln zu Ende, und wir lebten vor allem von Kohlrüben, die mal zu Suppe, mal zu Gemüse mit Einbrenne gestreckt wurden. Manchmal brachten uns die Engländer ein Reh oder Wildenten, die wir ihnen zurechtmachen mußten. Sie hatten das Schloß beschlagnahmt und, wie es der älteste Bruder meines Vaters, Onkel Achim, genannt hätte, die Möbel sortiert, das heißt, was sie nicht gebrauchen konnten, kurzerhand aus dem Fenster geworfen. Aber sie trugen auch den älteren Töchtern unserer Gastgeberin galant die Gießkanne, wenn sie am Schloß vorbei zum Friedhof gingen. Fraternisieren, wie das damals hieß, war natürlich streng verboten. Das hielt jedoch einen schottischen Sergeanten nicht davon ab, seine Soldaten direkt vor dem Küchenfenster der Meierei exerzieren zu lassen, um der hübschen blonden Schwägerin der Hausfrau, deren Mann sich noch in Gefangenschaft befand, zu imponieren. Die Hausfrau sah es nicht gern. «Der arme Max», hörten wir sie oft seufzen. Daß wir Flüchtlinge auf der Suche nach Freunden und Bekannten ständig unterwegs waren, stieß bei ihr auf Verwunderung. Das Absahnen der beschlagnahmten Milch dagegen billigte sie durchaus.
Wir versuchten, uns soweit wie möglich nützlich zu machen. Abgesehen von der Hausarbeit halfen wir in der Landwirtschaft, beim Rübenhacken und -vereinzeln und im Garten. Aus Lochow und der Umgegend hörten wir nur Gerüchte. Wie Onkel Achim, der in Tornesch bei Hamburg untergekommen war, uns schrieb, hatten in Görne, dem nur wenige Kilometer von Lochow entfernt liegenden Hauptgut, keine Kämpfe stattgefunden. Und auch in Friesack waren die Russen kaum noch auf Widerstand gestoßen. Wie Onkel Achim schrieb, habe es der Kampfkommandant und Nazistratege nicht besser gekonnt als die Quitzows vor 533 Jahren: Er habe die Burg Friesack auch nicht halten können.
Mein Vater ließ sich von uns nicht abbringen, noch einmal mit dem Rad in die Gegend von Stendal zu fahren, die zu der Zeit noch von den Amerikanern besetzt war. Dort wollte er von einem Freund, der sich noch auf seinem Gut sicher wähnte, Näheres hören. Ganz betreten kehrte er wieder zurück, denn fast wäre er den Russen in die Hände gefallen. Ausgerechnet an diesem Tag waren die Amerikaner in der Nacht abgezogen. Im Laufe der Zeit wurde dieses unerfreuliche Erlebnis, wie in meiner Familie üblich, zu einer skurrilen Episode. Mein Vater habe gerade friedlich auf der Schloßterrasse bei einem Glas Schorle gesessen und der Freund tröstend gesagt: «Wenn ihr wirklich nicht mehr nach Lochow zurück könnt, dann machst du eben bei mir den Wald.» In diesem Augenblick sei der Diener auf der Terrasse erschienen, habe mit diskretem Räuspern auf sich aufmerksam gemacht und gesagt: «Herr Baron, die Russen sind im Park.»
Die einzige Neuigkeit, die Vater über Lochow mitbrachte, war, daß es dort ein großes Russenlager geben sollte.
Im Spätsommer beschlossen wir, nach Niedersachsen überzuwechseln, wo meine Mutter auf einem Gut in der Nähe von Hannover untergekommen war. Mich schickte man als Vorbote los. Dazu verdingte ich mich als Kutscher bei einem großen Treck, der ebenfalls in diese Gegend wollte, da es in Holstein für die Flüchtlinge keine Arbeit gab. Außerdem hatte ich die Aufgabe, während der Fahrt durch die Dörfer bei den Gemeinden die nötigen Lebensmittelkarten zu beschaffen. Es war nicht immer leicht, für die vielen Menschen in den überfüllten Dörfern zusätzlich Quartier zu finden, und ein Teil von uns mußte nachts auf den Wagen schlafen. Zwei-, dreimal wurden wir dabei überfallen. Die Plünderer hatten wohl nur mit Frauen und alten Männern gerechnet, aber in dem Treck hatten sich mehrere aus den Lagern entwichene deutsche Kriegsgefangene versteckt, und so waren die Diebe schnell in die Flucht geschlagen.
Der Inhalt unserer Rucksäcke hatte sich in dieser kurzen Zeit unseres Aufenthaltes in Holstein verdreifacht, woran man sieht, wie schnell sich Besitz vermehrt. Und so überraschte ich meine Mutter bei der Ankunft mit drei vollgestopften Hafersäcken.
Nach der ersten Wiedersehensfreude machten wir einen Rundgang durch unser neues Zuhause, ein wunderhübsches Wasserschloß, dem es jedoch, was ich sofort feststellte, wie allen Schlössern an Klos mangelte. Das Gut gehörte einer alten niedersächsischen Adelsfamilie. Einer der Vorfahren hatte sich nach dem Geschmack der Welfen zu sehr mit den Preußen arrangiert, und es wurde behauptet, noch heute werde sein Grabstein von so manch wackerem, immer noch dem ehemaligen Königshaus ergebenem Niedersachsen verstohlen angespuckt.
Dann stellte mich meine Mutter den drei alten Damen vor, die das Schloß bewohnten.
Vier Wochen später folgte Vater mit Irmchen, und bald darauf fand sich auch meine Schwester mit Erna und Buschi ein. Beide Mädchen fanden Arbeit und Unterkunft auf einem großen Bauernhof, und meine Schwester und ich zogen zunächst ins ehemalige Kavaliershaus des Schlosses. Unser Schlafzimmer lag nach Norden. Ein riesiger Kastanienbaum vor dem Fenster verdunkelte den Raum, die dunkelblaue Tapete mit den dunklen Möbeln tat ein übriges. Meine Schwester besah sich staunend das Bild eines auf einem Stuhl sitzenden verwundeten Kriegers, hinter ihm, mit starrem Blick, ein riesiger Engel.
«Willkommen im indischen Grabmal», sagte ich.
Sie lachte. «Grabmal? Wohl eher Gruft.»
«Das ist gehupft wie gesprungen», sagte ich. Noch ahnte ich nicht, daß ich einmal viele Monate in diesem Zimmer verbringen sollte, in dem im Winter die Eiskristalle an den Wänden glitzerten.
«Wie war die Reise?» fragte ich im leichten Plauderton meine Schwester, die gerade hundert Kilometer geradelt war und sich unter ziemlich dramatischen Umständen mit Erna und Buschi über die Elbe hatte setzen lassen. Dabei waren sie in ein schweres Gewitter geraten und wären fast ertrunken.
Bald mußten wir unser Quartier vorübergehend wieder räumen. Die beiden Zimmer waren für einen Offizier der UNRRA beschlagnahmt worden, einer Organisation, die sich vor allem um die von den Nazis verschleppten Menschen kümmerte, sogenannte Displaced Persons. Der Engländer sagte, er sei mit sehr gemischten Gefühlen nach Deutschland gegangen, denn seine Familie sei bei einem Bombenangriff auf London ums Leben gekommen. Aber beim Anblick der zerstörten Städte und des großen Elends habe er seinen Haß vergessen.