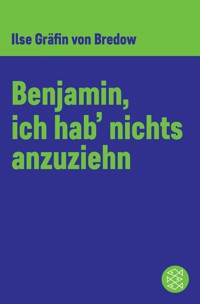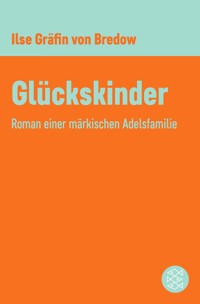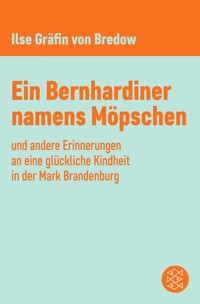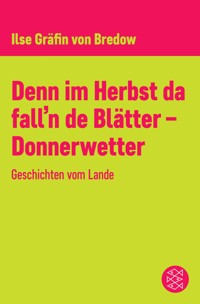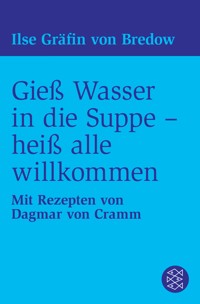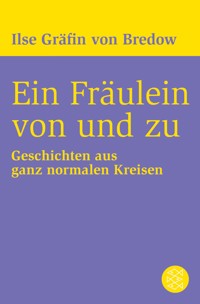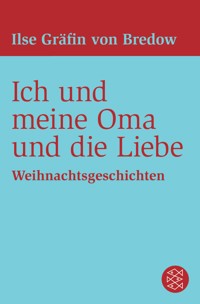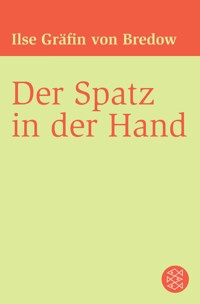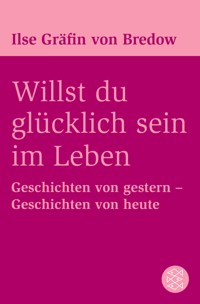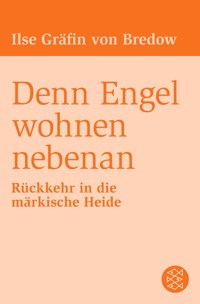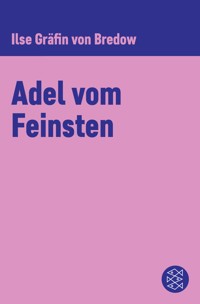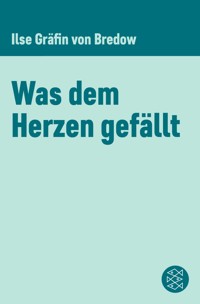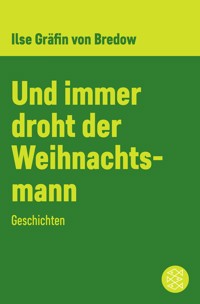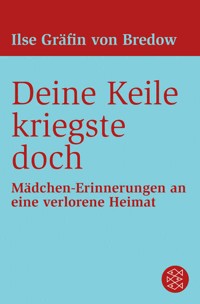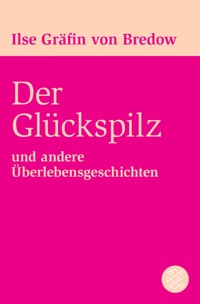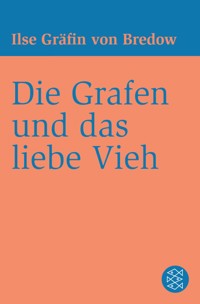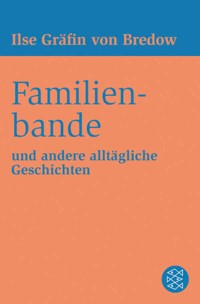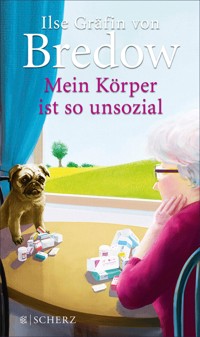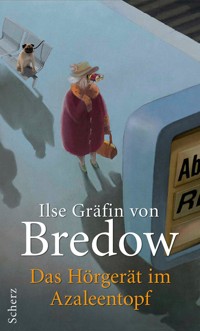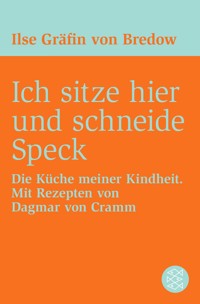
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ilse Gräfin von Bredows Geschichten einfach nur köstlich zu nennen wäre eine fade Untertreibung. Hier wird tellerrandvoll serviert, und nichts schwappt über." Welt am Sonntag Überschwappen tut in diesen Geschichten höchstens das Butterfass, wenn Möpschen, ganz wild auf Buttermilch, in die Küche stürmt. Es geht gewohnt turbulent zu in der gräflichen Familie: ein Küchenherd, der sich schnell echauffiert, Tante Herta mit ihren wirksamen Kräutertees, das Huhn Mathilde die Wilde, die ihre Eier irgendwohin legt, und natürlich Mamsell mit ihren Kochkünsten, die keiner ersetzt... In ihrer unnachahmlichen Weise führt uns Gräfin von Bredow durch diese vergangene Welt, in 12 Frühlingsgeschichten, die Dagmar von Cramm mit den passenden Rezepten ausgestattet hat, wie Kartoffeln mit Stippe, Heiß geliebter falscher Hase, Ente mit Rotkohl, Griessflammeri mit Johannisbeersaft oder Mamsells Sahnebonbons.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ilse Gräfin von Bredow
Ich sitze hier und schneide Speck
Die Küche meiner Kindheit. Mit Rezepten von Dagmar von Cramm
Über dieses Buch
Ilse Gräfin von Bredows Geschichten einfach nur köstlich zu nennen wäre eine fade Untertreibung. Hier wird tellerrandvoll serviert, und nichts schwappt über.
Welt am Sonntag
Überschwappen tut in diesen Geschichten höchstens das Butterfass, wenn Möpschen, ganz wild auf Buttermilch, in die Küche stürmt. Es geht gewohnt turbulent zu in der gräflichen Familie: ein Küchenherd, der sich schnell echauffiert, Tante Herta mit ihren wirksamen Kräutertees, das Huhn Mathilde die Wilde, die ihre Eier irgendwohin legt, und natürlich Mamsell mit ihren Kochkünsten, die keiner ersetzt... In ihrer unnachahmlichen Weise führt uns Gräfin von Bredow durch diese vergangene Welt, in 12 Frühlingsgeschichten, die Dagmar von Cramm mit den passenden Rezepten ausgestattet hat, wie Kartoffeln mit Stippe, Heiß geliebter falscher Hase, Ente mit Rotkohl, Griessflammeri mit Johannisbeersaft oder Mamsells Sahnebonbons.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Nicole Lange, Darmstadt
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490784-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
März
1 Und wer mich liebt, der holt mich weg
Täubchen in Bouillon
Vanillepudding mit Himbeersaft
Béchamel-Kartoffeln
Falscher Hase
Schweinebraten mit Kartoffelklössen und Sauerkraut
Griessflammeri mit Johannisbeersaft
Kartoffeln mit Stippe
2 Die merkwürdige Taube
Kräuteromelett
Eierkuchen mit Apfelmus
Biskuitrolle
Hühnerfrikassee mit Reisrand
Mamsells Sahnebonbons
Königsberger Klopse
Schokoladenkrem
3 Gerubbelt von rechts, gerubbelt von links
Eisbein mit Sauerkraut und Kartoffelbrei
Streuselkuchen
Hering mit Äpfeln, Zwiebeln und Sahnesosse
4 Brot und Flieder
Bohnen mit Speck
Erbsen mit Speck
Sülze mit Bratkartoffeln
Zusammengekochtes aus Roter Bete und Kartoffeln
Schnepfen mit Schnepfendreck und Madeirasosse
Fisch in Weinsosse
Roggenbrot aus Sauerteig
Süsssaure Brotsuppe mit Rosinen
April
5 Die Kräutertante
Huflattichsirup
Kräuterremoulade
Wiesenkräutersalat
Kräutersosse
Grüne Frühlingssuppe
6 Die Osterüberraschung
Napfkuchen
Zuckerkuchen
Schmorbraten mit Schlosskartoffeln und Gemüse
Glasierter Schweinebraten
Zitronen-Fondanteier
7 Möpschens Leibspeise
Butter
Buttermilchsuppe
Senfbutter
Sardellenbutter
Kräuterbutter
Krebsbutter
Zuckerbrezeln
Baisers mit Schlagsahne
8 Die Hauswirtschart geht vor
Biskuitplätzchen
Königinnenpasteten mit Ragout fin
Nudelauflauf mit Tomatensosse
Nudeln
Gebackenes «Heu» mit Vanillesosse
Hühnersuppe mit Eierstich
Käsestangen
Mai
9 Die Maibutter
Kartoffelpuffer mit Apfelmus
Kopfsalat mit Speck
Gartenkressesalat
Spinatfrösche
Kopfsalat à la crème
Mairübchen
10 Der duhne Maikäfer
Waldmeisterbowle
Spargel mit Holländischer Sosse
Spargelpudding
Leipziger Allerlei
Hechtklösschen in Krebssosse
Zitronenkrem
Englische Rhabarberpastete
11 Die Delikatesse
Eier in Senfsosse
Käsesoufflee
Krebssoufflee
Rhabarbersoufflee
Ente mit Rotkohl und Kartoffelklössen
Schnee-Eier – Œufs à la neige
12 Der Pfingstausflug
Pummelchen
Hefezopf mit Mohn
Rosinenbrot
Spargelsuppe
Pochierter Hecht in Spreewaldsosse
Weingelee
Kalte Ente
Glossar zu den Rezepten
Christiane von Saldern, der Ideenreichen
März
1Und wer mich liebt, der holt mich weg
Aus heutiger Sicht gesehen war die Küche meiner Kindheit eher murklig. Sie befand sich im Keller, den man damals vornehm Souterrain nannte und der heute zum Tiefparterre hochstilisiert ist. Sie hatte einen reichlich porösen unebenen Zementfußboden und statt einer Wasserleitung eine Pumpe mit Spülstein. Auch das Meublement war bescheiden. Es bestand aus einem wurmstichigen Küchenbuffet für Geschirr, Bestecke und Töpfe und einem Schrank, in dem alles andere Gerät, das man so in der Küche brauchte, untergebracht war. Es gab einen kleinen Brottisch und einen großen Tisch am Fenster, unter dem die beiden Zinkwannen für den Abwasch standen. Die Wände waren gekalkt und über dem Herd von Ruß geschwärzt.
Der Herd war natürlich der Mittelpunkt des Ganzen, ein betagtes Ungetüm, das noch von dem früheren Bewohner des Forsthauses, einem Förster meines Großvaters, stammte. Er war nicht irgendein beliebiger Gegenstand, er gehörte zur Familie und war, wie wir alle, ein eigenwilliger Charakter, der sich nichts gefallen ließ, am wenigsten von schusseligen Stubenmädchen, die, wie Mamsell behauptete, eher den Spruch «Arbeite fröhlich und gediegen, was nicht fertig ist, bleibt liegen» beherzigten als den von den fleißigen Händen, die kein Ende finden, und ihn gedankenlos mit nassem Holz vollstopften. Die Strafe folgte denn auch im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Fuße. Die Ofentür öffnete sich wie von Geisterhand, und eine Ladung angekohlten, rauchenden Holzes landete auf den Schuhen des aufkreischenden Mädchens. Wenn man ihn mit zu viel Kien fütterte, um so schnell wie möglich Kohlen und Holz zum Brennen zu bringen, nahm er es übel. Es entstand in Windeseile eine derart mörderische Hitze, dass die Herdplatte zu glühen und das Wasser im Seitenschiff zu brodeln begann. Dann war es höchste Zeit, einen Teil der Glut in den Ascheimer zu befördern, die Ofentür zu öffnen und das Fenster aufzureißen, damit sich der echauffierte Herd wieder beruhigte.
Mamsell hasste ihn von ganzem Herzen und ließ nicht nach, sich über ihn zu beschweren und einen neuen zu fordern, womit sie natürlich bei Vater auf taube Ohren stieß. Er sah gern über alles hinweg, was er nicht selbst benutzen musste. Zum Beispiel war das Tranchiermesser ein geheiligter Gegenstand, dessen Klinge er genau prüfte, ehe er es in Gebrauch nahm. «Hat schon wieder ein Idiot Kien damit geschnitten? Ist ja ganz schartig», behauptete er jedes Mal, und während alle Augenblicke neue Wundermesser gekauft werden mussten, verhallten Mamsells Klagen ungehört. Galt denn nicht im ganzen Dorf unsere Küche geradezu als hochherrschaftlich? Na also!
Und er hatte Recht, sie tat es. Allein schon dieser Luxus, eine Pumpe in der Küche! Nicht mehr die ewige Schlepperei mit den Wassereimern vom Hof! Und dann dieser wundervolle Herd, ausgestattet mit zwei Röhren, einer zum Backen und einer zum Braten. In manchen Häusern gab es nur eine Art Feuerstelle, aus Backsteinen gemauert, mit offenem Kamin, durch den die Sterne schauten. Und Dohlen, die ein Nest im Schornstein in Erwägung zogen und sich dazu ein wenig umsahen, kam plötzlich ein zum Wenden in die Luft geworfener Eierkuchen entgegengesegelt. Von einem solchen Herd, wie wir ihn hatten, konnte man nur träumen. Außerdem wusste doch jedermann, dass Seine Königliche Hoheit, der Prinz von Hannover und Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, Kommandeur der Ziethenhusaren in Rathenow, nach einer Jagd bei meinem Großvater des Öfteren im Försterhaus eingekehrt war und den Rehrücken der Förstersfrau immer besonders gelobt hatte!
Unsere Küche besaß für Mensch und Tier die gleiche Anziehungskraft. Wintermärchen, das Pferd meiner Schwester, liebte es, in den Garten einzudringen und von dort aus seinen Kopf durchs Küchenfenster zu stecken, um die Streusel vom Blechkuchen zu fressen, der von Mamsell zum Auskühlen aufs Fensterbrett gestellt worden war. Die Backröhre diente im Sommer als Brutkasten für zu früh geschlüpfte Küken, die dort in einem Schuhkarton dem rauen Leben auf dem Hühnerhof entgegenpiepsten. Junge Katzen strichen Mamsell um die Beine, und von uns aufgelesene, aus dem Nest gefallene Spatzenjunge wollten gefüttert werden. In der Küche herrschte Burgfrieden, und so trottete Möpschen, unser Bernhardiner, nur hin und wieder zur offenen Backröhrentür, um die Küken vorsichtig zu beschnuppern, wobei ihm vor lauter Gier nach diesen zarten Leckerbissen der Sabber nur so heruntertropfte. Auch die Katze hielt sich fern. Allein die Unart, sich in die Schüssel mit dem Quark zu legen, der sich mit Hilfe von Natron in Kochkäse verwandeln sollte, war ihr schwer abzugewöhnen.
In unserer Küche gab es ein ständiges Raus und Rein. Wir waren sehr unruhige Kinder und hielten es nicht lange an einem Ort aus. Außerdem waren wir Topfgucker der schlimmsten Sorte und gaben dabei mit großer Wichtigkeit die von den Erwachsenen aufgeschnappten Weisheiten zum Besten. Mamsell war die Geduld selbst und hörte sich den größten Unsinn gelassen an. Nur wenn wir anfingen, uns zu zanken, schmiss sie uns raus.
Die Küche war zudem Schauplatz vieler turbulenter Ereignisse. So beförderte Tante Herta unsere Hauskröte, die sich gerade auf dem Weg von der Kellertreppe zu ihrem Stammplatz unter dem Spülstein neben der Pumpe befand, fast ins Jenseits. Sie stolperte auf der letzten Stufe und versuchte sich vergeblich am Butterfass festzuhalten. Tante und Fass stürzten zu Boden, und die Buttermilch ergoss sich zu Möpschens großer Freude durch die Küche. Oder der für die Gäste im Wasserbad zubereitete Spargelpudding klebte plötzlich an der Decke, weil Mamsell die Form zu hastig geöffnet hatte. So manches Stück wertvollen Porzellans ging zu Bruch, darunter zwei besonders erlesene Mokkatassen, weil Möpschen hin und wieder über die Tauben, die vor dem Küchenfenster auf und ab spazierten, so in Rage geriet, dass er auf den Küchentisch sprang, auf dem die Kostbarkeiten gerade des Abwaschs harrten.
Aber das war nichts gegen das, was Tante Hertas Dackel passierte. Das streitsüchtige Tier griff in der Küche plötzlich Möpschen an, und es gab eine wilde Beißerei. Mamsell fackelte nicht lange. Sie nahm, wie sie glaubte, einen Topf mit Wasser und leerte ihn über beide Hunde aus. Den größten Teil bekam der Dackel ab, der sich augenblicklich in eine Art Zuckerschnecke verwandelte. Was Mamsell für Wasser gehalten hatte, war eine von ihr vorbereitete Zuckerlösung für Obst gewesen, das sie einwecken wollte. Sie schmiss die verdatterten Hunde raus und hatte alle Mühe, die verklebte Küche wieder einigermaßen begehbar zu machen. Als sie damit fertig war, fielen ihr die Hunde wieder ein, die sich inzwischen wahrscheinlich gegenseitig völlig zerfleischt hatten. Doch als sie auf den Hof kam, sah sie die beiden friedlich vereint auf dem Rasen liegen. Mamsell rief den Bernhardiner, aber der kümmerte sich nicht darum. Er war ganz damit beschäftigt, den Dackel abzulecken. Möpschen liebte Süßes über alles, er leckte und leckte, und der Dackel schien seine Streitsucht vergessen zu haben. Von da an waren die beiden Freunde fürs Leben.
Unsere Küche war aber auch ein Ort der Bekenntnisse und Beichten. Junge Tanten, die nach Bällen in Berlin den kleinen Abstecher in unsere Wildnis nicht scheuten und gern einmal bei meinen Eltern hereinschauten, schütteten Mamsell ihr Herz aus. Sie sahen ihr beim Kochen zu und redeten und redeten, während Mamsell alle Augenblicke nach den Kartoffeln kuckte, die nicht kochen wollten, weil der Herd mal wieder nicht genug Hitze gab, und «Miststück!» vor sich hin murmelte, womit sie natürlich den Herd meinte und nicht – wie die Tanten, gerührt über so viel Teilnahme, annahmen – den treulosen Verehrer.
Der Herd war und blieb für Mamsell ein leidiges Thema, das anscheinend im Frühjahr besonders akut wurde, wenn der Schornsteinfeger kommen sollte, der jedoch gern auf sich warten ließ.
Mit dem Frühling war es nicht anders. Auch er nahm sich Zeit und konnte es, was Verspätung anging, durchaus mit der Kleinbahn aufnehmen, die, je nach der Zahl der Waggons, vor jeder kleinsten Steigung eine längere oder kürzere Verschnaufpause einlegen musste. Zwischendurch foppte er uns gern mit ein paar überraschend warmen, fast sommerlichen Tagen, was uns sofort herumnölen ließ: Wir wollten endlich nicht mehr die kratzigen langen Wollstrümpfe tragen, sondern Kniestrümpfe oder Söckchen, warm genug dafür sei es doch nun wirklich. Wie immer gab Mutter nach. Endlich waren wir auch das verhasste Leibchen mit den Strumpfhaltern los, an die die Strümpfe geknöpft waren. Aber nur für kurze Zeit. Das Wetter schlug um, und Husten und Fieber waren die Folgen unseres Leichtsinns, von Mutter als schwere Grippe, von Vater als leichte Erkältung bezeichnet. Während sich die Temperaturen bereits wieder bedenklich dem Gefrierpunkt näherten und vorwitzige Schneeglöckchen, Krokusse und Osterglocken auf dem Rasen von Schlackerwetter überrascht wurden, bekam man kalte Wickel, die das Fieber herunterdrücken sollten, verbrauchte unzählige Taschentücher, trank schaudernd Huflattichtee aus einer von Tante Herta selbst zusammengestellten und von ihr wärmstens empfohlenen Kräutermischung, die grauenvoller als Lebertran schmeckte, fror und schwitzte abwechselnd vor sich hin, das Fieber stieg weiter, und die Tapetenmuster schnitten einem Fratzen. Mutter bestand auf einem Arzt, was Vater völlig überflüssig fand. «Willst du diesen armen Menschen wegen so einer Lappalie wirklich bei Sturm und Regen hierher hetzen?«
«Ja, das will ich», sagte Mutter sehr bestimmt. Das Fräulein vom Amt, ebenfalls stark verschnupft, erkundigte sich teilnehmend, ob es etwas Ernstes sei, ehe sie meine Mutter mit dem Arzt verband.
«Scheußliches Wetter», sagte der Doktor, als Mutter ihn ins Krankenzimmer führte, und wärmte sich fürsorglich erst die Hände am Kachelofen, ehe er mich abhorchte. Dann sah er meine Mutter an, sagte: «Na ja», verordnete weitere Bettruhe, roch am Huflattichtee, warf mir einen mitfühlenden Blick zu und hinterließ einen herrlich schmeckenden Hustensaft, von dem ich freiwillig die dreifache Menge schluckte, außerdem das Allheilmittel Akonit in Form von winzigen Kügelchen, die genau abgezählt werden mussten. Das geschwächte Kind bekam ein kräftigendes gekochtes Täubchen mit Reis, so viel Vanillepudding mit Himbeersaft, wie es wollte – «Das Kind kommt uns sonst zu sehr runter« –, durfte aber erst nach drei fieberfreien Tagen aufstehen und nach zwei weiteren Tagen schließlich an die frische Luft. Eingemummelt bis zur Nasenspitze, bewacht von Mutter, umrundete es ein paar Mal die Leiterwagen auf dem Hof, weil Mutter behauptete, es wehe ein eisiger Wind und bei den Wagen sei es windgeschützt, während das Kind es ziemlich warm fand.
Inzwischen zeigte sich Mamsell einmal wieder von ihrer muffigsten Seite. Sie haderte mit dem Herd, weil ihr ein Napfkuchen missglückt war. Als die Eltern mit mir in die Küche kamen, saß sie beim Kartoffelschälen und murmelte den alten Kindervers vor sich hin: «Ich sitze hier und schneide Speck, und wer mich liebt, der holt mich weg.«
«Aber nicht doch!», rief Vater. «Was ist denn passiert?«
Mamsell zeigte anklagend auf den verbrannten Napfkuchen.
«Kann ja mal vorkommen», versuchte Vater sie zu beruhigen.
«Der Herd!», rief Mamsell. «Er ist der Nagel zu meinem Sarge!«
«Mamsell hat Recht», kam ihr Mutter zu Hilfe. «Er ist wirklich eine Zumutung.» Sie hustete ostentativ. «Du musst doch merken, wie er qualmt.«
«Nur die Sonne, die auf den Schornstein drückt», beschwichtigte Vater. «Der Schornsteinfeger hat sich bereits angekündigt.«
«Sonne? Draußen regnet’s, wenn dir das noch nicht aufgefallen ist.«
Vater sah aus dem Fenster. «Tatsächlich. Aber es muss gerade erst angefangen haben. So ist es eben im Frühling. Früh links erwachen, abends rechts einschlafen.» Er lachte herzhaft über diesen abgestandenen Familienscherz.
Mamsells Miene verfinsterte sich mehr und mehr. «Und wer mich liebt, der holt mich weg», wiederholte sie. Sie sagte es so nachdrücklich, dass Vater zusammenfuhr und ihr versprach, den Ofensetzer zu bestellen.
«Wahrscheinlich muss er nur mal wieder richtig ausgeschmiert werden. Der Schmorbraten neulich war doch eine reine Delikatesse.«
Aber ehe er weiterreden konnte, wurde er ziemlich rüde von Mutter unterbrochen. «Komm uns jetzt bitte nicht wieder mit der Geschichte von Seiner Königlichen Hoheit und dem Rehrücken. Es ist allein Mamsells Verdienst, dass sie mit dieser unbeständigen Hitze alles überhaupt noch so einigermaßen hinbekommt.«
Vater zog hastig seine Taschenuhr: «O Gott, schon so spät! Ich habe ja ganz vergessen, dass ich mit dem Bürgermeister verabredet bin!» Er verließ fluchtartig die Küche. Die beiden Frauen sahen sich an. Mutter wollte wissen, was es zum Mittagessen geben sollte.
«Hefeklöße mit Backobst», erklärte Mamsell. Mutter lächelte belustigt und schadenfroh zugleich. Vater hasste Hefeklöße mit Backobst. Mit heißer Pflaumensoße waren sie vielleicht noch akzeptabel. Aber Backobst!
«Steter Tropfen höhlt den Stein.» Mamsells Stimme klang zuversichtlich.
Mutter seufzte. «Ich kenne den Stein länger.«
Natürlich galt auch für Vater die eiserne Regel: Was auf den Tisch kommt, wird gegessen, obwohl wir Kinder fanden, dass alles, was wir nicht mochten, besonders häufig serviert wurde: Erbsen- und Linsensuppe, Béchamel-Kartoffeln, Steckrüben, Schnippelbohnen, Blumenkohl, Rosenkohl, Wirsingkohl oder Graupen. Und fast alles Gemüse wurde mit einer Mehlschwitze angedickt. Dagegen hatten wir nichts einzuwenden gegen falschen Hasen, dessen Reste wir dann zum Abendbrot noch einmal als Aufschnitt mit Mostrich bestrichen aßen, verlorene Eier, Kartoffelbrei mit Setzeiern, arme Ritter und Eierkuchen. Fleisch stand höchstens ein-, zweimal in der Woche auf dem Speisezettel. Am Sonntag gab es den obligaten eingeweckten Schweinebraten mit Sauerkraut und Kartoffelklößen oder Wild. Und auch der Sonnabend hatte sein Stammgericht: Kartoffelsuppe. Die tägliche Suppe vor dem Hauptgericht war meist mit Grieß angemacht und schmeckte reichlich fade, aber der Abschluss fand wieder unseren Beifall, Kompott oder der geliebte Grießflammeri, in Form eines Fisches, mit Johannisbeersaft. Auch zum Abendbrot musste vorweg etwas Warmes die Mägen füllen, Bratkartoffeln, Kartoffeln mit Stippe oder Sülze und Rührei natürlich. Da dieses im Winter von eingelegten Eiern stammte, hatte es eine reichlich gummiartige Konsistenz. Wir lechzten geradezu nach frischen Eiern, und bei den Abendeinladungen in der Nachbarschaft hieß es nun nicht mehr: «Legen deine Hühner noch?», sondern: «Legen deine Hühner wieder?«
Aber die waren ebenso «von Anhalt» wie die Natur, die nach dem ersten Überschwang wieder in den Winterschlaf zurückgefallen zu sein schien. Nicht einmal das Wasser auf den Wiesen konnte sich entschließen abzufließen, und wir balancierten weiterhin die Koppelzäune entlang auf der Suche nach laichenden Hechten. Nur Kraniche und Wildgänse waren verheißungsvolle Frühlingsboten. In Scharen zogen sie über unsere Köpfe hinweg, und so lasen wir zum x-ten Mal Selma Lagerlöfs Nils Holgersson und übten uns weiter in Geduld. Denn das hatten wir als Landkinder längst gelernt: Die Natur ließ sich nun mal nicht drängeln.
Täubchen in Bouillon
Täubchen als Suppe galt als ideale Nahrung für Rekonvaleszenten. Heute bekommen Sie Täubchen normalerweise nur noch beim Feinkosthändler oder auf dem Wochenmarkt. Ersatzweise können Sie Stubenküken nehmen oder 1 Suppenhuhn (Garzeit 1 1/2 Stunden) – auch wenn das Aroma nicht zu vergleichen ist! Übrigens: Für die Suppe wurden eher ältere Tauben (so wie Suppenhühner) genommen und diese deshalb mit kaltem Wasser aufgesetzt und 2 Stunden gekocht.
2 ausgenommene Täubchen (à ca. 400 g)
1 Bund Suppengrün
1 Petersilienwurzel (wenn vorhanden)
Salz
Zum Einkochen: 1 Tasse Langkornreis
1–2 Eigelb
Die Täubchen waschen. Suppengrün und Petersilienwurzel waschen und grob zerkleinern. In einem hohen, passenden Topf 1 l Wasser, das Suppengrün, die Petersilienwurzel und 2 TL Salz zum Kochen bringen. Die Tauben hineinlegen und etwa 30 Minuten leicht kochen lassen. Dann herausheben, die Brühe durch ein Sieb gießen. Wieder zum Kochen bringen und den Reis einstreuen (früher wurde er vorher gewaschen und gebrüht – das ist heute nicht mehr nötig). Etwa 15 Minuten leicht kochen lassen, bis der Reis weich ist. Das Fleisch inzwischen auslösen und in mundgerechte Häppchen schneiden, in der fertigen Bouillon heiß werden lassen. Zum Schluss ein oder zwei Eigelbe mit einigen Löffeln heißer Brühe in einer Tasse anrühren und unter Rühren in die heiße Suppe laufen lassen. Sofort zu Tisch geben und nicht mehr kochen lassen, sonst gerinnt das Ei.
Früher wurde Reis vor dem Kochen gewaschen und gebrüht: Zunächst wurde er in kaltem Wasser zwischen den Fingern gerieben, um Spelzen und Fehlkörner auszusortieren. Dann wurde der Reis nochmals mit kaltem Wasser aufgesetzt, einmal aufgekocht, in ein Sieb abgegossen und kalt abgeschreckt. Das war nötig, weil die Körner Verunreinigungen enthielten und noch nicht so glatt poliert waren – der Reis sollte ja bei Tisch schneeweiß und körnig sein!
Vanillepudding mit Himbeersaft
Eigentlich heißt ein Pudding nur Pudding, wenn er im Wasserbad gegart wird. Alles andere ist ein Flammeri. Das ist aber in Vergessenheit geraten – dank Dr. Oetker … Gekocht wurde Pudding von der Mamsell aber immer noch selbst – und nicht mit Fertigpülverchen.
3/4 l Milch
60 g Speisestärke
1 Stückchen Zitronenschale
1 Stückchen Vanillestange
50 g Zucker
1 Prise Salz
3 Eier
Eine Tasse von der Milch abnehmen, die Speisestärke darin anrühren. Die übrige Milch mit Zitronenschale, Vanille, Zucker und Salz verrühren und zum Kochen bringen. Die angerührte Stärke (am besten durch ein Sieb wegen der Klümpchen) unter Rühren in die Milch einfließen lassen und alles etwa 10 Minuten dick einkochen. Die Eier trennen. Eiweiß sehr steif schlagen. Die Eigelbe mit einigen Löffeln heißem Pudding anrühren, dann den Pudding vom Feuer nehmen und die Eigelbe unterschlagen. Unter Rühren einmal kurz aufpuffen lassen, sofort vom Feuer nehmen und den Eischnee unterziehen. Die Masse in eine Schale füllen und kalt stellen. Vorher ganz dünn mit Puderzucker überstäuben, damit sich keine Haut bildet. Mindestens 6 Stunden in den Kühlschrank stellen, dann mit Himbeersirup servieren.
Wer den Pudding stürzen möchte, lässt den Eischnee weg (und backt Baisers daraus, Rezept Seite 128) – er macht die Speise so locker, dass sie zum Stürzen nicht mehr fest genug ist.
Es gab selbst eingekochten Himbeersaft. Den bekommen Sie heute fast nur noch im Reformhaus – oder Sie müssen ihn selbst machen. Eine Alternative ist Himbeersirup. Ist er Ihnen zu süß, verdünnen Sie ihn mit etwas Wasser und ein paar Tropfen Zitronensaft.
Vanillestangen waren eine teure Delikatesse, die zweimal benutzt werden konnte: Nachdem sie der Milch das Aroma gegeben hatten, wurden sie abgewaschen, an der Luft getrocknet und dann in einem Gefäß mit Streuzucker aufbewahrt. Nach 1 bis 2 Wochen nimmt der Zucker das Aroma an. Probieren Sie es mit einer frischen Vanillestange aus – das schmeckt feiner als Vanillinzucker aus der Tüte.
Béchamel-Kartoffeln
Die ursprüngliche Béchamel wird mit Wurzelgemüse angesetzt. Mit Kartoffeln ergibt sie ein Bredow’sches Hauptgericht. Aber sie verbindet auch gekochtes Gemüse wie Blumenkohl, Kohlrabi, Spargel oder Möhren zu einem kremigen Ganzen. Dann wird sie aber mit dem Gemüsewasser statt Fleischbrühe angegossen.
3–4 Zwiebeln
1 Möhre
1 Stückchen roher Schinken
2–3 Champignons oder Pilzstiele (wenn vorhanden)
40 g Butter
2 EL Mehl
1/4 l Fleischbrühe
1/4 l Milch
1 Lorbeerblatt
einige Pfefferkörner
Salz
geriebene Muskatnuss
1 Schuss Sahne
2–3 EL Schnittlauchröllchen
2 saure Gurken (Salzgurken)
1 kg Pellkartoffeln
Zwiebeln und Möhre schälen, mit dem Schinken und den Pilzen in Würfel schneiden, in der Butter bei kleiner Hitze glasig dünsten. Dann mit Mehl überstäuben und weiterdünsten, bis das Mehl gelblich wird. Vom Feuer nehmen (das ist wichtig, sonst klumpt die Schwitze!) und auf einmal die kalte Brühe einquirlen, dann die kalte Milch. Die Gewürze zugeben und die Béchamel bei kleiner Flamme unter Rühren zum Kochen bringen. Kocht die Soße erst einmal und ist sie glatt, kann nichts mehr schief gehen. Etwa eine Viertelstunde leise kochen lassen, dann durch ein Sieb rühren. Nochmals aufkochen, mit etwas Sahne, Salz und Schnittlauch abrunden. Die Gurken fein würfelig schneiden, mit den gepellten, klein geschnittenen Kartoffeln in der Stippe heiß werden lassen, auftragen.
Tipp: Eigentlich ist es schade, das Gemüse wegzuwerfen: Fischen Sie das Lorbeerblatt heraus, nehmen Sie gemahlenen Pfeffer statt Körner, verzichten Sie auf den Schinken und pürieren Sie die Soße mit dem Pürierstab – dann können Sie auch 1 EL Mehl sparen, denn das Gemüse gibt zusätzlich Bindung.