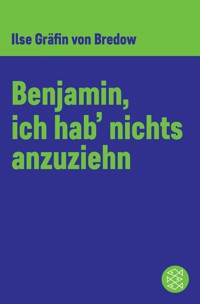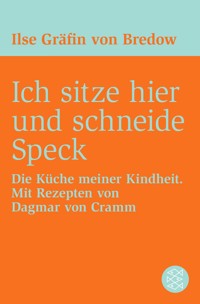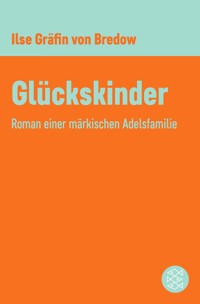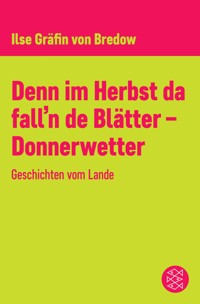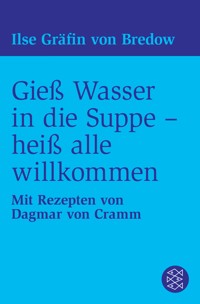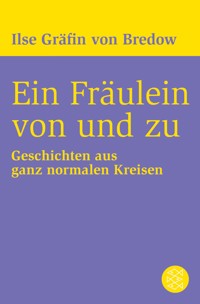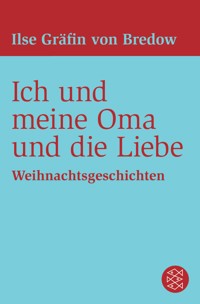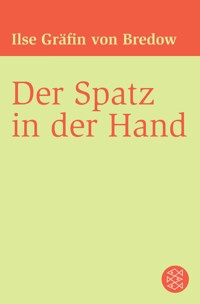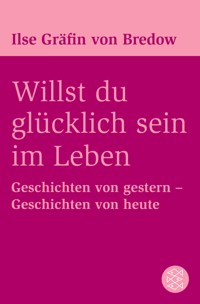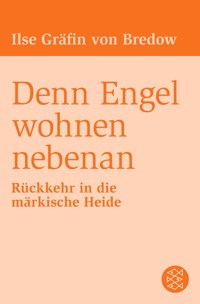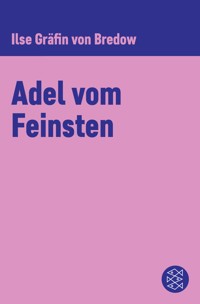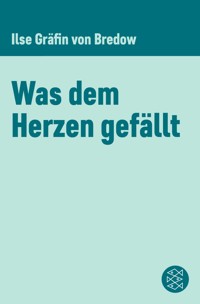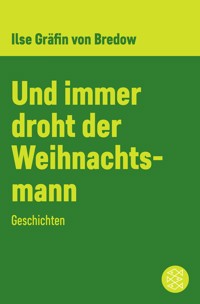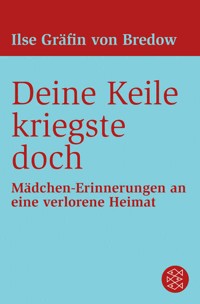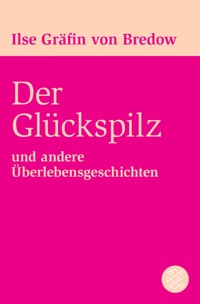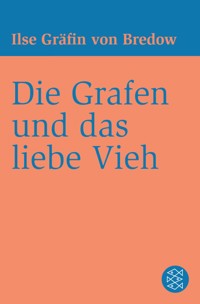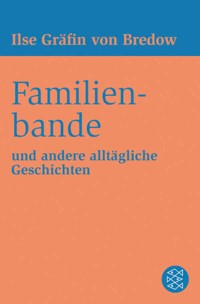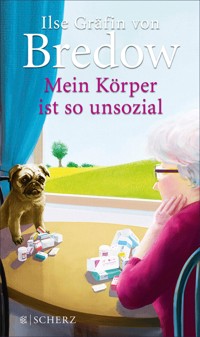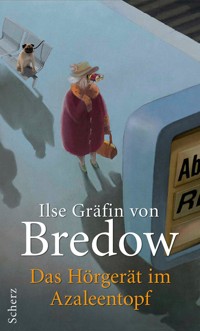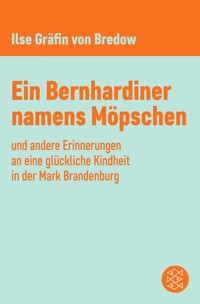
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Abseits vom großen Weltgetriebe war das Dorf gelegen, an einem kleinen See und umgeben von Wäldern, in denen es sich herrlich umherstreifen ließ. Es war das Paradies, in dem die Erzählerin sich als Kind »mit den Galoschen des Glücks« tummelte und wohin sie in allen in diesem Band gesammelten Geschichten wieder zurückkehrt. Es ist die Welt von ›Kartoffeln mit Stippe‹ in ihrer ganzen Fülle von kleinen und großen Freuden - und Kalamitäten. Sie ist bevölkert von liebevollen, aber strengen Eltern, respekteinflößenden Köchinnen und Hauslehrerinnen, skurrilen Onkeln und abenteuerlichen Tanten, originellen Dorfbewohnern und nicht zuletzt von Kindern, die noch an den Osterhasen und Weihnachtsmann glauben. Nicht weniger wichtig als die Menschen sind jedoch die Tiere: die zahme Maus, der freiheitsliebende Stallhase, der biertrinkende Bernhardiner und der naschhafte Dackel, das arrogante Huhn und das liebevoll umsorgte alte Reitpferd. Mit diesen farbigen Geschichten aus dem Garten ihrer Erinnerungen hat die Autorin einen kunterbunten Strauß zusammengestellt - mit dem Duft von Nostalgie, aber vor Sentimentalität bewahrt drch den wohltuenden Unterton echt Bredowschen Humors.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ilse Gräfin von Bredow
Ein Bernhardiner namens Möpschen
und andere Erinnerungen an eine glückliche Kindheit in der Mark Brandenburg
Über dieses Buch
Abseits vom großen Weltgetriebe war das Dorf gelegen, an einem kleinen See und umgeben von Wäldern, in denen es sich herrlich umherstreifen ließ. Es war das Paradies, in dem die Erzählerin sich als Kind «mit den Galoschen des Glücks» tummelte und wohin sie in allen in diesem Band gesammelten Geschichten wieder zurückkehrt.
Es ist die Welt von ›Kartoffeln mit Stippe‹ in ihrer ganzen Fülle von kleinen und großen Freuden - und Kalamitäten. Sie ist bevölkert von liebevollen, aber strengen Eltern, respekteinflößenden Köchinnen und Hauslehrerinnen, skurrilen Onkeln und abenteuerlichen Tanten, originellen Dorfbewohnern und nicht zuletzt von Kindern, die noch an den Osterhasen und Weihnachtsmann glauben.
Nicht weniger wichtig als die Menschen sind jedoch die Tiere: die zahme Maus, der freiheitsliebende Stallhase, der biertrinkende Bernhardiner und der naschhafte Dackel, das arrogante Huhn und das liebevoll umsorgte alte Reitpferd.
Mit diesen farbigen Geschichten aus dem Garten ihrer Erinnerungen hat die Autorin einen kunterbunten Strauß zusammengestellt - mit dem Duft von Nostalgie, aber vor Sentimentalität bewahrt drch den wohltuenden Unterton echt Bredowschen Humors.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Nicole Lange, Darmstadt
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490788-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorwort
Kleines Tagebuch für große Gedanken
Wie schön war’s doch am Havelsee
Unterricht nur bei Windstille
Die rasende Pauline
Unsere heiligsten Kühe
Mit den Galoschen des Glücks
Mensch ärgere dich nicht!
Das gestörte Picknick
Willis weite Reise
Loblied auf den Kachelofen
Eines Abends im Advent
Unsere Ahnfrau hieß Agnete
Aus dem Leben Eduards V.
Ein Bernhardiner namens Möpschen
Wenn das Obst geerntet wird
Die ganz billige Tanne
Die gläserne Katze
Onkel Enzios Rettung
Pumm und das Osterlamm
August, der Wilddieb
Henne Berta faßt einen Dieb
Rosamundes spätes Glück
Der ungerechte Nikolaus
Das Löwenspiel
Ein Krokodil namens Pinne
Der Osterhase und das Waldhorn
Betten meines Lebens
Vorwort
Mit dieser Sammlung von Feuilletons und Kurzgeschichten aus den sechziger Jahren erfülle ich einen Wunsch vieler Leser, deren Wohlwollen mich begleitet hat, seit meine allerersten Erzählungen erschienen. Damals gab es in Zeitungen und Zeitschriften noch genug Weideland, auf dem große und kleine, bekannte und unbekannte Autoren friedlich nebeneinander grasen konnten. Oft schrieb man Auftragsarbeiten zu bestimmten Jahreszeiten und Festen. Themen und Stil entsprachen dem Zeitgeschmack. Es waren die Jahre, als man Honorare noch per Post bekam und die Sachbearbeiter auf die Zahlungsabschnitte persönliche Grüße kritzelten; als belesene Redakteure ihre Autoren mit gleicher Hingabe wie ihre Marotten pflegten und mit gütiger Strenge manch dichterischem Nachwuchs, der später zu großen Ehren kam, in den Sattel halfen. Kurz gesagt, es gab Originale jeder Couleur. Sie sind ausgestorben, und die Zeitungsverlage haben die einst so fruchtbaren Weiden versteppen lassen. Hätte ich aber nicht die Chance gehabt, dort mein Handwerk nach und nach zu erlernen, wäre Kartoffeln mit Stippe wahrscheinlich nie entstanden und auch meine anderen Bücher nicht. Denn mit den Kurzgeschichten fing alles an.
Ilse Gräfin von Bredow
Kleines Tagebuch für große Gedanken
Irgendwann faßt wohl jeder einmal den Entschluß: Von nun an will ich die wichtigsten Ereignisse meines Lebens schriftlich festhalten.
Für eine Zeitlang wenigstens fühlt man sich eins mit großen Dichtern und Staatsmännern, die einst ihre wohlgeordneten, geistvollen Gedanken einer ehrfürchtig staunenden Nachwelt hinterließen. Doch meist scheitern alle guten Vorsätze bereits nach der ersten oder zweiten Seite des Tagebuchs.
Mein erstes Tagebuch war ein Notizkalender unserer Kohlenhandlung und enthielt fast ausschließlich in fehlerhaftem Deutsch wiedergegebene Injurien wie: «Willi ist blöd.» Oder: «Annelise Lohse macht sich in die Hose.«
Meine Schwester dagegen, die mehr Sinn fürs Hübsche besaß, ließ sich zum Geburtstag ein ledergebundenes, mit einem Schloß versehenes Buch schenken. Sie kritzelte eifrig darin herum, trug den winzigen Schlüssel fortan um ihren Hals und machte ein furchtbares Trara darum, wenn sie ihn beim Waschen ablegen sollte. Es kostete mich wenig Mühe, herauszufinden, wo sie ihr Tagebuch aufzubewahren pflegte. Voller Neugier öffnete ich ohne Schwierigkeiten mit Hilfe einer Haarnadel das Schloß. Ich war tief enttäuscht. Es enthielt lediglich eine Aufstellung sämtlicher Filme, die sie mit den Eltern gesehen hatte. Ort, Stunde der Vorstellung und Namen der Schauspieler.
Auch die niedergeschriebenen Gedanken meiner unverheirateten, bereits etwas ältlichen Tante schwebten nicht gerade in höheren Sphären. Daß ich sie trotzdem während eines Ferienaufenthaltes bei ihr täglich sehr aufmerksam las, hatte seine triftigen Gründe. Stand da beispielsweise: «Heute von Robert geträumt», so winkte mir ein herrlicher Tag ohne jedes Verbot. Bei dem lapidaren Hinweis: «Kopfschmerzen!» war Unerfreuliches zu erwarten.
Selbst mein Großvater, von dem das Gerücht ging, er habe sogar Goethe gelesen, begnügte sich bei seinem Tagebuch mit detaillierten Schilderungen jagdlicher Vorkommnisse und der erstaunten Anmerkung: «Adele schon wieder nach Berlin ins Theater gefahren.» (Wobei «schon wieder» einmal im Jahr bedeutete.)
Großmutter war übrigens die einzige, die bereits nach einem Tag schon die Konsequenzen aus ihrer Einfallslosigkeit zog und das Tagebuch für immer beiseite legte, denn der einzige Satz, den sie niedergeschrieben hatte, lautete:
«Bei Kaufmann Werner ist die Stärke um einen Pfennig teurer.«
Wie schön war’s doch am Havelsee
Der See lag so nah, daß man im Winter das Eis seufzen und knacken hörte, und so weit, wenn man in der Sommerhitze den schmalen Wiesenpfad zum Ufer hinunter trabte. Im Frühjahr überschwemmte er die Wiese hinter dem Gutshaus. Dann kamen die Hechte zum Laichen die Gräben entlanggeschwommen. Die Wiese war der beste Wetterprophet: Jedesmal, wenn sie gemäht wurde, begann eine Regenperiode, so hoch die Schwalben auch flogen. Der Rhin mündet in den See und den Großen Graben, auf dessen schmaler Brücke stets die Pferde scheuten, weil die Bohlen so dröhnten. Auf dem verwitterten Warnschild daneben war nur noch die Unterschrift zu lesen: «Der Luchgrabenschaudirektor.«
Der See gehörte zum Dorf wie der Flieder entlang der Gartenzäune, die Sandlöcher der Hühner auf der Straße, der über den Höfen kreisende Habicht, die Hornissen hinter Lamprechts Holzschuppen und wie Erna Hagemann. Von einem Tag auf den anderen verschlug es ihr die Sprache. Warum, wußte niemand. Schweigend wanderte sie durchs Dorf, blickte stumm in jedes Fenster und saß vor sich hinstarrend auf der Bank vor dem Haus. Keiner konnte ihr helfen, die alte Krusen nicht, die sie beim Mondschein schon dreimal bebötet hatte, und schon gar nicht der junge Doktor, der anstatt von den Wechseljahren vom Klimakterium sprach, ein geheimnisvolles Wort, das die Schwere der Krankheit deutlich machte.
Erst «so einer» aus der Stadt, die mit ihrem Freund am See zeltete, gelang es, den Bann zu brechen. Am Sonntag morgen kam sie, nur mit einer Turnhose aus schwarzem Satin und einem Büstenhalter bekleidet, ins Dorf marschiert, um sich Milch zu holen. Nun war dem Dorf nichts Menschliches fremd. Die kleinen Mädchen, zum Beispiel, gingen im Sommer gern ohne Schlüpfer. Aber das hier, darüber war man sich einig, ging entschieden zu weit. Fröhlich ihre Milchkanne schwingend, kreuzte die Dame Erna Hagemanns Weg. Erna blieb stehen, öffnete den Mund und sagte nur ein Wort: «Miststück.» Das Dorf atmete erleichtert auf. Hagemanns Erna hatte ihre Sprache wiedergefunden.
Bevorzugter Platz am Seeufer war die Bank vor dem morschen Bootsschuppen. Schon ziemlich baufällig stand er umgeben von wuchernden Heckenrosen unter einer Weide, und aus seinem Dach wuchs das Gras.
An den Feiertagen kamen die Liebespaare aus der Umgegend über den See gerudert. Hand in Hand saßen sie dort ungeachtet der Mückenschwärme. Die Mädchen sahen den Myrtenkranz unter dem Glassturz der guten Stube so greifbar vor sich, daß sie darüber ganz vergaßen, wieder rechtzeitig zum Melken und Füttern zu Haus zu sein.
Wilhelm Wetzel, einmal in den Verdacht der Brandstiftung geraten, flüchtete sich dorthin, wo immer es gebrannt haben mochte, und murmelte verstört: «Ich hab’s nicht angezündet.» Auch Albert Engel, der Musiker, bevorzugte diesen Platz. Sonntags morgens klagte sein Horn übers Wasser: «Vorbei ist die Jugend, sie kommt nicht mehr!» Dabei war allen bekannt, daß seine Mutter ihn und seine Geschwister mehr mit den Pantinen in der Hand erzogen hatte als mit Güte und Verständnis.
Nach Feierabend wurde der See häufig zum Familienbad. In Gesellschaft der Kühe, die zur Abkühlung bis zum Bauch im Wasser standen, wusch man sich bedächtig mit viel Kernseife und schlug fluchend mit dem Handtuch nach den gierigen Bremsen.
Nach der Schule stakten wir Kinder den Kahn immer am Schilf entlang bis zum Rhin. In dem grünen Dickicht der Binsen warfen wir unsere selbstgefertigten Angeln aus, deren Schwimmer aus einem alten Flaschenkorken und einem durchgesteckten Hühnerkiel bestanden, begleitet von dem dumpfen Ruf der Rohrdommel und den Stimmen der Frauen in den Koppeln.
Da der See an manchen Stellen so seine Tücken hatte, kaufte Mutter beim Kaufmann ausrangierte große Bonbonbüchsen aus Blech. Sie ließ vom Schmied zwei Ösen daran nieten, zog einen Riemen durch und band sie uns auf den Rücken. Sie trugen vorzüglich, unmöglich, damit unterzugehen. Nur gaben sie leider, wenn die Sonne darauf prallte, explosionsartige Geräusche von sich.
Im Winter verwandelte sich der See in eine riesige Eisbahn. Wer keine Schlittschuhe besaß, schlitterte auf den Pantinen über das Eis oder fuhr mit dem Peekschlitten. Wir bauten uns Schilfhütten, in denen wir auf alten Kartoffelsäcken saßen und Brombeerblätter rauchten. Wir spielten im Mondschein Verstecken in den Binsen und schwenkten mit der Grazie verfolgter Mickymäuse unsere Schlittschuhbeine.
Einmal erschien ein fremdes kleines Mädchen unter uns. Mit ihrem weißen Eiskostüm, der kleinen weißen Pelzmütze und den weißen langen Schlittschuhstiefeln sah sie wie ein Angorahase aus, der sich unter einen Haufen Wildkaninchen verirrt hat. Waren wir doch mit unseren ausgebeulten Trainingshosen und den verwaschenen Windjacken mehr praktisch als modisch gekleidet.
«Bist du vom Zirkus?» fragten wir sie andächtig. Sie lachte nur schnippisch und machte einen eleganten Luftsprung, nachdem sie sich vorher wie ein Kreisel gedreht hatte. Dabei gerieten ihre Schlittschuhspitzen in ein eingefrorenes Schilf. Die Eiskönigin stürzte sehr unangenehm auf ihr Steißbein.
Der See war zu jeder Jahreszeit unser bevorzugter Spielplatz. Die bleierne Stille im Hochsommer vor dem aufziehenden Gewitter über dem Wasser war uns ebenso vertraut wie im Herbst das Brummen der Dreschmaschinen und der schwermütige Singsang der Kreissäge, der vom Nachbardorf auf der anderen Seite des Sees herüberschallte.
Doch dann wurde uns der See von einem Tag auf den anderen so unheimlich, daß fast ein Monat verging, bis wir uns wieder ans Wasser trauten. Das war, als wir Hermännchen vermißten. Wir fanden ihn nach langem Suchen in der Plötzenkuhle. Hermännchen, der sich von uns am besten auf dem See auskannte, mit unfehlbarer Sicherheit wußte, wo die Fischer ihre Reusen gelegt hatten, und am längsten von uns tauchen konnte, war ertrunken.
Unterricht nur bei Windstille
Die sich regelmäßig wiederholende Anzeige in der «Deutschen Allgemeinen Zeitung» lautete etwa so: «Auf märkisches Waldgut, nur 50 Kilometer von Berlin entfernt, in landschaftlich reizvoller Lage, wird Hauslehrerin zu drei Kindern gesucht. Reit- und Badegelegenheit vorhanden. Nachbarlicher Verkehr. Voller Familienanschluß.» Ehrlich gesagt: Die Lehrerinnen kamen, sahen und gingen. Bei allem Drang zur Romantik war ihr Großstadtherz soviel unberührter Natur doch nicht gewachsen.
Kein elektrisches Licht, keine Kanalisation, keine Wasserleitung! Statt dessen blakende Petroleumlampen, eine schlichte Holztonne unter der «sanitären Anlage», eine solide Pumpe in der Küche! Der nächste Weg zum Kaufmann führte über vier Kilometer durch Wald und Heide. Unsere Begeisterung für den beschwingten Trab eines Vollblüters vermochten sie begreiflicherweise nicht zu teilen. Beim Baden zerschnitten sie sich die Füße an den märkischen Miesmuscheln. Die Mücken schienen sich mit besonderer Freude auf die neue Nahrungsquelle zu stürzen. Weite Fahrten mit Pferd und Wagen zur Nachbarschaft empfanden sie bei Hitze oder Kälte nicht unbedingt als Vergnügen. So zogen sieben dieser unglücklichen Geschöpfe durch unser Haus, ehe sich meine Eltern dem Schicksal beugten und uns ins Internat steckten.
Die erste und älteste von ihnen war schon in der Verwandtschaft erprobt und empfohlen worden. Vettern und Kusinen hatte sie zu glänzenden Zeugnissen verholfen. Eine Kusine sollte sogar das Abitur mit «sehr gut» bestanden haben. Auch bei uns zog sie die Zügel an. Meine Schwester, die selbst während des Spaziergangs mit Vokabeln gefüttert wurde, träumte daraufhin nur noch auf französisch und ängstigte meine Mutter des Nachts mit dem Schrei: «Le cheval! Le cheval!« Bei den Mahlzeiten klopfte sie mahnend mit dem Zeigefinger auf den Tisch und warf meinem Vater strafende Blicke zu. Trotzdem gelang es ihr nicht, ihm seine Unart, während der Mahlzeit mit dem Messer zu spielen, abzugewöhnen. Sie betrachtete das als Nichtachtung ihrer pädagogischen Fähigkeiten und ging.
Nummer zwei war jung, hübsch, sanft und wurde von uns Kindern bewundert. Sie blieb acht Tage. Die dritte verlobte sich nach acht Wochen mit einem Vikar aus der Gegend. Vermutlich wurde dadurch beim Lehrerstand das Ansehen unseres Hauses, das schon ziemlich gesunken war, wieder gehoben. Nummer vier war mittelgroß, gertenschlank, trug eine Brille und malte sich die Lippen, was uns ungeheuer interessierte. Sie rauchte unzählige Zigaretten und zwang uns, mit Hut und Handschuhen angetan, mit ihr durch Feld und Wald zu streifen. Ein junger Bulle, dem sie sich beim Pilzesammeln in Verkennung seines Geschlechts arglos genähert hatte, jagte sie über mehrere Koppelzäune und anschließend buchstäblich aus unserem Haus.
Die fünfte schwärmte für meinen Vater, besonders für sein empfindungsreiches Geigenspiel. Ihre unerfüllte Liebe ließ sie kündigen. Seitdem hat mein Vater dieses Instrument nur noch ganz behutsam angerührt. Die sechste interessierte sich sehr für hauswirtschaftliche Dinge. Am glücklichsten fühlte sie sich, wenn sie einen Bohnerbesen selbst in die Hand nehmen konnte. Sie war immer guter Laune und sang viel das Lied: «Zigeuner, du hast mein Herz gestohlen!«
Die siebte und letzte aber war Anthroposophin. Sie las uns herrliche Märchen vor, nach denen wir zeichnen mußten, und sie schenkte uns für jeden gelungenen Aufsatz ein rosa Zuckerschäfchen. Unsere Aufsätze bekamen unter ihrem Einfluß geradezu lyrischen Schwung. Aber dann schlug auch ihr die Stunde. Sie konnte ja nicht wissen, daß man im Havelland an vieles glaubt, aber bestimmt nicht an Seelenwanderung. Als sie bat, das Mädchen möge sie morgens nicht so laut wecken, denn ihre Seele führe dann so abrupt in den Körper zurück, daß ihr ganz elend davon würde, beging mein Vater die unverzeihliche Taktlosigkeit zu singen: «Die Seele schwinget sich wohl in die Luft, juchhe – Der müde Leib bleibt auf dem Kanapee!» Darüber kam sie nicht hinweg.
Der Reigen wurde schließlich durch einen alten pensionierten Lehrer aus dem Nachbardorf geschlossen, der die Güte selbst war. Jeden Morgen kam er zum Unterricht über den See gerudert, nur bei Regen und Wind nicht. Windig war es häufig. Wir schrieben bei ihm nur noch Einsen und Zweien. Unter den Zeugnissen stand: «Der Schüler hat große Fortschritte gemacht.» Bei der Aufnahmeprüfung zur höheren Schule fielen wir alle drei durch. Es half uns nichts, daß mein Bruder das Gleichnis vom verlorenen Sohn ohne Stocken aufsagen konnte und daß sein pathetisch vorgebrachtes Zitat: «Er verbrachte seine Tage mit Prassen!» sichtlich Bewegung in der Prüfungskommission hervorrief. Übrigens bin ich noch heute der Überzeugung, daß er «Prassen» für «Brassen» hielt. Ein gern und oft von uns gefangener Fisch!
Die rasende Pauline
Kein noch so schneller TEE-Zug kann sie mir ersetzen. Unsere Kleinbahn, Pauline genannt, zu Haus in der Mark Brandenburg. Schon damals hatte sie mit den Fernzügen nur wenig gemeinsam. Höchstens die dicken Rußwolken. Sie wirbelten in dichten Schwaden an den kleinen Fenstern vorbei und verwandelten herausgebeugte Kindergesichter in Mohrenköpfe. Selbst gegen einen gewöhnlichen Bummelzug wirkte sie noch wie eine Landpomeranze. Wir liebten sie trotzdem. Für uns waren ihre nach Mist und Zuckerrübenschnitzeln riechenden Güterwaggons, ihre verschmierten Fensterscheiben und die schlecht schließenden Türen an den Personenwagen, auf denen man Jahr für Jahr lesen konnte, wie doof ein Junge namens Richard war, die Verbindung zur großen Welt. Die große Welt, das war alles, was hinter jenem fernen Wald begann. Dort wohnten Menschen, die sogar im Sommer Schuhe trugen und Blindschleichen für Kreuzottern hielten. Das jedenfalls behauptete mein Freund Willi verächtlich.
Unsere Kleinbahn war keineswegs nur ein gewöhnliches Fortbewegungsmittel. Sie war eine Persönlichkeit, geprägt durch den Umgang mit Sonderlingen und Individualisten. Wie Erwin Lamprecht. Stets trug er gegen Regen und Sonnenschein ein geknotetes Taschentuch auf dem Kopf und versuchte, seine Mitmenschen mit Quark und den Büchern Mosis zu heilen. Oder Hermann Leisegang, Tenor des Gesangvereins. Er zahlte lieber jede Strafe, als sich einen Angelschein zu holen.
Unverdrossen schleppte das Bähnlein zwischen den Dörfern hin und her, was man so zum Leben braucht. Kartoffeln und die Milchkannen. Holz, Zuckerrüben und die Kohlen. Enten- und Gänseküken. Selbst Heidepriems Ziege begab sich darin auf die Hochzeitsreise. Auch die Post wurde mit Pauline befördert. Die Zeitung und der Klatsch! Kaum zu glauben, was unterwegs alles passierte! Freche Lümmel hatten heimlich den Milchwagen abgehängt. Die Kleinbahn mußte umkehren mitsamt einem Sarg, was die Beerdigung sehr verzögerte. Der Lokomotivführer hatte vergessen, auf unserer Station zu halten, und meine elegante Tante mußte über die Felder zu Fuß trotten. Eine verrückte Kuh hatte die Bahn attackiert und fast den letzten Wagen aus dem Gleis geworfen.
Gretchen, die tugendsame Konfirmandin, hatte sich auf dem Weg zum Konfirmandenunterricht, anstatt sich in die Zehn Gebote zu vertiefen, mit dem Lehrerssohn in der zweiten Klasse geküßt, obwohl das schamlose Ding nicht einmal eine Fahrkarte dafür besaß. Wer konnte sich da wundern, daß besagtes Gretchen, nachdem sie ein Jahr später nach Berlin «gemacht» war, um dort ein Filmstar zu werden, mit Zwillingen zurückkehrte.