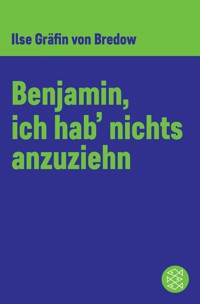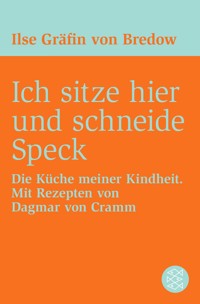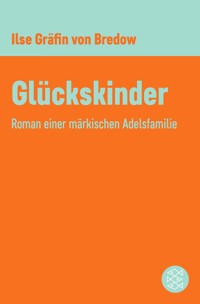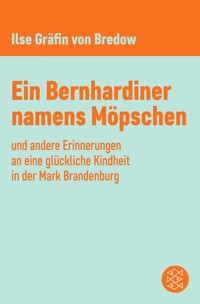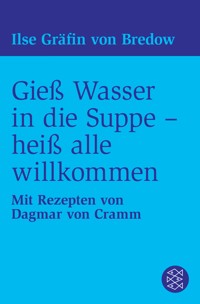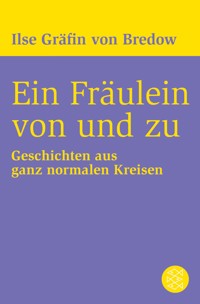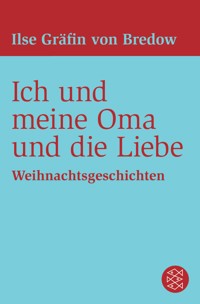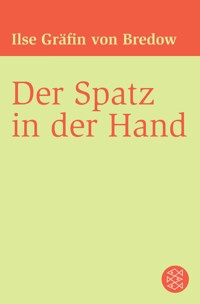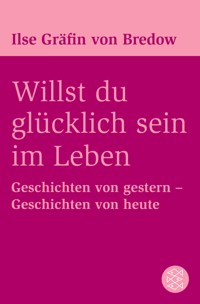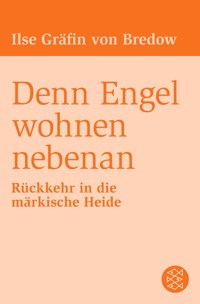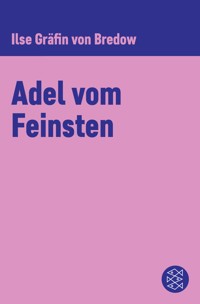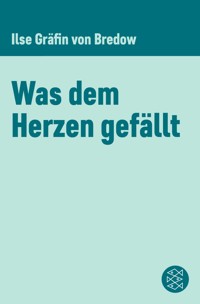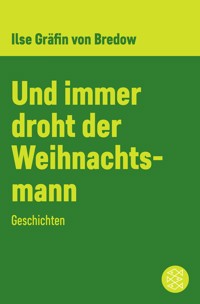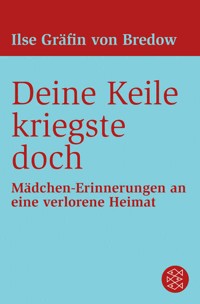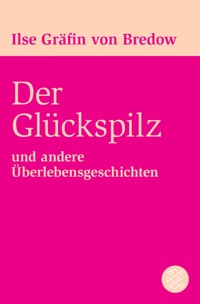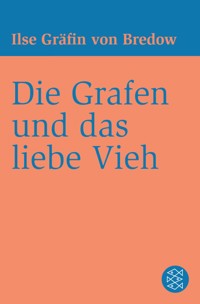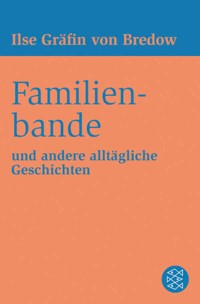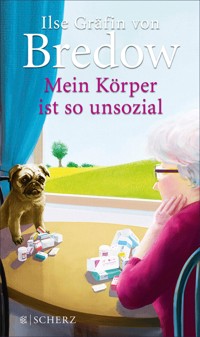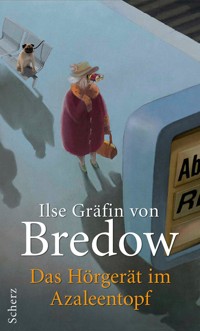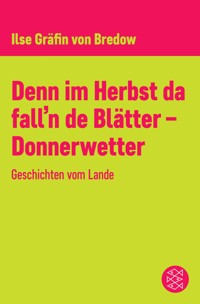
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In den Kindheitserinnerungen der Erzählerin Ilse Gräfin von Bredow hat die dunkle, kalte Zeit des Jahres ihre eigenen Reize: Das Wetteifern mit den Städtern beim Brombeersammeln, Herbststürme, die alles durcheinander wirbeln, Treibjagden, Schlachtfeste und gefährliche Schlittenfahrten. Ein tolpatschiger Bernhardiner auf Abwegen, ein Schwein, das sich mit ihm anfreunden will, und eine Menge Katzen, Hühner und Mäuse spielen bei diesen aufregenden Erlebnissen eigene Rollen. Nebenbei zeichnet Ilse Gräfin von Bredow mit gewohntem Witz ein liebevolles Familienporträt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ilse Gräfin von Bredow
Denn im Herbst da fall'n de Blätter – Donnerwetter
Geschichten vom Lande
Über dieses Buch
In den Kindheitserinnerungen der Erzählerin Ilse Gräfin von Bredow hat die dunkle, kalte Zeit des Jahres ihre eigenen Reize:
Das Wetteifern mit den Städtern beim Brombeersammeln, Herbststürme, die alles durcheinander wirbeln, Treibjagden, Schlachtfeste und gefährliche Schlittenfahrten. Ein tolpatschiger Bernhardiner auf Abwegen, ein Schwein, das sich mit ihm anfreunden will, und eine Menge Katzen, Hühner und Mäuse spielen bei diesen aufregenden Erlebnissen eigene Rollen.
Nebenbei zeichnet Ilse Gräfin von Bredow mit gewohntem Witz ein liebevolles Familienporträt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER digiBook
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Nicole Lange, Darmstadt
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490786-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorwort
1 Die Katze mit dem ab’n Schwanz
2 Der Triumph
3 Der unvergessliche Hannibal
4 Der Morgenkuss
5 Ordnung ist das halbe Leben
6 Möpschens Geheimnis
7 Herbststürme
8 Alles für die Katz
9 Das Brillenkind
10 Trommel, Pfeife und Gewehr
11 Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt?
12 Die Treibjagd
13 Der ideale Lebenszweck
14 Grüne Woche und Kurmärkerball
15 Mamilein
Vorwort
Wenn wir Alten an unsere Kindheit und Jugend auf dem Lande denken, ist immer Frühling oder Sommer. Wir schwärmen von lauen Frühlingslüften, als Natur und Liebe in voller Blüte standen und wir, begleitet von Glühwürmchen, behängt mit Pfefferkuchenherzen und beschwipst von Waldmeisterbowle, kichernd über Kiefernwurzeln stolpernd, durch den Wald vom Schützenfest heimwärts zogen. Voller Verklärung sind auch die Sommer. Kein Gedanke mehr daran, dass es wochenlang nur Strippen regnete oder ein eisiger Ostwind unsere Beine blau färbte. Wir erinnern uns nur an duftendes Heu, flimmernde Hitze über Wiesen und Äckern, an sternenklare Nächte, in denen wir, vom Mond beschienen, noch lange gemeinsam mit den Kühen im See herumplanschten und aus dem Garten sonnendurchwärmte Erdbeeren naschten, an lärmendes Kindergetobe durch Park und Haus, was die Erwachsenen zur Verzweiflung brachte. Herbst und Winter dagegen spielen in unserer Erinnerung kaum eine Rolle. Nur das immer Wiederkehrende wie Kartoffelfeuer, Drachensteigen und wie wir, «Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne» plärrend, mit Lampions in der Hand durchs Dorf zogen, fällt uns dazu ein, und im Winter Advent, Weihnachten und Schnee. Dafür liegen uns für diese Jahreszeiten mehr alberne Sprüche auf der Zunge wie «Dunkel war’s, der Mond schien helle auf die schneebedeckte Flur, als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr» oder auch «Denn im Herbst, da fall’n de Blätter – Donnerwetter! Und im Winter wer’n se alle Matsch – so’n Quatsch.«
Dabei gab es doch in den Herbst- und Wintermonaten keineswegs nur Nebel, kalte Füße und nasse Socken oder gar stumpfsinniges Herumsitzen hinter dem warmen Ofen. Im Gegenteil, auch sie waren voller aufregender Erlebnisse. Im Herbst wetteiferten wir mit den Städtern darum, uns gegenseitig die Früchte des Waldes und der Koppeln vor der Nase wegzuschnappen, und Vater stöhnte laut im Schlaf, weil im Traum ein Mann aus Rathenow namens Krause mit einem übervollen Eimer Brombeeren flott an ihm vorbeimarschierte. Es gab vom Jagdfieber gepackte Gäste, die stundenlang bei niedrigen Temperaturen regungslos auf dem Hochsitz ausharrten, um endlich, endlich den erträumten stattlichen Zwölfender zu erlegen, und am nächsten Tag vor lauter Heiserkeit kaum noch sprechen konnten. Herbststürme wirbelten die Milchkannen durcheinander und brachten unsere Postfrau fast zu Fall, und Möpschen geriet mal wieder auf Abwege und bekämpfte sein Rheuma heimlich mit Alkohol. Auch der Winter konnte es durchaus mit dem Sommer aufnehmen. Treibjagden standen ebenso auf dem Programm wie gefährliche Schlittenfahrten, das Schlachtfest, das nicht stattfinden konnte, weil das Schwein abhanden gekommen war, und als Höhepunkt für die Eltern Kurmärkerball und Grüne Woche – alles Ereignisse, die das allmählich versiegende Reservoir von Familienanekdoten wieder kräftig auffüllten.
1Die Katze mit dem ab’n Schwanz
Der Altweibersommer konnte durchaus mit seinem Vorgänger Schritt halten, wenn vielleicht das Thermometer auch nicht mehr ganz so in die Höhe schnellte. Dafür war er, wie mein Onkel unter den missbilligenden Blicken meiner Tante gern wohlwollend bemerkte, so mild wie der Beischlaf eines kommandierenden Generals. Silberfäden schwebten durch die Luft und glitzerten im Morgentau auf Sträuchern und Wiesen. Die Schwalben sammelten sich, und die vom Reisefieber geplagten Stare lärmten aufgeregt in der großen Pappel vor dem Haus. Statt Johannisbeeren, Erdbeeren und Himbeeren gab es reichlich Äpfel und Birnen und vor allem Zwetschen, die wie übergroße Weintrauben in den Bäumen hingen. Selbstverständlich wurden wir alle zum Aussteinen eingespannt, leider auch ich. Vorbei die Zeit, als ich noch auf Mamsells Schoß sitzen durfte, sie liebevoll nach den Fingern meiner rechten Hand griff und abzählte: «Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen, der hebt sie auf, der trägt sie nach Haus, und der Kleine isst sie ganz alleine!» Längst war mir nicht mehr gestattet, nur zum Naschen in der Küche zu erscheinen. Auch der Spruch «Messer, Gabel, Scher’ und Licht sind für kleine Kinder nicht» galt nicht mehr und war durch «Was Hänschen nicht lernt …» ersetzt worden.
Mamsell band mir eine Schürze um, stellte eine Schüssel vor mich hin und drückte mir mit den Worten «Nun zeig mal, was du kannst» ein Messer in die Hand. Das Aussteinen der häufig nicht immer sehr reifen Zwetschen erwies sich als ziemlich mühsam. Ebenso das Kartoffelbuddeln. Dabei musste man, einen Kartoffelsack unter den Knien, die Furchen entlangrobben, mit Kraftanstrengung die Stauden herausziehen und dann mit der Hacke die Knollen so geschickt ans Tageslicht fördern, dass man sie dabei nicht anhackte. Außerdem durfte man nicht vor lauter Eile, an das versprochene Futter für das Sparschwein heranzukommen, die Hälfte übersehen. Da weckten auch der anspornende Spruch der Erwachsenen «Ohne Fleiß kein Preis» und die Aussicht auf ein herrliches Kartoffelfeuer oder, wie jetzt bei den Zwetschen, auf Pflaumenkuchen und Pflaumenmus wenig Begeisterung, jedenfalls nicht bei mir.
Mein dezenter Hinweis, ich bekäme doch am Wochenende Besuch und müsse dringend meine Spielecke im Kinderzimmer und mein Fach im Nippesschrank aufräumen, stieß bei Mamsell auf taube Ohren. Das Einzige, was sie von sich gab, war das verhasste «Fleißige Hände bringen schnell ein Ende». Und ich versank mal wieder in Grübeln, wieso ein so nettes Kind, wie ich es war, in diesem Haus so wenig Verständnis fand.
Auch das Interesse an meinem Besuch war nur gering. «Ach herrje, die steht uns ja auch noch bevor», war alles, was Mutter sagte, als ich sie daran erinnerte. Dabei war Erika, meine neue Freundin aus der Laubenkolonie, mit ihrem rosa Schlüpfer, der süßen Katze mit dem ab’n Schwanz und einem Vater, der, wenn es darauf ankam, als Bierkutscher sogar mit einem Achterzug fahren konnte, nun wirklich nicht vergleichbar mit irgendeiner popligen Kusine. Ich hatte Erika während meines Besuches in den Sommerferien bei Tante Armgard in Potsdam kennen gelernt. Seitdem führten Erika und ich einen regen Briefwechsel. Und nun, in den Herbstferien, kam sie für eine Woche zu uns.
Erikas Eltern machten nicht so viel Heckmeck wie meine. Sie schickten sie selbstverständlich allein los, im vollen Vertrauen darauf, dass ihr der Schaffner oder eine andere hilfsbereite Person schon beim Umsteigen behilflich sein würde. Sie sollten Recht behalten. Der Schaffner unserer Kleinbahn ließ sich sogar herab, ihren Deckelkorb bis zu unserem Wagen zu tragen und ihn hineinzuwuchten, allerdings nicht, ohne sie mürrisch zu fragen: «Schleppste Steine mit dir rum, oder wat?«
Erika, mit der Bommelmütze und kariertem Mäntelchen, lachte scheppernd, sodass unsere Liese, die gerade in kontemplativer Haltung mit hängendem Kopf vor sich hin döste, erschreckt zusammenfuhr, kletterte auf den Wagen und setzte sich neben mich. Mein Bruder schnalzte mit der Zunge, und ab ging die Post im gewohnten Schneckentempo.
Der Inhalt des Korbes entpuppte sich als eine Fundgrube herrlicher Mitbringsel. Meine Mutter wurde mit einem von Erika gehäkelten Kaffeewärmer bedacht, mein Vater mit selbst gebrautem Birnenschnaps, mein Bruder konnte sich an einem halben Dutzend Angelhaken erfreuen, Mamsell an einer Flasche Eierlikör, die Mädchen an Quittenbrot und ich an etwas, das Vater ein Danaergeschenk nannte: der süßen Katze mit dem ab’n Schwanz, die allerdings, seitdem ich sie zum letzten Mal gesehen hatte, eher noch mickriger geworden war. Mutter sagte: «Ach du lieber Gott», und Mamsell machte ihr Nur-über-meine-Leiche-Gesicht und erklärte entschieden: «Eine Katze im Haus – so weit kommt’s noch! Die gehört in den Stall. Oder noch besser, Erika nimmt sie wieder mit.» Doch als sie mein betrübtes Gesicht sah, fügte sie einlenkend hinzu: «Na, wir werden mal sehen.«
Zum Glück wurde die Miezekatze von Möpschen akzeptiert und das wahrscheinlich nur, weil sie so angenehm nach Birnenschnaps roch. Anscheinend hatte der Korken auf der Flasche nicht fest genug gesessen. Möpschen beschnupperte sie wollüstig und begann dann, sie abzulecken, was die verschüchterte neue Hausgenossin ohne Widerstand über sich ergehen ließ. Und so war der Burgfrieden in der Küche nicht gefährdet. Trotzdem duldete Mamsell die Katze nur ungern in der Küche. «Dauernd stolpert man über das Vieh, und sie macht sich an alles ran.«
Dagegen gewann Erika Mamsells Herz im Handumdrehn. Sie hatte nicht wie ich, was Mamsell nicht oft genug betonen konnte, fünf linke Daumen, sondern war sehr geschickt, schälte die Kartoffeln hauchdünn, knetete den Hefeteig mit großer Energie und knallte ihn auf den Tisch, dass das Geschirr klirrte, bis er vorbildlich locker war, rollte ihn auf dem Kuchenblech aus, belegte ihn wieselflink mit Pflaumenhälften und schob ihn in den Ofen. Sie fand alles bombig und knorke, und ich war mächtig stolz auf sie und hörte gar nicht hin, wenn meine Schwester mir meine Freundin vermiesen wollte, weil sie sich darüber ärgerte, dass Erika mindestens ebenso patent war wie sie. Vor allem Vater wusste Erika zu schätzen. Sie half ihm eifrig beim Sägen, und im Gegensatz zu uns gab es bei ihr keine Probleme mit dem Sägeblatt, das sonst ständig klemmte, weil wir nicht den richtigen Rhythmus raushatten.
Aber eines Tages wäre das allgemeine Einvernehmen fast noch empfindlich gestört worden, denn Mamsell war mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden. Als Erstes bekam die unglückliche Katze ihre schlechte Laune zu spüren, weil sie mal wieder auf dem Regal über dem Herd herumturnte, was für Mamsell sowieso ein Stein des Anstoßes war. Ihre Stimme hob sich zu einem kreissägenhaften Ton, und die Katze floh, so schnell ihre kümmerlichen Beinchen sie tragen konnten. Mamsell schob den Topf mit den ausgesteinten, eingezuckerten Zwetschen auf die Herdplatte und befahl uns, für die nötige Hitze zu sorgen, damit die Zwetschen köchelten. Denn die beiden Mädchen hätten ihren freien Tag, und sie lege sich jetzt mal ein Stündchen hin. Wir wagten nicht zu widersprechen, obwohl wir viel lieber mit meinen Puppen Schule oder Mutter und Kind gespielt hätten. Während wir noch über Mamsells Ansinnen vor uns hin maulten, was wir aber wohlweislich erst taten, als sie die Küche verlassen hatte, machte es plötzlich «platsch», und auf dem Herd begann es fürchterlich zu rumoren. Wir stürzten hin und sahen die Katze zwischen den Zwetschen zappeln. Wahrscheinlich war sie bei dem Versuch, wieder mal auf das Regal zu springen, abgerutscht. Erika griff blitzschnell zu, warf sie in einen neben dem Herd stehenden Eimer und wusch das völlig verschreckte Tier unter der Pumpe, und ich mühte mich, jeden sichtbaren Spritzer auf Herd und Kacheln zu beseitigen. Erika rubbelte wie besessen an der armen Katze herum, um sie einigermaßen trocken zu kriegen, während ich bei der Vorstellung, Mamsell könne plötzlich erscheinen, fast vor Angst verging. Das tat sie glücklicherweise erst, als in der Küche wieder Ordnung herrschte und die Katze draußen in der Sonne saß und sich ihr Fell glatt leckte. Mamsell musterte stirnrunzelnd einige von mir vergessene Musspuren auf dem Schrank und fragte: «Wie kommen denn die dahin?«
Ich beeilte mich, ihr zu erklären, dass, wie immer, der Herd mit seiner ungleichen Hitze daran schuld sei. Das Mus habe plötzlich nur so gesprudelt, was Mamsell sehr wunderte, denn der Topf war nur lauwarm. Aber zum Glück ging sie der Sache nicht weiter nach, sondern brachte nun selbst den Herd ordentlich in Fahrt, wobei sie ihn wie häufig halblaut beschimpfte. «Schrotthaufen» und «Miststück» war noch das Freundlichste, was sie von sich gab.
Die Katze ließ sich erst nach Stunden wieder blicken. Sie sah immer noch ziemlich mitgenommen aus. Zwei Tage vor Erikas Abreise gelang es ihr dann doch noch, Mamsells Herz zu gewinnen. Sie fing in der Küche vor ihren Augen eine wohlbeleibte Maus und legte sie ihr mit stolzem Miauen vor die Füße. Mamsell streichelte sie lobend. «Vielleicht bist du ja doch ganz nützlich», sagte sie, und ich atmete auf.
Das Pflaumenmus schmeckte allen vorzüglich, nur Vater machte bei der Vesper plötzlich ein etwas verdutztes Gesicht und sagte: «Komisch, irgendwie habe ich das Gefühl, Katzenhaare im Mund zu haben.«
Mutter sah ihn nachsichtig an. «Also wirklich. Wie sollten die wohl ins Mus kommen?«
«In diesem Hause», sagte Vater, «ist man doch vor nichts sicher.«
2Der Triumph
Wie immer in dieser Jahreszeit erwachte in uns ein Jagdfieber besonderer Art. Ständig hechelten wir Möpschen gleich suchend durch die Gegend, um die Früchte des Waldes und der Heide, wie Bucheckern, Haselnüsse, Kastanien und Eicheln, Pilze, Blaubeeren und Brombeeren, ausfindig zu machen, von der Angst getrieben, jemand könne uns zuvorkommen und die Beute wegschnappen. Konkurrenten gab es schließlich genug. Dazu zählten besonders die verhassten Städter, die juchzend den Wald unsicher machten und sich lautstark zuriefen: «Sind da welche?», was sich vor allem auf die Brombeeren bezog.
Mein Bruder war ein Ass im Auskundschaften. Selbst der kleinste Pilz war vor seinen scharfen Augen nicht sicher. Nicht nur die Eltern, auch Lehrer Scheel wusste sein Spähertalent zu schätzen und zog mit ihm los, während wir verdonnert wurden, uns in Schönschrift zu üben. Dafür nahm mein Bruder sich das Recht, beim Pflücken nur als Zuschauer dabei zu sein, und bediente sich, wenn Mamsell ihm nicht eins auf die Finger gab, ungeniert aus dem gefüllten Eimer. Von ihm stammte die geniale Idee, zur Abschreckung anderer Sammelwütiger ein Pappschild mit einem Totenkopf und dem warnenden Hinweis «Achtung Kreuzottern!» vor den Büschen aufzustellen. Vater war beeindruckt. «Einfälle hat der Junge, wirklich phänomenal!«
Mutter wiederum erwähnte gern im größeren Familienkreis, wo jede Mutter bemüht war, ihre Brut herauszustreichen, die wirklich schöpferische Fantasie meines Bruders und erzählte ausführlich – ein wenig zu ausführlich, wie man insgeheim fand –, mit welch anschaulichen Geschichten er die unschlüssig auf das Warnschild starrenden Städter verschreckt hatte. Dass Vater dabei aber mal wieder durch seine gedankenlose Fragerei alles fast zunichte gemacht hatte, erwähnte sie nicht. Mein Bruder, berauscht von seinen eigenen Einfällen, war gerade im Begriff, vor einem staunenden Publikum den schrecklichen, von einem Kreuzotterbiss verursachten Tod einer immer noch sehr lebendigen Tante laut röchelnd mimisch darzustellen, als Vaters Frage «Was denn für ’ne Tante, Junge?» ihn völlig aus dem Konzept brachte.
Auch Vater war nicht gerade einfallslos, wenn es darum ging, sich Konkurrenten vom Leibe zu halten. Oft trafen wir, mit vollen Kannen auf dem Heimweg, andere Sammeljäger, die neidisch auf unsere Brombeeren kuckten und, zugegebenermaßen etwas naiv, fragten: «Wo gibt’s denn welche?» Vater, der uns stets ermahnte, großzügig zu sein und nicht zu raffig, schickte sie grundsätzlich mit den Worten «Dort, hinter der Schonung gibt es massenweise» in die entgegengesetzte Richtung.
Mutter und Mamsell schüttelten ungehalten die Köpfe, aber sie korrigierten ihn nicht. Im Übrigen teilte er die Ansicht meines Bruders, dass Frauenhände zum Pflücken besser geeignet seien, und wies mit seinem Spazierstock gern auf besonders üppige, vollreife Früchte, die entweder so hoch hingen, dass man nach ihnen hätte springen müssen, oder von Dornen geradezu umstellt waren. Wenn wir zögerten, meinte er: «Nun stellt euch man nicht so an! Die paar Schrammen werdet ihr schon überstehen!» Möpschen war eher unserer Ansicht. Er hatte sich einen Dorn in die Pfote getreten, an der er winselnd herumleckte.
Am leichtesten hatten wir es mit den Holunderbeeren. Holunderbüsche gab es reichlich am Backhäuschen, hinter der Scheune und am Pferdestall. Schon beim Ernten freuten wir uns auf die von Mamsell versprochene warme Holundersuppe mit Apfelstückchen, Grießklößen und Häubchen aus Eischnee.
Das Sammeln von Kastanien und Eicheln blieb allein uns Kindern vorbehalten. Wir besserten damit unser Taschengeld auf und verkauften sie an Vater zur Wildfütterung, zwei Mark den Zentner. Vater konnte sich über einen so hohen Preis gar nicht beruhigen. «Das ist ja Wucher!«
Dagegen waren bei den Champignons die Eltern, Mamsell und die Mädchen wieder mit von der Partie. Vater verkündete wie immer lautstark, dass ihm diese Pilze ebenso köstlich schmeckten wie Morcheln oder Trüffeln.
«Sagten Herr Graf Trüffeln?» Mamsell sah ihn fassungslos an. «Das ist doch nun wirklich das Edelste, was eine Küche zu bieten hat. Und der wertvollste Pilz auf Erden. Allein dieser Duft!» Sie verdrehte entzückt die Augen.
«Mamsell hat völlig Recht», sagte Mutter. «Champignons mit Trüffeln zu vergleichen!«
Vater war pikiert. «Ich weiß, ich weiß. In deinem Elternhaus gehörten sie natürlich zum Stammgericht.«
«Du hast den Kaviar vergessen.» Mutter kam langsam in Fahrt.
Interessiert lauschten wir dem Geplänkel. Aber schon fuhr uns Vater an: «Was steht ihr eigentlich hier rum? Warum seid ihr nicht längst im Stall und spannt die Liese an, damit wir endlich loskönnen? Womöglich kommt uns noch jemand zuvor!«