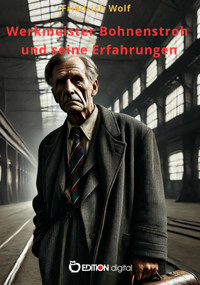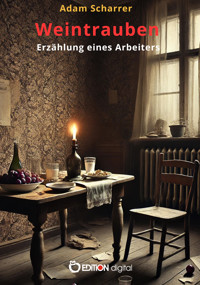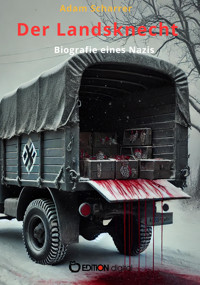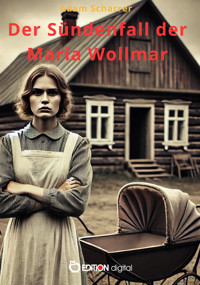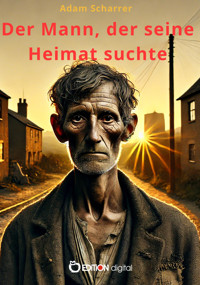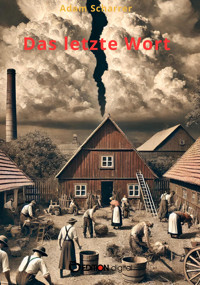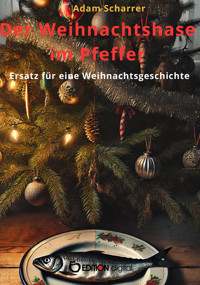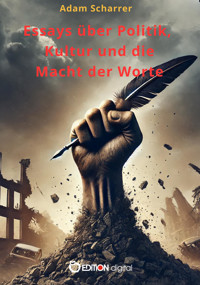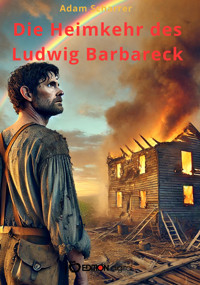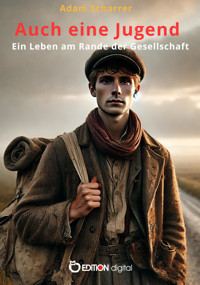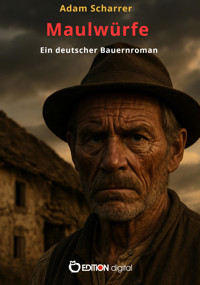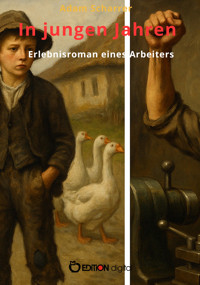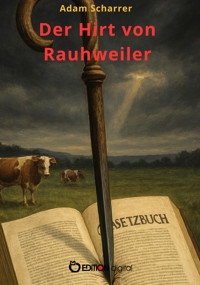7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman über Armut, Aufbruch und das zerbrechliche Versprechen von Gerechtigkeit – so eindringlich wie zeitlos. In den Straßen Berlins nach dem Ersten Weltkrieg kämpfen Albert Buchner, seine Frau Margot und ihre Kinder ums nackte Überleben. Zwischen Fabrikarbeit, Hunger, Wohnungsnot und politischer Repression zerbricht langsam, was einmal Hoffnung hieß. Inflation frisst das Brot, Not treibt zur Selbstaufgabe, und der Traum von sozialer Gerechtigkeit zerschellt an der rauen Wirklichkeit der Weimarer Republik. Adam Scharrer – selbst Arbeiter und politisch Verfolgter – erzählt mit scharfem Blick und tiefer Menschlichkeit von den Zumutungen der Zeit: von den Schicksalen der Vergessenen, den Widersprüchen der sogenannten Demokratie, von politischer Desillusionierung und mutigem Widerstand. „Der große Betrug“ ist ein erbarmungslos ehrlicher Gesellschaftsroman über den Verrat an der Arbeiterklasse – aber auch ein stilles Denkmal für Würde, Solidarität und den ungebrochenen Willen, Mensch zu bleiben. Ein Werk von brennender Aktualität – erschütternd, anklagend, unvergesslich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Adam Scharrer
Der große Betrug
Die Geschichte einer Arbeiterfamilie
ISBN 978-3-68912-453-3 (E–Book)
Das Buch erschien erstmals 1931 im Agis-Verlag, Wien, Berlin. Als Grundlage des E-Books diente die 2. durchgesehene Ausgabe, die 1951 im Thüringer Volksverlag GmbH, Erfurt erschien.
Das Titelbild wurde mit der KI erstellt.
© 2025 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
I
Die Gemeinde Marianneneck liegt eine Stunde Fußweg von Pinne und ebenso weit von Tirschtiegel entfernt. Von da ist in zwei Stunden Bahnfahrt Posen, die nächste größere Stadt, zu erreichen. Marianneneck zählt einige hundert, Pinne und Tirschtiegel je einige tausend Seelen. Einige Verkaufsläden befriedigen die Bedürfnisse der armen Bauern der näheren Umgebung, daher kommen diese nur selten, viele nie in ihrem Leben nach Posen oder gar noch weiter. Denn das kostet Zeit und Geld. So war das in den Siebzigerjahren.
Natürlich hatten der Pfarrer, der Müller und der Pferdehändler Korkovski öfter in Posen zu tun. Auch die wenigen wohlhabenden Bauern leisteten sich einige Mal im Jahre das Vergnügen, schon darum, weil ihre Töchter nicht immer den passenden Mann in der Gegend finden konnten oder wollten. Damit ist aber die Liste der maßgebenden Bürger von Marianneneck bereits zu Ende. Eines der beiden Wirtshäuser versorgte die Einwohner außer mit Bier und Schnaps auch mit Spezereien. Einen andern armseligen Laden hatte der alte Schuster seiner Tochter, die mit einem Kind sitzen geblieben war, vererbt, aber der ging sehr schlecht, brachte gerade soviel ein, dass die Inhaber nicht verhungerten. Die Hauptkundschaft bildeten die Gutsarbeiter.
Und, Teufel! – natürlich hatten die Gutsarbeiter auch einen ,Herrn‘, den hätten wir fast vergessen, obgleich der auf drei Viertel des Grund und Bodens innerhalb der Gemeindegrenze von Marianneneck Anspruch erhob.
Doch persönlich hatten die Herren von Mottermark mit Marianneneck wenig zu tun. Sie nahmen nur wenige Monate im Jahr im Schloss Wohnung. Die Holzfäller beaufsichtigte ein im herrschaftlichen Dienste ergrauter Vorarbeiter; für Wald, Wild und Fischteiche machte der Oberförster seine Gehilfen verantwortlich; für das Ganze, inklusive des amtlichen Verkehrs mit der Gemeinde und die Instandhaltung von Schloss und Park, war der Inspektor da. Dieser hatte daneben noch die Wünsche einer alten, mageren, weißhaarigen Frau zu erfüllen, die ständig, in Begleitung von krummbeinigen Dackeln, im Schlossgarten umherschlich und von der niemand wusste, wer sie ist.
An gesellschaftlichen Ereignissen war gelegentlich ein Ball des ,Soldatenvereins‘ oder des Gesangvereins ,Eiche‘ zu verzeichnen. Dann war noch die freiwillige Feuerwehr und der ‚Arbeiterverein‘. Einige Mal im Jahr war im Dorf oder der Umgegend auch ein Sängerfest fällig und hie und da eine Wahl. Es gab Besoffene, Prügelei, manchmal auch einen Toten und deswegen einen Prozess. Auch kam es vor, dass bei der Treibjagd einige Treiber angeschossen wurden. Sonst erschöpften sich die Probleme, die in Marianneneck gewälzt wurden, in der Feststellung, dass es regnet oder dass die Sonne scheint, die Ernte gut oder schlecht wird; der Sohn von dem und dem Soldat wird, und wo; dass der und die heiratet und wen und wohin; dass der Gutsinspektor einen Mann oder eine Frau verprügelte, oder der junge Herr ein Mädchen schwängerte und diese sich dann überreden ließ, einen Gutsarbeiter zu heiraten, der auf Anraten des Inspektors die Vaterschaft anerkannte, weil er so Arbeit zu behalten und Gutswohnung zu erhalten hoffte.
Fremde blieben selten in Marianneneck hängen. Doch auch diese Regel blieb nicht ohne Ausnahme. Als nach Marianneneck Wasserleitung gelegt wurde – die Mottermark waren der Meinung, dass diese nötig sei – nahm auch der alte Linnet einen von den Dreckschauflern ins Quartier. Hyronimus Buchner hieß der, war aus dem Niederbayrischen gebürtig und kam nun aus dem Tschechischen herüber, ohne Beruf, Kluft und Geld, und wollte sich ein bisschen rausmachen.
Er hat sich rausgemacht! Nach drei Wochen kamen in dem neuen Anzug und dem neuen Schlips, um den wetterharten Kragen seine frühkartoffelfarbenen Kraushaare schon ganz anders zur Geltung. Und immer, wenn der alte Linnet darauf anspielte, dass die Arbeit ja nun bald ein Ende hätte, sagte Hyronimus gewöhnlich: „Ja, hat wohl bald ein End’!“ Weiter sagte er nichts.
Dem alten Linnet dauerte die Einquartierung beileibe nicht zu lange. Er war nur der Meinung, dass die Arbeit bald getan ist, obgleich sich Hyronimus schon ganz gut eingewöhnt hatte. Der fütterte die Gänse, räumte den Hof auf, stampfte das bisschen Milch zu Butter, hackte Holz, als müsse das eben so sein. Kein Wunder! Die jüngste Tochter des alten Linnet, die einzige, die noch zu Hause war und abwarten musste, bis der alte Linnet starb, hatte schon mehr als einen verrückt gemacht.
Als dann die Gräben und Löcher wieder zugeschaufelt waren, kam Hyronimus nach Hause und erzählte, dass er am andern Tag in der Ziegelhütte anfange und weiter in Quartier bleiben wolle. Der alte Linnet fragte darauf seine tollkirschenäugige Kascha, und die sagte, dass es ihr schon recht sei. Bald darauf musste Hyronimus die Kascha heiraten, weil es nicht mehr anders ging.
Wäre dieser Zwang nicht gewesen, hätte sich Hyronimus vielleicht doch wieder losgerissen. So aber entschied er sich, seine weltumspannenden Pläne aufzugeben.
Ehe der alte Linnet starb, waren nämlich schon zwei Kinder da. Und mit vier Mann und ohne Geld auszureißen, das ist eine recht waghalsige Sache.
Da war wohl das Häuschen, die Scheune, die paar Äcker, ein Stück Wald, der Obstgarten. Aber der alte Linnet hatte testamentarisch dafür gesorgt, dass das Linnetsche nicht unter den Hammer kam. Er hatte noch neun lebendige Kinder herumlaufen, die alle auf ihren Anteil warteten. Denen hatte er pro Nase einhundertfünfzig Mark väterliches Erbe ausgesetzt, nachdem sie das mütterliche Teil schon erhalten hatten. Das mütterliche Erbteil hatte ein Acker eingebracht, den er gut an die Ziegelhütte loswurde, weil der Lehm unter dem Humus mehr wert war, als der Humus selbst. Für das Erbteil väterlicherseits war der Wald ausersehen, den der Herr schon immer haben wollte. Und dann – hatte der alte Linnet bestimmt – kann Haus und Garten und Scheune und Stall immer noch hübsch beisammen bleiben. Nur unter dieser Bedingung konnte Hyronimus sich mit seiner Kascha in das Nest des alten Linnet setzen. Andernfalls konnte sich die Kascha auszahlen und ihren Bruder einziehen lassen.
Nun überlegte Hyronimus. Wenn der Monat herum ist und kein Hauswirt hält die Hand auf: Das ist was wert. Und die Milch von der Kuh, die Eier von den Hühnern und die Bettfedern von den Gänsen: das rechnet. Dann ein Schwein im Jahr dazu: Da kann man dann schon einmal in der Stube sitzen bleiben, wenn es draußen gar so friert und tobt. Aber immer wieder musste er sich diese Vorteile vor Augen halten. Es fiel ihm schwer, dieses Leben. Er hatte viel in sich niedergerungen. Fünf Kinder hat er großgezogen, vier Jungens und ein Mädel. Anna ist mit einem Gutsarbeiter nach Amerika ausgewandert und verschollen. Zwei Söhne hatte er im Kriege verloren; Fritz fiel in Galizien, Heinrich im Elsass. Übrig geblieben sind der jüngste, der Karl, und der älteste, der Albert.
Ein Handwerk hat nur Karl erlernt, die andern mussten sofort nach der Schulentlassung aus dem Haus, um sich ihr Futter selbst zu verdienen. Albert war Knecht bei Korkovski, dem Pferdehändler. Später ging er zur Ziegelhütte, weil er als Knecht das Essen, das er verdiente, nicht mit seiner Frau und seinen Kindern teilen konnte. Er wohnte noch bei den Eltern. Geheiratet hatte er auch schon recht früh oder ist vielmehr geheiratet worden.
Im Tanzen konnte Albert nicht und im Saufen wollte er nicht mithalten. Wenn ihn die anderen damit foppten, dass er ja noch gar nicht wisse, dass es zweierlei Menschen gibt, dann war das wohl insofern richtig, als Albert dies mit zweiundzwanzig Jahren noch nicht ausprobiert hatte. Als er dann gar, weil ihm ein Pferd den Arm zerbissen hatte, nicht zum Militär genommen wurde, meinte der Großknecht, dass Albert wohl nicht richtig was zwischen den Beinen hat; anders kann doch das nicht sein bei einem Kerl, der fressen kann wie ein Ochse und auch einen Kopf hat wie ein Ochse.
„Festhalten!“, schrie in diesem Augenblick der Tierarzt durch das Gelächter der Männer, von denen je ein halbes Dutzend an vier Tauenden zerrte, um dem am Boden liegenden Hengst die Vorderbeine so weit als möglich nach hinten und die Hinterbeine nach vorn zu ziehen, damit ihm der Tierarzt die Hoden herausschneiden konnte. Vielleicht hätte Albert auch den Vergleich mit dem Ochsen stumm in sich hineingefressen, vielleicht auch noch den blöden Scherz des Großknechts hingenommen, den der sich mit den nun im Stroh herumliegenden Pferdehoden erlaubte. Aber da steckte mit einem Male die zweite Magd des Müllers den Kopf zur Scheunentür herein und fragte, ob der junge Müller da sei.
„Ja, der ist da“, log der Großknecht und blinzelte faunisch um sich. Dann ging er auf die Margot zu. Diese schrie mit einem Male schrill auf und wollte davonlaufen, doch der Großknecht hatte sie am Rock erwischt. Draußen warf sie sich verzweifelt auf einen Strohhaufen und hielt sich die Halsöffnung der Bluse zu. Der Großknecht wollte ihr aber den Pferdehoden gerade vorn unter die Bluse stecken, und ein anderer, noch junger, blöd grinsender Knecht, wollte ihr zu diesem Zweck die Arme wegreißen. Alle lachten, nur Albert nicht.
Dem blöd Grinsenden trat er in den Hintersten, dass er zwei Meter weiter platt auf den Bauch flog, und dem Großknecht griff er mit beiden Händen um die Gurgel. Der konnte sich aber noch aufrappeln und konnte Albert noch abwehren. Er konnte sogar noch zu einem Knüppel greifen und auf Albert losstürzen. Jetzt wusste Albert, dass es ein Fehler war, ihn wieder loszulassen, und packte ihn von neuem. Sie fielen ringend über eine Schiebkarre, dann über eine Kiste, kamen aber immer wieder zusammen hoch. Der Großknecht ließ dann los und drohte: „Dir werd’ ich helfen!“, wollte sich aber abwenden. Er fühlte wohl, dass ein Unentschieden besser sei als die Niederlage und war der Meinung, dass auch Albert sich damit zufrieden geben könne.
Falsch gedacht!
Albert spürte, wie es ihm warm über das Gesicht lief. Er wischte darüber und sah, dass er blutete. „Du willst mir helfen? Du Lump?!“, antwortete er und schlug dem Großknecht mit der Faust auf die Nase, dass er bis an die Dunggrube taumelte.
„Du?“
Bei diesem zweiten Schlag fiel der Großknecht plumpsend in die Dunggrube.
Alle standen verlegen herum, machten dumme Gesichter. Nur der Tierarzt hielt mit seiner Meinung nicht zurück. „Bravo, Buchner!“, sagte er. „Das nenn’ ich einen Mann!“ Er reichte Albert sogar die Hand hin. „Diesem unwiderstehlichen Patron musste eigentlich schon längst das entsetzlich freche Maul gestopft werden.“
Von da an war Margot sonntags gewöhnlich immer da zu sehen, wo Albert war. Obgleich sie gern tanzte und Albert nicht tanzen konnte, sagte sie lachend zu, als Albert sie einmal einlud, mit ihm im Garten ein Glas Bier zu trinken. Ein Jahr später war sie seine Frau.
Um diese Zeit lernte Karl aus. Er wurde in Tirschtiegel Schlosser und kam nach beendeter Lehrzeit in Posen bei der Eisenbahnwerkstatt an. Wahrhaftig, ein Bombenglück, das der Junge hatte. Er hatte wohl jeden Tag über eine Stunde zur Bahn zu gehen und dann noch eine halbe Stunde zu fahren, aber nach Meinung der Leute wog die Sache den Weg schon mit auf. Man muss bedenken, was es bedeutete, schon von der Schule weg beim Staat anzukommen! Mit dieser Vorstellung war unzertrennbar die andere verknüpft: wie der Beamte in seinen alten Tagen seine Rente verzehrt, nachdem er ein Leben lang seine sichere Arbeit gehabt hat.
Aber der Junge hatte vom Vater wohl nicht nur die frühkartoffelfarbenen Haare geerbt. Wenn er, als er ausgelernt hatte, der Mutter ihre acht Mark Kostgeld gegeben hatte, dann blieben ihm noch sechs Mark und einige Groschen; denn sechzig Stunden à fünfundzwanzig Pfennig, das sind genau sechzig Viertelmark oder fünfzehn ganze Mark. Davon gingen dann noch die Abzüge für Invaliden-, Kranken-, Pensionskasse usw. ab. In den nun folgenden Jahren hatte Karl Zeit genug, darüber nachzudenken, wie er sein ganzes Leben einrichten muss, wenn er einmal die Pension beziehen will. So ein Leben ist eng und arm. Die Schuhsohlen hielten trotz aller Nägel immer nur genau ein Vierteljahr und kosteten zwei Mark fünfzig. Ein Paar neue Schuhe kostete fünf Mark, und mehr als vier Sohlen hielten sie nicht aus. Der Sonntagsanzug wurde zu eng, die Hose zu kurz. Einen Sonntagsmantel hätte Karl auch gern; den Winter zuvor hatte er sich so durchgeschlagen, nun kam der zweite Winter in Karls Gesellenzeit. Er überlegte immer wieder, ob er die mühsam ersparten vierzig Mark für Mantel und Anzug opfern solle, wo er doch im Jahr darauf zur Musterung geht und Soldat werden kann. Dann wächst er ja wieder aus den Sachen.
Der Weg zum Lokomotivführer, dieser große Treffer in dem Lotteriespiel eines Eisenbahnschlossers, ist steinern und lang, noch ehe die Chance dafür kommt. Und die Welt, die Welt ist doch so groß! Wenn Vater davon erzählte, leuchteten Karls Augen. Mit fünfzig Mark ist er dann zum Militär eingerückt. Nach Berlin! Im zweiten Jahr seiner Militärzeit entschied sich dann Karl dafür, nicht Lokomotivführer zu werden.
Ein Stubenkamerad lud ihn an einem Sonntag zu seinen Verwandten ein. Sie saßen in einer Laube und tranken Kaffee. Ein Grammophon schrie in den heißen Sommer. Karl fühlte sich in seinem königlich-kaiserlichen Rock befangen; außerdem waren ihm Thema und Dialekt recht fremd. Es handelte sich da um Reichstagswahlen, um Freisinnige, Zentrum, Konservative. Aber was er da hörte, erschien ihm so wissenswert, dass er sich mit einer Broschüre, über die sein Stubenkamerad mit seiner Cousine sprach, hinter den Tisch zurückzog, während die anderen auf dem Rasen tanzten.
Bis dann ‚Damenwahl‘ kam. Da holte ihn Helene. Karl tanzte schlecht. Der Berliner Schritt war ihm ungewohnt, auch war er zu befangen, um auf die gut gemeinten Scherze Helenes einzugehen. Er setzte sich dann wieder an den Tisch und las weiter. Als er ging, fragte er, ob er die Broschüre leihweise mitnehmen könne, wurde aber belehrt, dass es doch nicht nötig sei, einige Wochen dicken Arrest zu riskieren, wenn er verbotene Literatur in die Kaserne schmuggele. „Wenn Sie wiederkommen, können Sie ja weiterlesen“, ermunterte ihn Helene.
Karl kam öfter und las nicht nur diese Broschüre. Es dauerte nicht lange, dann begann Karl einen eigenen Standpunkt zu entwickeln und zu verteidigen, so dass Helene bald feststellte: „Der Junge ist gut!“
Dass er mit Helene auch darüber, und so oft darüber sprach, ob er später wieder in die Heimat zurückwolle, das war schon das Thema über den gemeinsamen Weg. Bald darauf fuhren sie zusammen nach Marianneneck. Dort schüttelten sie die Köpfe über so einen dummen Kerl, der einer Fabrikschickse wegen seine Lokomotivführerlaufbahn an den Nagel hängt. Alle waren der Meinung, dass er das – wenn es zu spät ist – tief bereuen wird.
Nur einer war da, der horchte auf. Vater! Der sagte: „Mach, wie du denkst, Karl, ich hab’ meine Schuldigkeit getan. Deinen weiteren Weg musst du selber gehen.“ Er sagte das im Hof draußen und sagte es mit unsicherer Stimme. Karl hatte seinen Vater nie so sprechen hören.
„Magst recht haben“, fuhr er fort. „Wenn ich sie alle anschaun, die hier rumlaufen, die nichts gsehn haben von der Welt, greina könnt man da. Und du bist jetzt alt genug, ich kanns dir sang, was ich mit mir rumtrang hab, die ganzen Jahr. Ich hab schon niks mehr glaubt, wie ich nach Marianneneck kommen bin, und glernt hab ichs hier a net. Und wenn die Mutter net so hänget an dem bissel Zeug, und wenn ich net selber schon auf die fuchzig losgehet, ich wisst net, ob ich doch net amal no ausreißet auf meine alten Tag.“
Vater sah sich um, als wolle er sich überzeugen, dass ihn niemand gehört hat, holte dann tief auf und spuckte in weitem Bogen über den Zaun. Dann sagte er noch: „Die Sozialdemokraten ham mi früher schon deswegen gfallen, weil all die Großköpf so sakrisch auf sie schimpfen. Und ich glab, ich wär a ganz Scharfer worn, wenn ich hier net hocken blieben wär. Gsagt hab ich nie was, ich wollt net, dass ich euch innerlich zreiß. Hier kann sich ja keiner halten, der ’s Maul aufmacht. Aber die Helene –: Sakrament, da wirds ma selber warm, wenn die diskurriert. Wenn ihr euch versteht, ich glab, ihr finds eiern Weg, und als Schwiegertochter kann ich mir ka bessere wünschen. Und dass du’s weißt: ich hat ihrs a glei gsagt.“
Ein Jahr später folgte auch Albert mit seiner Familie nach Berlin und Hyronimus und Kascha blieben allein zurück. Aber auch hier riet Vater nicht ab.
Hyronimus bekam nur noch bei dem Müller gelegentlich Arbeit auf Wochen oder Tage. Bei dem Inspektor hatte er sich unbeliebt gemacht und in der Ziegelbrennerei, das hielt er nicht mehr aus.
Den ganzen Tag Trab, mit der schwer beladenen Karre voll heißer Steine vom heißen Ofen hinweg durch die zugigen Gänge zu den Kühlhallen: da lief schon ein Kerl wie Albert ein, wie fettes Fleisch in der Pfanne, und trotzdem brachte er es auf höchstens siebzehn Mark. Länger als zehn Jahre hat das noch keiner gemacht. Hyronimus hat es nur zwei Jahre gemacht und sich dabei das Reißen geholt auf Lebenszeit.
Albert konnte sich jedoch trotzdem lange nicht entschließen, nach Berlin zu reisen, denn auch er rechnete.
,Wenn zum Ersten kein Hauswirt die Hand aufhält: das ist was wert. Und ein Schwein im Stall, und die Kuh ‘ Er wiederholte die Rechnung Vaters nicht, um seinen unruhigen Geist zu bannen. Der war gar nicht unruhig.
Aber Margot war umso unruhiger. Die stammte aus einer Gegend, näher an Berlin heran, aus Küstrin. Sie war zu dem Müller gekommen, weil ihre Mutter früher dort gearbeitet hatte und glaubte, dass Margot gerade dort gut aufgehoben sei und tüchtig arbeiten lerne, wie ihre Mutter es auch gelernt hatte. Und weil außerdem in Marianneneck noch auf Zucht und Ordnung gehalten werde, was nötig sei, soll ein Mädel später den Brautschleier mit Recht tragen. Margot kam aber trotzdem ganz und gar nicht nach ihrer Mutter, und Hyronimus gab ihr fast immer recht, auch da, wo Albert und Kascha erstaunt mit den Köpfen wackelten.
Die Dritte im Bunde gegen Albert war Helene. Durch jeden Brief wurde Margot von neuem gepackt. Nicht, dass Helene und Karl sie aufgefordert hätten, um ihretwillen nachzufolgen. Sie schrieben nur, dass es in Berlin Arbeit gäbe, dass auch Wohnungen vorhanden wären und dass der Lebensunterhalt nicht teurer sei als in Marianneneck. Dass Albert, wenn er will, bei der Firma Hartmann & Fleiß als Hofarbeiter in Arbeit treten könne und als Anfangslohn siebenundzwanzig Mark verdienen würde. Dass Karl und Helene ihnen eine Wohnung beschaffen könnten, damit sie sofort wüssten, wo sie hingehören. Karl verdiene schon, bei derselben Firma, an die fünfunddreißig Mark. „Was habt ihr denn dort in dem Nest? Dort kann doch ein Mensch nur entweder auswachsen oder eingehen. Das ist doch kein Leben!“
Es folgten Wochen, wo Albert und Margot nur das Allernötigste zusammen sprachen, weil Albert im Zorn gesagt hatte: „Dass dich das Frauenzimmer dann ganz in den Klauen hat, passt mir nicht.“ Margot wollte Helene nicht berichten, wie Albert sie hasste und schrieb an Karl.
Karl schrieb an Vater, der längst wusste, dass in Margot die helle Sehnsucht schrie wie einst in ihm und der nicht wollte, dass Margot daran zeitlebens schleppen sollte. Albert trumpfte auf: Er sei Manns genug, um zu wissen, was er tue. Er lasse sich keine Vorschriften machen. Da brach es in Margot vollends durch: „Dann fahre ich allein mit meinen Kindern! Wo steckt denn deine Mannbarkeit? Bist wie ein alter Gaul, wo man dich hinstellt, bleibst du stehen!“
Jetzt fürchtete Albert den Bruch mit Margot mehr als die Reise, fort von Marianneneck. Mitzunehmen hatten sie nicht viel. Die alten Bettstellen und den wurmstichigen Schrank ließen sie hier; Karl hatte auch geschrieben, dass er Bettstellen gekauft hatte; sie brauchten nur zu kommen.
Margot bestieg mit Hilde und Erich, den Kindern, den Wagen. Albert, Großmutter und Großvater gingen nebenher. Die Betten und das Geschirr im Kasten gaben sie als Passagiergut auf. Die Brust war allen beklemmend eng; jeder wusste, dass der andere so trocken spricht, weil er keine Schwäche zeigen will. Großmutter drückte Margot schluchzend ihren Umhänger mit dem silbernen Kettchen in die Hand: „Für Hilde“, sagte sie. „Soll ihr Glück bringen.“ Vater sagte zum Schluss: „Und wenn’s einmal sein sollte, dass ihr net wisst, wohin, dann werd’ ihr den Weg ja wieder herfinden. Ein Platz für euch bleibt immer noch frei.“ Seinen großen Hut in der Hand, auf seinen Schlehendorn gestützt, schaute und winkte er ihnen nach, als die Lokomotive anzog. Sein fast kahler Kopf leuchtete blank aus dem Kranz von Haaren.
So reisten sie, Hilde erst zwei Jahre alt, Erich noch an der Brust der Mutter, nach der großen Stadt. Karl und Helene standen am Schlesischen Bahnhof, schüttelten ihnen die Hände. Helene nahm Margot den Kleinen vom Arm und sagte: „Nun kommt, es ist alles so weit fertig.“ Vor dem Bahnhof wartete ein Arbeitskollege Karls mit einem Handwagen. In einer halben Stunde waren sie in Lichtenberg, in ihrer neuen Wohnung.
Da stand ein Tisch in der Küche und Stühle davor. Der ‚guterhaltene‘ Küchenschrank wartete auf das Geschirr und der Gaskocher auf Bedienung. Dann das Schlafzimmer. „Ihr müsst euch vorderhand behelfen. Die Bettstellen sind fast neu und kosten wenig. Ich wollte noch einen Kleiderschrank kaufen, aber das eilt ja nicht, könnt ja nun selbst mit aussuchen. Vorderhand genügt ein Schrank“, meinte Karl.
Dieser stand in Karls Zimmer. Außer dem Bett war gerade noch Platz, um sich zu entkleiden. An allen Fenstern waren Gardinen. Margot seufzte schon über die Unkosten, noch ehe Albert Arbeit hatte. Helene beruhigte sie: „Die schenk ich dir, Margot, nimmst mir’s doch nicht übel? – So, nun kommt, tut, als ob ihr zu Hause wäret. Lasst uns erst mal gemütlich Abendbrot essen.“
Albert trat bei „Hartmann & Fleiß“ in Arbeit. Er verdiente siebenundzwanzig Mark, und die Arbeit war weniger ungesund und weniger schwer als die in der Ziegelbrennerei. Zwei Jahre später lernte ihn Karl an Revolverbänken an, und Albert begriff schnell. Nach einem weiteren Jahr wurde in der Werkzeugausgabe eine Stelle vakant, weil der Betrieb sich vergrößerte. Albert bewarb sich und kam in Wochenlohn. Er bewährte sich und rückte dann zum Lagerverwalter auf. Sein Lohn betrug nach zehnjähriger Tätigkeit vierzig Mark wöchentlich.
Die Zahl der Kinder erhöhte sich, ohne die Fehlgeburten, auf vier. Nach Erich kam noch ein Junge, der den Namen Herbert erhielt; einige Jahre später wurde ein Mädchen geboren, das Lotte benannt wurde. Mutter hatte einige Aufwartestellen, so wurde die ,guterhaltene‘ Wohnungseinrichtung zusammengeknausert. Ein Stück Laubenland gab Albert Gelegenheit, wenn auch in beschränktem Umfange, seinen landwirtschaftlichen Neigungen zu huldigen. Da galt es, die dankbarsten Rosensorten auszuprobieren, hinter die Geheimnisse der Vertilgung von Blattläusen zu kommen, die Blumenarten so zu setzen und zu pflegen, dass den ganzen Sommer über und bis in den Herbst hinein abwehende Blüten von aufbrechenden Knospen abgelöst wurden. Da galt es, den Komposthaufen richtig anzulegen, auszukundschaften, warum die Meisen nicht im Kasten brüten, zu überlegen, welche Farben am besten zueinander passen, und wo es die besten und billigsten Eierkisten, zurückgesetzte Tapeten, und das beste und billigste Taubenfutter gibt. Doch nicht nur dafür verwandte Albert seine Zeit.
Er war Mitglied der Sozialdemokratischen Partei und der Gewerkschaft und glaubte zu wissen, warum.
Das Leben in Berlin war für ihn leichter als dort, wo man die Roten mit den Hunden vom Hof jagte. Warum werden die Proleten gerade dort, wo die verhassten Roten nicht sind, so unmenschlich geschunden? Für Albert lag hier des Rätsels Lösung klar auf der Hand. Er verfolgte mit Eifer die steigenden Wahlerfolge der Partei und die wachsenden Mitgliederzahlen der Gewerkschaften. Er rannte manchen Sonntag mit Flugblättern treppauf, treppab, und als der Krieg ausbrach, stand Albert auf dem Standpunkt, dass alle Hoffnung auf die große Sache zuschanden werden muss, wenn die Feinde siegen. Die ‚russische Dampfwalze‘, die ,Knute des Zarismus‘, das war doch noch schlimmer als Marianneneck!
Karl und Helene versuchten ihm klar zu machen, dass das Proletariat für den Profit hingeschlachtet wird, dass die Partei die Sache des Sozialismus verraten habe und die Arbeiter aller Länder gegeneinander wüten; dass dadurch die internationale Arbeitersolidarität im Blut erstickt wird und noch dazu von den Arbeitern selbst. Da bewilligte die Reichstagsfraktion die Kriegskredite. „Es geht ums Ganze, um Sein oder Nichtsein“, hieß es. Jetzt war für Albert die Frage endgültig entschieden.
Margot fühlte wieder den Unterschied zwischen Karl und Helene – und Albert. Albert las, was er vorgesetzt bekam, und das war seiner Meinung nach immer gut und alles in besten Händen und in bester Ordnung. Dass Karl und Helene in Kursen, in Zirkeln ihre Abende verbrachten, immer und immer wieder von Revisionismus und ,linkem‘ und ‚rechtem Flügel‘ sprachen, Zeitschriften und Broschüren darüber lasen, das schien Albert weniger wichtig als die Frage, ob die Latten zum Rosengerüst an der Laube rechtzeitig gestrichen werden müssen. „Die soll sich lieber ein paar Kinder anschaffen, dann hat sie was zu tun“, sagte er eines Tages. Er meinte Helene.
Karl wurde sofort zum Militär eingezogen. Er wurde dreimal verwundet. Albert rückte 1916 nach Frankreich ab und holte sich einen Beckenschuss, der sehr schwer heilte. Die Firma reklamierte ihn, und er trat, als Garnisondienstfähiger, wieder seinen Posten an. Auch Karl wurde, auf Ersuchen Alberts, von der Firma angefordert und arbeitete mit Albert zusammen bis zum Kriegsende, bis zur Revolution.
Was war das, Frieden, Revolution? Das bedeutete für Albert, dass das größte Unheil gebannt war. Er sortierte wieder Metalle, Schrauben, Schmirgelleinen, Öl. Er hatte auch noch viel andere Arbeit nachzuholen: die frühere Parzelle hatten sie abgegeben, weil sie eine Wohnung mit anschließendem Garten bezogen hatten. Doch die Laube war verkommen, der Boden ungepflegt, Blumen und Sträucher verwildert.
„Wozu jetzt den Bruderkampf fortsetzen? Wahnsinn! Es gibt keine Wohnungen. Es gibt keine brauchbaren Maschinen. Es gibt nur heruntergewirtschaftete Eisenbahnen, Lokomotiven, Straßenbahnen. Es gibt Millionen brauchbarer Arbeiterhände weniger. Die Arbeit wird sich häufen und mit ihr die Nachfrage nach Arbeitern. Nur Ruhe muss erst herrschen. Ruhe! Ruhe und nochmals Ruhe! Ohne Ruhe und Ordnung kann nichts, gar nichts aufgebaut werden!“
Wie oft und eindringlich hatte er das seiner Frau klarzumachen versucht.
„Der Frieden ist geschlossen. Die Grenzen öffnen sich wieder. Nahrungsmittel kommen herein – wenn das Ausland wieder Vertrauen schöpft.“
Warum ihr das nicht einleuchte?
„Schritt um Schritt muss vorgedrungen, Stein auf Stein gefügt werden. Das Proletariat muss wie ein Mann hinter seinen Führern stehen. Ein Ruf und es steht auf und weist die Reaktion zurück, wenn es sein muss. Dazu ist Einigkeit notwendig. Einigkeit!“
So sprach Albert Buchner noch in den Tagen, als Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ermordet wurden.
II
Helene hat ihrem ersten Kinde, das, kaum ein Jahr alt, starb, bittere Tränen nachgeweint, und sie hatte den sehnlichen Wunsch, von Neuem Mutter zu werden. Dass sie Albert nicht sagte, was sie über ihn und seine Weisheiten dachte, tat sie um Margots willen. Albert und Familie wohnten parterre, Karl und Helene zwei Treppen höher in demselben Hause. Als beide Männer im Krieg waren, fühlten Margot und Helene mehr als zuvor, wie eng sie miteinander verbunden waren.
Helenes Wunsch ging dann im Winter 1918 doch in Erfüllung. Sie gebar einen Jungen. Sie wollte, sobald der Frühling anbrach, einige Wochen in Marianneneck verbringen. Es war wohl infolge der Grenzwirren unsicher, doch Großvater und Großmutter glaubten dennoch, dass Helene und ihr Kind bei ihnen geborgen seien. Auch Karl wünschte es. Er war in den letzten Wochen sehr oft des Nachts nicht nach Hause gekommen, weil er immer befürchten musste, verhaftet zu werden. Was solche Aufregungen während der Schwangerschaft und dazu der dauernde Hunger vermögen, dafür war ja Lottchen, Margots Jüngste, mit ihren krummen rachitischen Beinchen, dem margarineblassen Gesicht und dem chronischen, trockenen Husten, Beweis genug.
Bei der Firma Hartmann & Fleiß wurde gemunkelt, dass die Tore geschlossen werden. Karl war Mitglied des Spartakusbundes und Vertrauensmann der Schlosserei. Albert unterstützte durch sein Interesse an seiner Arbeit und sein Schweigen die Parole der Ruhe und Ordnung. Vielleicht werden nur die Unverheirateten entlassen, oder der Betrieb wird nur vorübergehend und nur teilweise geschlossen? Oder gibt es ‚Abfindungssummen‘, so dass ein Teil freiwillig ausscheidet? Diese Fragen schwirrten von Maschine zu Maschine, von Abteilung zu Abteilung, bis die Firma Hartmann & Fleiß durch einen Anschlag am ‚schwarzen Brett‘ alle Zweifel beseitigte.
‚Infolge Umstellung unserer Werke auf Friedensproduktion sind wir leider gezwungen, dieselben vorübergehend zu schließen. Bei Wiedereröffnung werden wir in erster Linie die Arbeiter unserer Betriebe berücksichtigen. Die endgültige Stilllegung erfolgt am Sonnabend, dem 2. Februar. Die Direktion hat daher im Einverständnis mit dem Arbeiterrat folgendes beschlossen: Diejenigen, die bis zum 27. Januar freiwillig ihre Entlassung nehmen, erhalten – außer ihrem Lohn oder Gehalt – eine Abfindungssumme von 300,– Mark; vom 27. Januar bis 3. Februar zahlen wir 150,– Mark. Nach dem 3. Februar erlischt der Anspruch auf eine Abfindungssumme. Inwieweit die Direktion über die Zahl der sich so verringernden Belegschaft hinaus zu Entlassungen gezwungen ist, hängt von der Zahl der freiwillig Ausscheidenden ab.
Für unsere Angestellten gilt diese Bekanntmachung – soweit persönliche Vereinbarungen nicht getroffen sind – als Kündigung. Im Falle freiwilligen Ausscheidens steht ihnen neben dem laufenden Monatsgehalt oder Wochenlohn obengenannte Abfindungssumme in gleicher Höhe zu.‘
„Det Ding is sauber!“, sagte einer, und brach damit das Schweigen der Proleten, die sich schnell angesammelt hatten. „Am besten gefällt mir det ,leider‘. Et jibt doch noch mitfühlende Menschen. – Ja, wenn man nu wüsste, wat? Nimmt ma nu de Fleppen oder nicht? Da wird nu wieder manch eener die Nacht nicht schlafen können.“ Er zwinkerte schelmisch mit den Augen. „Kann nichts schaden“, antwortete ein anderer. „Manche glaubten, sie bekommen doch noch die Klinke mit. Haben sich noch ins Fäustchen gelacht, als sie Treibjagd machten auf die Spartakisten. Ja, ja, den Sack schlägt man und den Esel meint man.“ „Und Mansfeld hat auch unterschrieben. – Hat er überhaupt die Vertrauensmänner benachrichtigt?“, entrüstete sich ein dritter.
„Was soll er machen? Wenn er nicht unterschreibt, machen sie’s ohne ihn. Ganz sicher hat er das noch rausgeholt“, verteidigte eine Arbeiterin den Arbeiterrat, dessen Stempel und Unterschrift neben dem der Direktion und des Demobilmachungsamtes saß. Da betrat Mansfeld den Saal und ging auf Karl zu. „Um zehn Uhr Betriebsversammlung in der Montagehalle“, sagte Mansfeld. „Sag auch unten im Lager Bescheid.“
Dann ging er wieder zur Tür hinaus in die Tischlerei. Karl klebte neben die Bekanntmachung der Direktion die Einladung für die Betriebsversammlung und ging dann hinunter ins Lager.
Es hatte soeben zur Frühstückspause geklingelt. Die wenigen Arbeiter im Lager saßen bereits am Tisch. Nur die Kreissäge ratterte noch und Albert wartete, bis der Schnitt durchgelaufen war, dann rückte auch er aus.
„Kannst dich wohl gar nicht daran gewöhnen, dass die Klamotten doch auf den Misthaufen wandern, – und wir mit“, sagte Karl nun, als er Albert eine Weile beobachtet hatte.
„Wieso?“
„Hast doch gelesen, dass die Sozialisierung jetzt beginnt.“ In Karls hagerem Gesicht spiegelte sich schlecht unterdrückte Ironie und Albert schien das zu merken.
„Wir können doch nicht einfach darauf losschustern. Ihr kommt mir mitunter vor wie die Kinder“, brummte er.
„Geschmackssache!“, antwortete Karl. „Trotzdem bin ich der Meinung, dass es ein Unterschied ist, ob die Arbeiterschaft die Betriebe umstellt oder die Bourgeoisie.“
Albert wischte mit einem Lappen schweigend seine Hände ab und beide gingen an den Tisch, an dem die anderen aßen.
„Nu ham sie’s geschafft!“, rief einer.
„Was wollt ihr denn? Bedenkt doch, was ihr eurer Firma wieder kostet? Unzufriedenes Pack!“, scherzte Karl. „Um zehn Uhr ist Betriebsversammlung!“
Mansfeld gab den Bericht. Das Demobilmachungsamt habe den Antrag auf Stilllegung der Werke genehmigt. Der Arbeiterrat habe unterschrieben, weil die Firma die Zahlung einer Abfindung von der sofort zu leistenden Unterschrift abhängig machte. Wenn die Belegschaft nicht einverstanden sei, müsse der Arbeiterrat seine Unterschrift zurückziehen. Damit falle die Vereinbarung und es müssen neue Verhandlungen geführt werden. „Ob mehr herauskommen wird“, schloss Mansfeld diesen Teil seines Berichtes, „muss allerdings bezweifelt werden.“ Es war kalt in der Halle. Mansfelds Gesicht leuchtete gelb aus seinem Soldatenmantel.
„Ganz gleich“, fuhr er dann fort, „wie ihr entscheidet, Kollegen: die Belegschaft der Firma Hartmann & Fleiß wird auseinandergerissen. Wir haben keine Möglichkeiten mehr, das zu verhüten. Damit ist auch die Position des Arbeiterrats untergraben und es hat keinen Zweck, darüber jetzt viel Worte zu verlieren. Doch es mag im Grunde gleich sein, wo wir sind, wo wir unseren Mann zu stellen haben. Wir müssen immer, in jedem Augenblick, bereit sein. Die Revolution ist noch nicht zu Ende.“
„Diese Bande!“, schreit einer durch das Gemurmel. Der Vorsitzende klingelt: „Ruhe, Kollegen, – wer wünscht das Wort?“ „Hier!“
Der alte Arbeiter lacht bitter. „Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, er kann gehen!“
„Sehr richtig!“
„Und das geschieht uns ganz recht!“
„Red’ doch keinen Blödsinn?!“
„Wir glauben nämlich, wir haben eine Revolution gemacht und merken nun mit einem Male, dass wir genau so wenig zu sagen haben wie vorher. Aber die meisten von uns konnten sich ja nichts anderes vorstellen als arbeiten und Lohn empfangen. Dazu gehören dann auch die anderen, die den Lohn bezahlen, unsere Ausbeuter. Hier liegt der Hase im Pfeffer. Solange wir in diesem Zustand etwas Unabänderliches sehen, wird es auch so bleiben. Muss es ja so bleiben …!“
„Kollege, ich bitte dich, zur Sache zu sprechen“, mischte sich der Versammlungsleiter dazwischen. „Die Firma hat die Erlaubnis für eine Betriebsversammlung nur für eine halbe Stunde während der Arbeitszeit gegeben. Wir konnten entweder einwilligen oder ablehnen. Die Firma verlangt bis elf Uhr Mitteilung.“ „Was habt ihr denn alles abgemacht?!“
„Verdammt eilig!“
„Wird ja immer schöner!“
„Der Kollege Mansfeld hat das Wort.“
„Wir bekamen bis elf Uhr Frist, Kollegen, um die Zustimmung der Belegschaft einzuholen. Die Direktion erklärte, dass sie bis dahin wissen muss, woran sie ist. Wir müssen darüber abstimmen. – Eine weitere Betriebsversammlung wird ohnehin noch nötig sein!“
„Wozu denn, wenn wir zustimmen?“
Mansfeld stockte. – Karl war der Zwischenrufer. „Du rechnest doch mit der Annahme, und damit ist der Betrieb aufgelöst. Wozu noch diese Komödie?“, fuhr Karl fort.
Zustimmung.
Protest.
Dann wird abgestimmt. – Zwei Tage später hatte die Mehrzahl der Arbeiter den Betrieb verlassen. Karl war unter ihnen. Albert blieb.
Albert arbeitete nun, zwei Jahre Frontdienst eingerechnet, seit sechzehn Jahren bei der Firma Hartmann & Fleiß. Er wog und registrierte noch einmal alle Schätze des Lagers: jede Sorte Schrauben, Bolzen, Bindfaden, Schmirgelleinen. Dann legte er alles von Grund auf buchmäßig und übersichtlich fest, fast ganz allein, nur mit Hilfe eines jugendlichen Arbeiters. Denn die ihm unterstellten Arbeiter waren unter den ersten, die abgeschoben wurden.
Obermeister Brecht, der dies angeordnet hatte, kam einige Male ins Lager und erkundigte sich. Er schien zufrieden. „Gut! – Sehr schön!“, sagte er. Er strich seinen Kaiserbart dabei und ging dann wieder. Albert blieb immer etwas bedrückt zurück. Brechts „Sehr schön!“ war immer sachlich, unpersönlich. Er sah Albert fast nie dabei an, verzog keine Miene und blieb über sein „Sehr schön!“ hinaus demonstrativ schweigsam und unnahbar. Nur bei seinem letzten Besuch erklärte er: „Ich werde Ihnen morgen noch einige Leute überweisen lassen, damit wir die Bestandsaufnahme beschleunigen. Wir haben nicht mehr viel Zeit.“
Albert schluckte – und schwieg. Er wartete darauf, dass man ihn ins Kontor rufen oder ihm sonst eine Mitteilung machen würde, dass er auf seinem Posten bleibt. Aber vielleicht war das ganz selbstverständlich und die Herren hielten eine solche Mitteilung für überflüssig? Einmal, kurz nach der Ankündigung der Stilllegung, sprach er mit dem Tischlermeister darüber. „Das kommt wohl daher, dass Sie so weit da unten hausen; man hat Sie ganz vergessen“, sagte dieser. „Sprechen Sie doch einmal mit Herrn Brecht?“
Zwei Gruppen der Beschäftigten unterschieden sich in den letzten Tagen durch ihr Verhalten ganz deutlich. Die einen, die ungeschwächtes Interesse an der Arbeit zeigten: einige Meister, Werkzeugmacher, Reparaturschlosser, auch einige Transportarbeiter. Sie hatten Nachricht, dass sie blieben. Die anderen ,bummelten' ihre Stunden ab. Für sie hatte die Arbeit jeden Sinn verloren. Sie nahmen lediglich den Lohn der letzten Tage noch mit.
Albert ließ sich, trotzdem er keinerlei Nachricht erhalten hatte, nicht beeinflussen. Er hielt, wie immer, korrekt die Pausen ein. Er wusch sich nie, bevor es geklingelt hatte. Einmal wird wohl, dachte er, Herr Brecht noch herunterkommen und weitere Direktiven geben. Und dann – dann wollte er um Aufklärung bitten.
Herr Brecht jedoch kam nicht. Statt seiner kam am Freitagmorgen ein junger Herr vom technischen Büro und stellte sich vor: „Hammerbein. – Ich komme im Auftrage des Herrn Brecht, um die Bestandsaufnahme zu prüfen.“ Hammerbein stand in lässig-salopper Haltung vor Albert, sah, wie dessen Gesicht sich verfärbte, und reinigte die Gläser seines Kneifers, als wollte er Albert Zeit lassen, sich zu erholen. Dann ging er an den Tisch, auf dem die Bücher und Zettel lagen, setzte sich auf den Stuhl, auf dem Albert seit vielen Jahren gesessen hatte, und setzte seinen Kneifer wieder auf. Albert wankte, wie von einem schweren Schlag betäubt, hinter ihm her, unfähig, ein Wort zu erwidern. Hammerbein sah sich jedoch nicht nach ihm um. „Sind Sie so weit?“, fragte er in einem Ton, als wäre das alles selbstverständlich.
Albert holte sich einen Schemel heran und erklärte Hammerbein die Eintragungen. Dann ging er mit ihm von Regal zu Regal und gab Auskunft. Als Hammerbein sich genügend orientiert hatte, ging er wieder an den Tisch zurück, schlug das Hauptbuch auf und schrieb auf die letzte Seite der Eintragungen:
„Lager geprüft, und in Ordnung befunden – … Hammerbein.“ „Wollen Sie bitte gegenzeichnen?“, fragte er dann und schob Albert das Buch hin.
„Ja, was soll denn …!“ Albert zitterte. Die Riesenfaust seiner Linken umklammerte die Stuhllehne, die Rechte ballte sich zusammen, als müsse sie unwiderruflich auf diesen jungen Menschen niedersausen.
Hammerbein verlor seine Ruhe. „Ich bin ganz ohne Schuld an allem, Herr Buchner. Ich führe einen Auftrag aus, der mir selbst alles andere als angenehm ist!“ Er legte Albert seine kleine, beringte Hand auf die Schulter, als leiste er Abbitte. Albert sah an ihm vorbei, richtete sich dann, wie in einem impulsiven Entschluss, hoch und fragte:
„Ist Herr Brecht im Kontor?“
„Herr Brecht ist heute nicht mehr zu sprechen.“
Die beiden Arbeiter im Lager packten ihr Arbeitszeug ein und gingen. Sie kamen also am anderen Tage nicht wieder. – Die kalte Zufriedenheit des Herrn Brecht. – Die Zuteilung der beiden Helfer, um alles zu ordnen und zu buchen. – Die ‚Übernahme‘ des Lagers durch Hammerbein. – Herr Brecht nicht mehr zu sprechen? –
„Hat Ihnen Herr Brecht keine weiteren Mitteilungen übergeben?“, fragte Albert weiter.
„Ich habe den Auftrag, das Lager zu übernehmen und Ihnen noch mitzuteilen, dass Sie sich im Lohnbüro melden möchten.“
Albert Buchner packte hastig seine Sachen zusammen und ging. Im Lohnbüro übergab man ihm seine Papiere. Die Firma Hartmann & Fleiß war mit seinen Leistungen außerordentlich zufrieden und bedauere, ihn wegen Schließung der Betriebe entlassen zu müssen, stand in dem Zeugnis.
Er ging als einer der letzten vom Hof. Keiner hatte ein Wort für ihn übrig. Keiner drückte ihm die Hand.
Vor dem Tor kam ein Portier auf ihn zu.
Albert blieb stehen. Sollte vielleicht alles auf einem Missverständnis beruhen, der Portier ihm eine Mitteilung von Herrn Brecht übermitteln?
„Kommen Sie mit“, sagte der Portier.
Albert ging hinter ihm her in die Portierstube. Ein anderer, ein hünenhafter Mensch, saß am Tisch.
„Auf was warten Sie denn? Packen Sie aus!“
„Was – wollen – Sie – denn?“
„Packen Sie aus!“
Albert breitete sein Arbeitszeug aus. „Gut, können gehen“, sagte der Hüne. Albert packte wieder ein und stolperte fort. Als er in die Straße einbog, in der seine Wohnung lag, kam ihm Lottchen entgegen. Sie war gewöhnt, dass er sie immer mit den Händen auffing und hochhob, blieb enttäuscht vor ihm stehen und sagte: „Du bist wohl krank, Papa? – Du siehst so schlecht aus!“
Albert legte sein Paket in die Ecke des Korridors und ging in die Stube. Als ihn Margot zum Essen rief, antwortete er, er habe keinen Hunger.
Sie folgte ihm. Er sah aus dem Fenster, hörte sie kommen und drehte sich nach ihr um. Sie sah ihn an und erschrak.
„Du darfst doch nicht gleich den Kopf verlieren. – Vielleicht holen sie dich wieder. – Schließlich wird doch überall Brot gebacken. Komm, komm essen. – Morgen denkst du schon anders darüber.“ –
Albert sah eine Weile stumm auf Margot herab. „Mir ist zu viel vorm Magen stehen geblieben“, antwortete er dann, „das muss ich erst verdauen.“ Seine Hände lagen schwer auf ihr und seine Finger umklammerten wie zur Betonung ihre Schultern.
Als er sie losließ, ging sie schweigend in die Küche und räumte den Tisch ab.
„Hat denn Vater schon gegessen?“, fragte Hilde.
„Er mag nicht!“
„Na nu?!“
Erich stierte sinnend auf das Paket. „Hat er Feierabend bekommen?“
„Ja!“
III
Am anderen Morgen stand Albert, wie immer, um sechs Uhr auf. Margot brühte für Hilde und Erich Kaffee auf. Hilde arbeitete im ‚Deutschen Hilfsverein‘. Erich lernte Buchdrucker.
„Willst du denn schon aufbleiben?“, fragte Margot, als Erich und Hilde fort waren. „Es ist doch kalt hier in der Küche. Wir haben keine Kohlen mehr. Herbert geht nicht in die Schule. Ich möchte mich noch ein bisschen hinlegen.“
„Warum geht Herbert nicht?“
„Die Schule wurde gestern mit Soldaten belegt.“
Das Knirschen und Klingeln der Straßenbahnen, die Tritte der Arbeiter, die das Haus verließen, die Schritte in der Küche über ihnen, der rüttelnde Druck in der Wasserleitung nach jeder Öffnung eines Hahnes: alles wie immer. Jetzt ging die Tür nebenan, dann hatte Albert immer noch fünf Minuten Zeit, steckte Brot und die Kaffeeflasche in die Wachstuchtasche und wartete auf die Zeitung. Wenn sie pünktlich kam, konnte er sie mitnehmen. Manchmal traf er die Frau vor der Tür.
Margot legte Brot und Marmelade in den Schrank zurück und wischte Tisch und Messer ab.
„Willst du denn schon fortgehen?“, forschte sie weiter.
„Ich warte auf die Zeitung.“
„Vielleicht kommt gar keine, die Buchdrucker wollen heute in den Streik treten, sagte Erich.“
„Verfluchte Streikerei! – Werden nicht eher Ruhe geben, bis sie verhungern. Möcht nur wissen, was sie eigentlich wollen?“ Albert stapfte nervös in der Küche auf und ab.
„Hat denn das arme Volk nicht genug für andere geschuftet und gehungert?“, antwortete Margot zornig. „Für die Bande, die Karl und Rosa umgebracht haben und schon wieder frech ,Deutschland, Deutschland über alles‘ singt!“
„Wollen denn die Spartakisten etwas anderes, als die Schwarz-weiß-roten!? Sie kämpfen beide gegen die Republik. – Die Schwarz-weiß-roten wären nicht ohne die Spartakisten.“
Albert hielt inne und horchte. Schwere Tritte knarrten im Flur, über die Treppen. Margot riss die Tür auf. Eine bewaffnete Patrouille ging die Treppe hoch und trommelte an Helenes Tür.
„Wo ist Ihr Mann?“, schrie jetzt einer.
„Ich weiß es nicht!“
Margot war hinaufgeeilt und stand nun mit klopfendem Herzen neben Helene.
„Dann müssen wir Sie mitnehmen!“
„Ich muss mich der Gewalt fügen. – Margot, nimm Klaus zu dir. Wenn Karl vielleicht nicht wiederkommt und sie auch mich umbringen sollten …“
„Halten Sie Ihr freches Maul!“ –
„Wäre ich die erste Frau, die ihr umbringt, von den Männern ganz zu schweigen?“ Helene öffnete ihre Bluse und wollte ihrem Jungen die Brust geben.
„Freche Hure! Sollen wir dir das unverschämte Maul stopfen?“
„Ihr nennt ja auch die Huren, die ihr erst vergewaltigt.“
Da erhielt sie einen Stoß, dass sie mit ihrem Kinde zusammensank und vor dem Sofa liegen blieb.
„Erbärmliche Feiglinge!“, schrie Margot nun und half Helene aufstehen. „Könnt ihr immer nur auf arme Teufel losschlagen? Warum wollt ihr sie erst fortschleppen? Erschießt sie doch gleich hier!“
Im Hof und auf den Treppen sammelten sich bedrohlich viel Menschen an. Der junge Leutnant machte ein hilfloses Gesicht.
„Sie haben selbst schuld“, lenkte er ein, „warum provozieren Sie?“ Dann verständigte er sich flüsternd mit dem Unteroffizier. „Ab!“, befahl dieser den Kindergesichtern unter dem Stahlhelm. Sie nahmen wider Erwarten von der Verhaftung Helenes Abstand. Als sie gingen, traten die im Hof und auf den Treppen stehenden Männer und Frauen beiseite, als wichen sie vor giftigen Schlangen aus.
Zwei Stunden später ging Albert. Er wollte zum Arbeitsnachweis. Vor dem Depot der Straßenbahn standen Soldaten zum Schutze der Arbeitswilligen. Durch die Frankfurter Allee marschierten Regierungstruppen. Sie sangen patriotische Lieder und trugen eine riesige schwarz-weiß-rote Fahne voran. Auf den Fußsteigen wälzten sich breite Schlangen von Menschen auf und ab. Der Generalstreik war proklamiert.
Die Zeitungen verkündeten, dass der Umsturz nun endgültig abgewehrt sei und die Verschwörer ihrer gerechten Strafe nicht entgehen werden. Die Gräueltaten der Spartakisten seien nicht wiederzugeben. In der Warschauer Straße seien sechzig Kriminalbeamte durch Spartakisten ermordet. Eine verhaftete Spartakistin sei nach Aussage einwandfreier Personen an mindestens zwanzig Morden beteiligt.