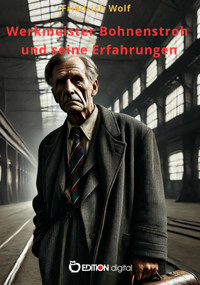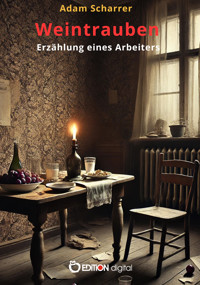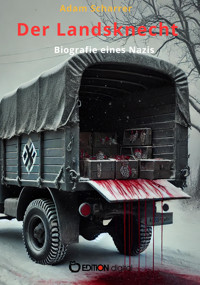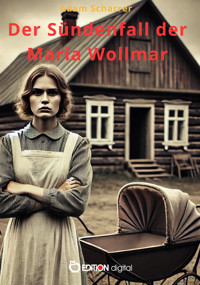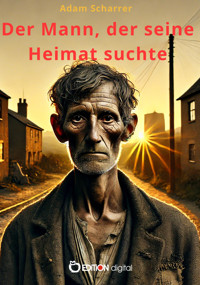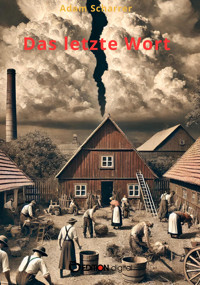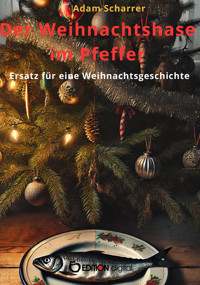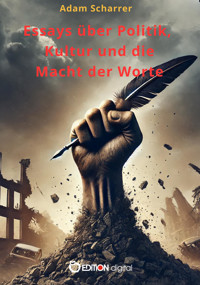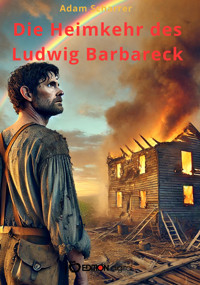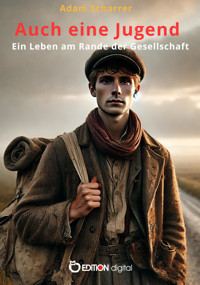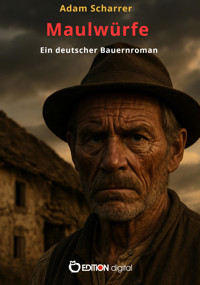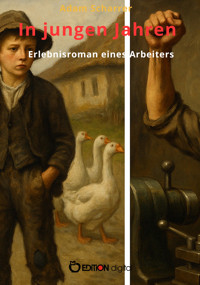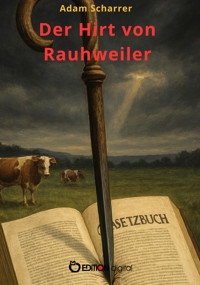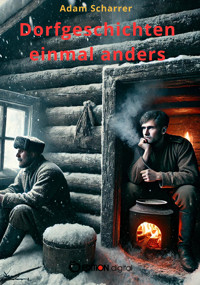
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hinter der ländlichen Idylle lauert das Grauen – Adam Scharrer erzählt von Bauern, Kriegswirren und menschlichen Schicksalen. Das Dorf als Mikrokosmos einer Gesellschaft im Umbruch: Adam Scharrer beleuchtet in seinen bewegenden Erzählungen die Schicksale einfacher Menschen, die zwischen Tradition, Krieg und persönlichem Überlebenskampf zerrissen werden. Bauern kämpfen um ihr Land, Familien um ihre Existenz, Soldaten um ihr Leben. Während die politische Maschinerie immer gnadenloser wird, müssen sich die Protagonisten entscheiden: Anpassung oder Widerstand? Liebe oder Verrat? Unterwerfung oder Freiheit? Vom erbitterten Überlebenskampf an der Ostfront bis zum stillen Widerstand im eigenen Heim zeigt Scharrer die dramatischen Umbrüche, die das Leben der Menschen für immer prägen. Ein literarisches Meisterwerk über Hoffnung und Verzweiflung, Macht und Ohnmacht, Pflicht und Gewissen – beklemmend aktuell und zutiefst bewegend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Adam Scharrer
Dorfgeschichten einmal anders
ISBN 978-3-68912-451-9 (E–Book)
Das Buch erschien erstmals 1948 im Verlag „Lied der Zeit“.
Das Titelbild wurde mit der KI erstellt.
© 2025 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
ERSTER TEIL
Hier wird von einer gefährlichen Seuche berichtet, durch die ein großer Teil eines stolzen Volkes den Verstand verliert und sich in ein furchtbares Unglück stürzt
Karin und ihre Freier
Die Ernte war gut ausgefallen, das Wetter war prächtig; die Kirchweih in Heiligenhain war daher auch aus anderen Dörfern gut besucht. Das ganze Dorf war voll von Musik.
Im Zanderhaus jedoch, dem rechten von dem Zweigehöft an der Kulmberger Straße, wollte keine rechte Kirchweihstimmung aufkommen. Der Zanderbauer stampfte zornig im Haus herum, weil Karin, seine Tochter, sich weigerte, mit zur Kirchweih zu gehen. Auch der Onkel und die Tante machten betretene Gesichter. Der Vetter versuchte, Karin durch einen Scherz aufzumuntern. „Hab mich so darauf gefreut“, sagte er, „mit dir tüchtig zu tanzen. Verdirb doch wenigstens mir nicht die ganze Kirchweih. Die Alten halten doch nicht so lange aus, und auf dem Heimweg kommen wir schon auf unsere Kosten!“ Doch sofort stellte sich heraus, dass der Witz nicht am Platze war. „Warum traktiert ihr mich, wenn ich doch nicht will“, antwortete Karin, stand dann auf und ging aus der Stube in ihre Kammer.
Zander zog seinen Mantel über, griff nach seinem Hut. Auch die Gäste machten sich zum Gehen fertig. Karin blieb in ihrer Kammer sitzen. Die Gedanken jagten wild durch ihren Kopf. Diese Gedanken enthielten die ganze Geschichte des Zanderhofes und darin eingeschlossen den Grund für Karins Verhalten.
Schon der Großvater war als mürrischer Sonderling bekannt. Außer den Verwandten durfte kein Mensch den Hof betreten. Als er starb, flossen die Tränen nicht sehr reichlich, und er starb auf eigenartige Weise.
Er hatte eine Kuh verkauft und sie nach Kulmberg zum Händler getrieben. Es war im Herbst, des Nachts fiel das Thermometer einige Grad unter Null. Der Viehhändler zahlte dem Alten sein Geld auf den Tisch und fragte ihn, ob er, da er doch viel Geld bei sich trage, nicht mit der Bahn fahren wolle. Der Alte deutete auf seinen Hund: „Der sorgt schon dafür, dass nichts passiert.“ Der Viehhändler goss dem Alten einen Schnaps ein. Der Alte trank, trank noch einen und dann noch einen. Der Schnaps schoss ihm schwer in die Füße.
Als er auf dem Heimweg die Bank erreicht hatte, die unter den Eichen am Oberndorfer Weg stand, beschloss er, ein wenig auszuruhen. Dort schlief er ein. Als ein Radfahrer vorbeikam, lag er vor der Bank, Hut und Stock daneben. Der Radfahrer wollte helfen, doch der Hund knurrte ihn drohend an. Der Radfahrer fuhr ins Dorf und holte Hilfe. Zu spät. Der Alte war tot. Schlaganfall, meinte der Arzt, und dann erfroren.
Die Leute im Dorf waren der Meinung: Der ist an seinem Geiz erstickt. Von seinem Geld hätte er sich nicht so vollgesoffen.
Nun erst war der junge Zander Herr auf dem Hofe, der ihm wohl schon lange überschrieben war, aber der Alte hatte die Herrschaft keinen Augenblick aus der Hand gegeben, obgleich sein Sohn bereits Vater von drei Kindern war. Karin war sechs, ihre Brüder, der Kaspar und der Christian, acht und elf Jahre alt.
Der junge Zander legte die abfälligen Reden als Neid und Missgunst aus. An dem Verhältnis zu den Leuten im Dorf änderte sich nichts. Als die Wasserleitung ins Dorf gelegt wurde, sollten Zander und sein Nachbar, der Sterk, einige hundert Meter Rohr extra bezahlen, weil ihre Höfe zu weit vom Dorf ablagen. Zander weigerte sich, so dass die Rechnung für Sterk noch höher wurde. Sterk beschloss, die Leitung dennoch legen zu lassen, musste aber, wenn er einen großen Umweg vermeiden wollte, mit der Rohrleitung durch einen Acker von Zander. Zander gab seine Einwilligung nicht. Dadurch war die Feindschaft zwischen den Nachbarn noch erbitterter geworden. Ob ein Kalb zur Welt kam, einige Fuder Heu oder Korn vom Gewitterregen bedroht waren: Keiner der Nachbarn nahm mehr die Hilfe des anderen in Anspruch.
Auch die Kinder wurden streng angehalten, jeden Verkehr miteinander zu meiden. Doch dieses Gebot wurde oft durchbrochen. Eines Tages fuhr der Sterk-Ludwig mit dem Fahrrad nach Kulmberg. Karin hütete unweit der Kulmberger Straße die Kühe. Ludwig hatte Karin versprochen, Murmeln mitzubringen. Er hielt Wort: Einen ganzen Beutel voll funkelnagelneuer Murmeln brachte er mit, dazu zwei große, bunte, gläserne. Er schüttete den ganzen Reichtum in Karins Schürze und lächelte sie aufgeregt an. Und plötzlich, ehe Karin mit dem Zählen fertig war, hatte Ludwig sie zu Boden gedrückt. Erst als sie seine Hand zwischen ihren Schenkeln spürte, begriff sie, was Ludwig wollte. Sie biss, kratzte, riss sich los, sprang auf und erschrak noch mehr, wie sie Ludwig nun vor sich sah: Augen wie ein Ochse, Ohren wie ein Esel, Arme und Hände wie ein Affe; Wie ein gehetztes Wild lief sie aus dem Walde zu ihren Kühen. Von diesem Tage an bedurfte es keiner Ermahnung des Vaters mehr, den Umgang mit Ludwig zu meiden. Ludwig war damals dreizehn, Karin elf Jahre alt.
Als Karin aus der Schule kam, entließ Zander die Magd. Christian, der älteste Bruder, machte den Knecht, Kaspar, der jüngere, arbeitete im Schieferbruch. Das Geld, das er verdiente, verwendete Zander für die Bezahlung der Tagelöhner, die er zur Ernte brauchte. Sein Konto auf der Sparkasse stieg von Jahr zu Jahr. Und als es dann galt, im Jahre 1914 Haus und Hof gegen den „Erbfeind“ zu verteidigen, war das für Zander wohl so plötzlich unfassbar, aber dann doch selbstverständlich.
Christian fiel in Polen, Kaspar in Belgien. Als Zander die Nachricht vom Tode seines zweiten Sohnes erhielt, aß er den ganzen Tag keinen Bissen und sprach kein Wort. Seine Frau stellte in der Kammer die Bilder ihrer Söhne auf die Kommode, daneben zwei lange, dicke Kerzen. Sie betete mehrere Male am Tag laut und lange. Zander sah seine Frau verwundert an und blieb stehen. Doch sie wies ihn hinaus, und als er nicht gehen wollte, schrie sie ihn an: „Raus du, du Satan!“ Zander ging erschrocken aus der Kammer. Die Alte verschloss die Tür und betete laut weiter. Sie arbeitete nicht mehr, kochte kein Essen. Eines Tages stürzte sie mit einem Küchenmesser auf die alte Sterk los. „Jetzt hab ich dich“, schrie sie, „du bist schuld, an allem schuld. Du hast alles verhext!“
Die alte Sterk rannte in die Scheune und schrie laut um Hilfe. Zander musste Gewalt anwenden, um der Tobenden das Messer zu entreißen.
In einer kalten Winternacht war sie dann fortgelaufen, ohne sofort bemerkt zu werden. Sie lief auf die Lichter am Bahnhof Kulmberg zu, die von der Straße aus zu sehen waren. Das große grüne, meinte sie, sei der Geist von Christian und das große rote der von Kaspar. Sie lief geradeaus, nicht darauf achtend, dass die Straße eine Biegung machte, verirrte sich im Schnee, und als Karin und ihr Vater sie fanden, war sie starr und kalt.
Zur Beerdigung fanden sich viele ein, mit denen die Zander keine Freundschaft gehalten hatten. Auch die Sterks kamen. Der alte Sterk ging, als Karin ihren Vater vom Grabe wegführte, auf diesen zu, hielt ihm die Hand hin und sagte: „Ich denk, Nachbar, Ihr werdet mir’s doch nicht verwehren, dass ich Euch wenigstens die Hand drücke.“
Zander schlug ein. „Ich dank Euch, Nachbar!“, sagte er. Dann gingen sie miteinander zum Leichenschmaus.
Sterk hatte weniger Land als Zander, doch nur zwei Kinder, den Ludwig und die Marie. Der Ludwig war auch nach Beendigung des Krieges beim Militär geblieben. Die Marie hatte wenig Aussicht auf eine Heirat, wegen ihrer Hasenscharte. Wenn der Ludwig mit einigen tausend Mark Abfindung vom Militär abgeht, rechnete Sterk, wird Zander nichts gegen eine Heirat mit Karin haben. Zander war einverstanden. Wenn schon kein Zander auf den Zanderhof kommen soll, so wenigstens eine Zanderin, um den Preis, dass der Sterkhof später verschwindet. Doch über diese Einzelheiten sprachen die Nachbarn nicht. Sie sprachen nur darüber, dass der Ludwig und die Karin ein stattliches Paar seien.
Ludwig jedoch kam bei Karin keinen Schritt weiter. Als er sie einmal im Kuhstall umfassen wollte, erschrak sie so sehr, dass er sofort von ihr abließ. Mit steinernem Gesicht sah sie ihn an und sagte dann: „Nachbar, das darfst du nicht denken, das nicht, auf keinen Fall.“ Sie ging aus dem Stall, und Ludwig blieb enttäuscht und verletzt zurück und kam dann wochenlang nicht mehr ins Zanderhaus.
Der alte Sterk ließ Zander unterdessen wissen, dass Ludwig nicht nur so viele Frauen bekommen könnte, wie er wolle, sondern auch solche, die es mit Karin sehr wohl aufnehmen könnten, auch was das Heiratsgut anbelangt. Zander antwortete nachdenklich: „Die Karin hat halt viel durchgemacht, da muss der Ludwig ein bisschen mehr Geduld haben als mit der erstbesten. Sie hat halt ein starkes Innenleben. Ein guter Wein gärt lang.“ Und zu Karin sagte Zander: „Ich weiß nicht, Karin, wie du dir das denkst, für später. Ich werde immer älter, und wenn ich die Augen zumache, und ich muss dich allein zurücklassen, das bedrückt mich. Der Ludwig ist doch kein unrechter Bursch, und dass er immer nur auf ein gutes Wort von dir wartet und nach keiner andern schaut, das macht auch nicht jeder. Aber einmal reißt ihm sicher die Geduld, und vielleicht denkst du nachher anders, wenn es zu spät ist.“
„Du stirbst noch lange nicht, Vater“, meinte Karin da. „Und daran denken, dass ich deswegen heiraten soll, das könnt mir’s erst recht verleiden. Ich hab halt gar kein Verlangen danach. Und wenn das nicht von selber kommt, bringt es auch kein Glück. Und Unglück haben wir doch grad genug hinter uns. Jetzt sind wir noch unser eigener Herr, was nachher kommt, wissen wir nicht. Warum sollen wir uns Sorgen machen, grad weil wir jetzt keine haben?“ Der alte Zander ging schweigsam und nachdenklich in seine Schlafkammer, denn über Karin ging das Gerede, dass sie mütterlicherseits erblich belastet sei, weil sie wortkarg und verschlossen war und nichts von Männern wissen wollte.
Außer Karin und ihrem Vater schlief nur die Magd im Haus, und die war schwerhörig. Wenn viel Arbeit war, nahm Zander Tagelöhner, die morgens kamen und abends gingen. Auch Thomas Schramm war so ins Zanderhaus gekommen. Schon nach einigen Tagen glaubte Zander, hier einen glücklichen Griff getan zu haben. Thomas war wortkarg, arbeitsam und umsichtig. Er wusste gut mit den Pferden umzugehen, vergaß nie, bevor er ging, die Rüben durch die Maschine zu drehen, weil das für die Frauen zu schwer war. Ohne dass man es ihm sagen musste, warf er während seiner Arbeit den Mist aus dem Kuhstall und spaltete Kienspäne zum Feuermachen. Fuhr er mit Karin auf den Acker oder in den Wald, so legte er für Karin immer einen sauberen Sack auf den Wagen.
Eines Tages fuhren sie Nadelstreu heim. Die musste in Kiepen weit herunter vom Abhang getragen werden. Karin wollte helfen, doch Tom sagte: „Das ist keine Arbeit für dich, Karin, geh auf den Wagen und lade auf.“ Zweiundzwanzig Kiepen schleppte Tom den Berg herunter. Es wurde ein Fuder, hochauf geladen. Sie mussten beiderseitig ein Gerüst von Stangen anbringen. Der wortkarge Tom und die wortkarge Karin arbeiteten mit einem Eifer Hand in Hand, dass sie alles Fremde zwischen sich vergaßen. Als der Wagen schaukelnd die feste Straße erreicht hatte, sagte Karin: „Trockne dich erst richtig ab, Tom.“ Sie reichte ihm ihre Schürze. Tom gab Karin die Schürze zurück und schaute ihr sinnend ins Gesicht.
„Was schaust du denn so?“, fragte Karin.
„Darf ich dir’s sagen?“
„Ja!“
„Ich möchte dich einmal richtig lachen sehen, Karin, richtig von Herzen! Drückt dich denn das Unglück mit deiner Mutter immer noch? Wär doch schad, wenn du dein ganzes Leben lang daran tragen müsstest, Karin.“ Dabei legte Tom die Hand auf ihre Schulter. Karin blieb stumm und still. Alles Hässliche, was vordem bei der Berührung eines Mannes in ihr hochkroch, war ausgewischt. Sie schlief schlecht in dieser Nacht.
Auch in vielen nun folgenden Nächten. Dieses Versteckspielen vor dem Vater, dieses stumme Nebeneinandersitzen beim Essen, dieses Wissen von der bevorstehenden Trennung vor dem nahenden Winter war zu bitter. Keine Stunde gehörte ihnen, und in einer der wenigen, die der Zufall ihnen schenkte, hatten sie sich „vergessen“.
Tom wollte Zander die ganze Wahrheit sagen, aber Karin wehrte ab. „Der erschlägt dich auf der Stell. Wenn du fort bist, werde ich mit ihm reden. Aber du darfst nichts sagen, sonst gibt es ein Unglück. Versprich mir’s, Tom!“
Der alte Sterk kam immer noch recht häufig auf den Zanderhof, und er machte kein Geheimnis daraus, warum. „Wenn man das so beobachtet“, sagte er zu Zander, „wie die zwei zusammenarbeiten, da braucht man eigentlich nimmer fragen, warum die Karin dem Ludwig kein freundliches Wort gönnt.“
„Aber, Nachbar“, meinte Zander entrüstet, „das ist doch zum Lachen. Die Karin und der Mensch! Sie mag ihn halt gern, weil er arbeitet wie ein Vieh und das Maul nicht auseinanderbringt, das ist es und weiter nichts!“ Doch der Sterk lachte pfiffig durch seine gelben Zähne. „Da langt halt schon die Augensprache!“, sagte er. „Und was sie sonst miteinander ausmachen, das werden sie dir gewiss nicht auf die Nase binden. Wenn man mit anschaut, wie die Karin ist, wenn sie mit dem Menschen zusammenarbeitet, und wie sie ist, wenn sie der Ludwig anspricht, das ist ein Unterschied wie eine Wärmflasche und ein Eiszapfen. Ich hätte nichts gesagt, Nachbar, aber dass Ihr von so einem Menschen hintergangen werden sollt, das wurmt mich. Denn dass der Ludwig auf einen Tagwerker eifersüchtig sein sollt, das wär wirklich zum Lachen!“
Von diesem Tag an merkten Karin und Tom deutlich, dass auch Zander misstrauisch geworden war. Es war noch Grünstreu zu zerkleinern; Zander stellte seinen Hauklotz zwischen Karin und Tom. War Tom im Kuhstall, ging oft die Tür auf, und Zander kam. Als letzte Arbeit war das Holz zu spalten und aufzuschichten. Zander half von früh bis abends. Er und Karin sägten, Tom spaltete. Und waren sie einmal allein, war drüben im Nachbargarten todsicher die alte Sterk oder die Marie und horchten auf jedes Wort. Arbeiteten sie in der Scheune und Zander war fort, waren sie keinen Augenblick sicher, ob nicht Sterk oder Marie hereinkam, das Schnitzmesser oder einen Bohrer oder ein paar Gewichte auszuborgen. Eines Tages fiel hoher Schnee. Zander sagte am Abend beim Essen zu Tom: „Bei dem Wetter brauchst du vorläufig nicht zu kommen. Wenn wir dich wieder brauchen, lass ich dir Nachricht zukommen.“ Dann zahlte Zander Tom den Restlohn auf den Tisch und ging aus der Stube in den Hof.
„Wenn ich jetzt gehe“, sagte Tom nach bedrückendem Schweigen, „nehme ich eine Schuld auf mich, die sie nachher erst recht gegen mich ausspielen. Sie werden sagen, ich bin feige. Ich hätte keine ruhige Stunde mehr.“
Karin wehrte ab. Doch Tom blieb hartnäckig. „Ich sag ihm, wie es ist, ganz gleich, wie es ausgeht! Gesagt muss es doch einmal werden. Und er soll wenigstens nicht denken, dass ich ein Lump bin.“
Tom ging in den Hof. Der Alte stand am Zaun und schaute über die verschneiten Wiesen. Er drehte sich erst um, als Tom sagte: „Ich möchte, ehe ich gehe, noch eine Sache mit Euch besprechen, Zander.“
„Du, mit mir? Über eine Sache sprechen?“, fragte Zander verwundert.
„Ich möchte mit Euch sprechen, wegen der Karin.“
„Du – wegen der Karin?“
„Ja!“, sagte Tom mit Nachdruck. „Ich hab die Karin gern und sie mich auch …“
„Dann wird’s erst recht Zeit, dass du dich trollst“, unterbrach Zander Tom barsch, „sonst, Lump, elender …!“
Zander rannte zur Hundehütte, um den Hund loszumachen. Tom lief ihm nach und hielt ihn zurück. „Macht doch keine dummen Sachen, Zander!“ Doch Zander kam nun erst recht in Wut. „Anfassen willst du mich!“, brüllte er, riss sich los und schlug mit einer Latte auf Tom ein. Tom ergriff die Latte und hielt sie fest. Zander rannte zum Holzstoß und ergriff ein Backofenscheit. Nun kam Karin aus dem Hause und hielt Zander von hinten fest. „Vater, was machst du denn? Er hat doch nichts Unrechtes …“ Zander schlug wild um sich und traf Karin so unglücklich, dass sie zusammensank und stöhnend liegenblieb. Dann stürzte sich Zander von neuem auf Tom, doch der fing ihn nun auf und schleuderte ihn von sich. Zander schlug schwer auf das Eis am Brunnen auf.
„Tom!“, schrie Karin da plötzlich. „Tom, pass auf!“ Der alte Sterk hatte sich, mit einem Beil in der Hand, um den Holzstoß geschlichen. Doch als er sah, dass er Tom allein gegenüberstand, verließ ihn der Mut. Stumm und behände kroch er wieder durch den Zaun. Karin erhob sich und führte ihren Vater ins Haus.
Tom blieb am Tor stehen. Nach einer Weile kam Karin wieder. „Du musst zum Doktor“, sagte sie, „sein Knie ist aufgeschlagen, und die Strümpfe sind voller Blut. O Gott, Tom!“ Karin kamen die Tränen. „Wie ist das bloß gekommen?“ Sie stockte und hielt die Hände vor ihren Leib. „Ich hab mir auch so wehgetan.“
„Ist wohl das letzte, was ich noch machen kann“, sagte Tom, „den Doktor holen.“
„Warum das letzte, Tom?“
„Wenn du mir gehören willst, Karin, und ich dir, dann gehört dir vom Zanderhof soviel wie mir – nichts. Überleg dir’s, schreib!“
In der Stube schrie Zander laut auf.
Tom gab Karin die Hand. „Gute Nacht, Karin!“
„Gute Nacht, Tom!“
Tom wurde von den Gendarmen abgeholt, zwei Wochen später jedoch wieder freigelassen. Karin war im Krankenhaus. Tom wollte sie besuchen. „Die Kranke ist noch zu schwach, um Besuche empfangen zu können“, sagte man ihm und vertröstete ihn auf eine Woche später. Tom ging ein zweites Mal nach dem Krankenhaus. Nun erfuhr er, dass Karin am Tage zuvor entlassen worden war.
Was sie durchlebt, hatte sie bis ins Innerste aufgewühlt. Sie war kurz nach dem Abschied von Tom in der Stube zusammengebrochen. Als sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde, war sie bewusstlos. Sie entsann sich dunkel, dass Männer in weißen Kitteln um sie standen, und sie glaubte nun noch zu spüren, wie diese Männer dann in ihrem Leib wühlten. Einige Tage später erfuhr sie, dass der Vater im Gipsverband zu Hause lag. Dann kam ein Herr zu ihr zu Besuch, um sie über Einzelheiten des Unglücksfalles auszufragen. Er war von der Polizei und nicht gut auf Tom zu sprechen. Karin ließ sich jedoch nichts einreden. „Er ist unschuldig!“, beharrte sie.
Zander hatte Karin erster Klasse verpflegen und sie mit dem Auto heimholen lassen. Als Hilfe für die Magd und zur Pflege für ihn war seine Schwester gekommen. Zander reichte Karin die Hand und sagte: „Grüß dich Gott, Karin, hast alles gut überstanden?“
Karin schien es, als wäre der Vater zehn Jahre älter und grauer geworden. „Wird schon wieder werden“, sagte sie. „Aber du, dein Fuß bleibt gewiss steif?“
„Macht nichts“, sagte Zander, „die Hauptsache ist, du wirst wieder gesund.“ Karin spürte, wie er ihre Hand drückte. „Nachher wollen wir uns schon einrichten, Karin, besser!“ Er ließ Schokolade, Kuchen, frisches Fleisch und Wein aus dem Dorf kommen. „Musst nicht alles gar so schwernehmen“, ermunterte er sie einige Tage später. „Die ganze Geschichte müssen wir vergessen!“
Karin sah hoch und sagte wie unbewusst vor sich hin: „Den Tom kann ich nicht vergessen!“
„Den musst du vergessen!“, antwortete Zander, nun wieder in jenem Ton, der keine Widerrede duldete.
Denn unterdessen hatte Zander erfahren, wer Thomas Schramm war. Ein „Bankert“! Und nach Zanders Meinung ein auch sonst von Grund auf verdorbener Mensch. Seinen Vater hatte Tom nicht gekannt. Die Mutter war Magd bei den Bauern. Die Großeltern hatten ein kleines Häuschen. Das hatte der Großvater selbst gebaut, aus rohen Feldsteinen. Es war so klein, dass man es, von der Straße aus gesehen, für einen Backofen hätte halten können. Bauplatz und Holz hatte die Großmutter als Hochzeitsgut mit in die Ehe gebracht.
Großvater war Zimmermann, hatte aber, als Tom geboren wurde, seinen Beruf bereits aufgegeben. Er war schon zu alt für diese schwere Arbeit. Er machte Besen, Vogelbauer und Laubsägearbeiten. Großmutter fuhr mit der Ware über Land und verkaufte sie bei den Bauern. Tom war vier Jahre alt, als er mit der Großmutter zum ersten Male mit auf den Handel fuhr. Einige Jahre später wäre der Handel ohne Tom gar nicht mehr möglich gewesen. Großmutter hatte offene Füße. Auch sie war früher Magd bei den Bauern gewesen und hatte Frostschaden zurückbehalten. Da aber Tom nun schon kräftig ziehen konnte, zog er die Großmutter mit, wenn die Füße nicht mehr wollten. Manchen Tag fuhr Tom auch allein. Auch hatte ihn der Großvater schon gut angelernt. Als Tom seinen ersten selbstangefertigten Nähkasten verkaufte, war er zehn Jahre alt.
Und nun zeigte sich, wie gut es war, dass Tom die Arbeit Großvaters machen konnte. Großvater wurde krank. Einige Tage lag er mit hohem Fieber im Bett, Hals und Mund verschwollen und entzündet. Draußen tobte der Schneesturm. Großvater kämpfte röchelnd um Luft. Der Bader, der Großvaters Mund täglich mit Heilwasser auspinselte, stand ratlos am Bett.
Da machte Tom sich auf den Weg nach Kulmberg zum Arzt. Stundenlang kämpfte er gegen den Sturm an, versank manchmal bis zum Bauch im Schnee. Er ging über den Berg, denn um den Berg über Hühnerfeld war es noch weiter, und ein Zug fuhr in der Nacht nicht. Als Tom in der Stadt ankam, glaubte er, nun sei der Großvater gerettet, denn die Straße um den Berg war ja gut befahrbar, und der Doktor besaß Pferd und Schlitten. Tom drückte die Nachtklingel, drei-, vier-, zehnmal. Nichts rührte sich. Tom wurde ängstlich. Sollte der Herr Doktor nicht zu Hause sein? Er rief laut, warf mit Schneeballen ans Fenster.
„Was ist denn los?“, schrie plötzlich eine Stimme von oben. „Wohl den Verstand verloren?“ Tom berichtete von seinem Großvater. Der Arzt fragte, wie lange er schon krank sei. „Und ausgerechnet heut in dem Wetter, mitten in der Nacht, kommst du nun!“, sagte er dann. „Wo man keinen Hund aus dem Hause jagt.“ Dann hörte Tom noch etwas wie „morgen“ und „mit dem Zug“, und dann machte der Arzt das Fenster zu. Tom ging wieder nach Hause. Zwei Stunden nach seiner Ankunft war Großvater tot.
Nun begann in der „Schrammhütte“ eine bittere Zeit. Wohl hatte Tom sich ganz respektable Fähigkeiten angeeignet, aber Großmutter allein konnte nicht mehr über Land fahren. Sie konnte kaum noch Futter für die Ziegen heranschaffen, nicht mehr nach Holz fahren. Auch nach dem „Lerchenkessel“, wo sie einige Streifen Ackerland hatten, konnte sie nicht mehr gehen. Das alles musste nun Tom außerhalb der Schulzeit bewältigen.
Später fuhr Tom mit einem Hund über Land. Er flickte nun auch Töpfe, Regenschirme, erledigte für die Bauern Besorgungen in der Stadt. Auch Nähmaschinen und Fahrräder reparierte Tom. In der kleinen Kammer hatte er sich eine Werkstatt eingerichtet. Mit neunzehn Jahren zog er in den Krieg. Ein Jahr später starb die Großmutter. Als Tom von Frankreich auf Urlaub kam, wohnte seine Mutter in der Hütte. Die Mutter arbeitete immer noch bei den Bauern, und auch sie hatte wunde Füße. Tom sagte: „Du bleibst daheim, Mutter, bis deine Füße geheilt sind! Soll dir wohl auch so gehen wie der Großmutter?“
Die Mutter antwortete: „Wovon soll ich dir dann Esspakete schicken?“
Tom ging zum Bürgermeister und bat diesen um Kriegsunterstützung für die Mutter wegen der Krankheit.
Der Bürgermeister antwortete, die Kriegsunterstützung sei nicht für Leute, die sich von der Arbeit drücken wollen. Tom gab dem Bürgermeister eine Ohrfeige, dass er sich auf die Bank setzte und still sitzenblieb, so überrascht war er und solche Angst hatte er vor einer zweiten, und als Tom fort war, unterrichtete der Bürgermeister die Gendarmen. Die belehrten ihn jedoch, dass er kein Recht habe, von sich aus Unterstützungsanträge abzulehnen. Von der Verhaftung Toms nahmen sie Abstand, weil die Gefängnisse bereits überfüllt waren von Deserteuren. Und in den Tagen, in denen Tom zu Hause war, kam mehr als einer zu ihm, sich Rat zu holen, und viele sagten: „Höchste Zeit war’s, dass mal einer dazwischengefuhrwerkt ist. Uns Kleinen holen sie das letzte Fetttröpfchen weg, und für die Dickköpfigen ist der Krieg ein Geschäft und weiter nichts.“
Nachdem Tom aus dem Krieg zurückgekehrt war, begann er in Kulmberg in einer Waggonfabrik zu arbeiten, bis der Betrieb stillgelegt wurde. Dann fand er Arbeit beim Zanderbauern, einige Wochen nach seinem Abschied vom Zanderhof fand er Arbeit im Schieferbruch.
Zander hatte einen Knecht und eine Magd gedungen und ging nun öfter in den „Weißen Hirsch“. Dort saß er am Stammtisch zusammen mit den königstreuen Bauern, die im „Schützenverein“ oder im „Verein der Frontsoldaten“ waren. Die Jüngeren hatten sich schon zahlreich der Hitlerpartei angeschlossen.
Der Bauer sei ja schon bald nicht mehr Herr auf seinem Grund und Boden, meinten sie. Wenn der Staat Arbeitslosenunterstützung zahlte, die höher sei als früher der Lohn, wie könne denn da der Bauer noch Arbeitskräfte bekommen? Da würde ja die Faulenzerei direkt als Beruf eingeführt! Und dazu dann noch immer neue Steuern, und das zusammengeräuberte Volksvermögen würde durch die Tributzahlungen dem Erbfeind ausgeliefert. Diese Regierung richte das ganze deutsche Volk zugrunde. Es dürfe nicht eher Ruhe im Lande werden, bis sie hinweggefegt und Recht und Ordnung wiederhergestellt sei.
Einen starken Antrieb bekamen diese Debatten durch das Verhalten der Arbeiter im Schieferbruch. Dort war Hochbetrieb, denn das deutsche Geld verlor um diese Zeit stark an Wert. Die Bauern wurden dadurch ihre Schulden los, kauften Maschinen, Klaviere, ließen alte Häuser und Scheunen abreißen und bauten neue. Doch bei den Arbeitern reichte der Lohn kaum zum Sattessen. Daher war es schon einige Male zur Stilllegung der Arbeiten in den Schieferbrüchen gekommen. Die Arbeiter beriefen Versammlungen ein, ließen Redner aus Kulmberg kommen, und einige sagten ganz offen, dass endlich Ernst gemacht werden müsste mit der Revolution. Solange die Fabriken und Grund und Boden nicht dem Volke, sondern einzelnen Leuten gehören, die damit machen, was sie wollen, würden die Arbeiter immer weiter im Elend versinken. Tom war einer der Eifrigsten in der Streikführung, dazu ein Redner, dem kein Gegner gewachsen war.
Aber gerade darum, dachte Zander, müsste Karin einsehen, dass sie mit diesem Menschen nichts gemein haben könne, und gerade deshalb hatte er einen neuen Versuch gemacht, mit ihr und dem Neffen und Onkel zur Kirchweih zu gehen. Der alte Sterk und der Ludwig waren auch da, das andere würde sich dann schon finden. Aber wieder musste er sich vor dem alten Sterk herausreden, dass es gar nicht der „Schlawak“ ist, der schuld daran hat, dass die Karin so ganz anders ist als die andern. Dass das viel tiefer sitzt, noch von der Kindheit her, von der Mutter und von den Brüdern. Dass man Geduld haben müsse, Ludwig müsse ja auch noch einige Jahre Dienst beim Militär machen. Er glaubte selbst manchmal an das, was er zu Sterk sagte.
Auch der junge Prediger, der Herr Vikar, der Zander während seiner Krankheit manchmal aufgesucht hatte und sich auch später gern einladen ließ, bestätigte das. Er kam nun regelmäßig einmal die Woche. Karin kochte Kaffee, meistens blieb der Herr Vikar zum Abendbrot. Für den Menschen sei in diesen Zeiten äußerer Stürme der innere Frieden notwendiger denn je, sagte der Herr Vikar. Nur der unbedingte Glaube an Gott könne dem Menschen die innere Kraft und Zuversicht geben, allen Versuchungen des Satans, in welcher Gestalt und auf welchen Wegen er sich auch zu nähern suche, zu widerstehen. Manchmal waren auch Sterk und Ludwig dabei. Karin bediente sie alle stumm und still. An einem Abend kamen die Gäste auch auf die Politik zu sprechen. Sterk sprach die Befürchtung aus, dass Deutschland „russischen Zuständen“ entgegengehe. Ludwig jedoch war anderer Meinung. „Wenn’s einmal hart auf hart kommt, und es wird richtig hineingeknallt, dann spritzt das Gesindel auseinander wie ein Haufen Gänse“, sagte er verächtlich. „Die können bloß hetzen und aufwiegeln, solange sie nicht richtig angepackt werden, weil die Regierung der Bande den Rücken steift, und weil sie sich nur dadurch am Ruder halten kann. Aber lange dauert’s nimmer, und der Saustall wird ausgemistet, gründlich, und vorbei ist’s mit den gottlosen Hetzern!“ – „Das walte Gott!“, sagte der Herr Vikar. Dann tranken sie ihren Wein aus und verabschiedeten sich. Der Herr Vikar gab Karin immer zuletzt seine weiche, warme Hand und sah ihr ermunternd in die Augen.
Zander sah die Besuche des Herrn Vikars auch deshalb nicht ungern, weil dieser unverheiratet war. Wenn er darüber nachdachte, wer ihm als Schwiegersohn lieber sei, der Herr Vikar oder Ludwig, fiel der Vergleich zugunsten des Herrn Vikars aus. Er verargte es daher Karin auch nicht mehr so wie früher, dass sie gegen Ludwig zurückhaltend blieb.
Doch auch eine andere Sorge beschäftigte Zander um diese Zeit, und nicht nur Zander. Im Lerchenkessel, vor dem die Berge wie ein großes Hufeisen ineinanderlaufen, plante die Regierung einen Artillerieschießplatz anzulegen. Zander hatte dort das meiste Land, daher auch das größte Risiko, wenn er verkaufte. Doch die Regierung zahlte ungeheuer hohe Preise. Wenn Zander rechnete, wurde ihm ganz schwindlig im Kopf. Zwar wusste kein Mensch, wie das mit der Geldwirtschaft zuletzt ausgeht, doch so viel stand für Zander fest, dass der Wert des deutschen Geldes irgendwie und irgendwann wieder zurückkehren wird. Reißen aber wirklich „russische Zustände“ ein, dann ist ja sowieso alles verloren.
Auch der Wirt „Zum weißen Hirsch“ war für Verkauf. Doch er hatte wenig Land im Lerchenkessel. Viele andere Bauern aus Altendorf und Hühnerfeld waren dafür, weil das Land zu weit von diesen Dörfern ab lag, wieder andere, Arbeiter, trugen sich mit dem Plan, mit den Millionen, die sie für ihre Äcker erhalten würden, ein Häuschen zu bauen. Die Herren vom Vorstand des „Schützenvereins“ und vom „Bayerischen Bauernbund“ sagten, es sei „vaterländische Pflicht“, das Vaterland wieder so in Verteidigungszustand zu setzen, dass es in die Lage käme, das aufgezwungene Joch abzuschütteln. Dass Sterk abriet, Land zu verkaufen, wunderte Zander nicht. Er betrachtet eben mein Land schon als das seine, dachte er.
Der weitere Plan Zanders war, die Karin auf die „Hauswirtschaftsschule“ zu schicken, damit sie, wenn sie einmal einem feineren Haushalt vorsteht, den neuen Verhältnissen gewachsen ist. Auch ein Klavier wollte Zander kaufen, und sie sollte dann spielen lernen. Der Herr Vikar hielt diese Vorschläge für gut, und Zander war der festen Überzeugung, dass der Herr Vikar ihn nicht ermuntern würde, wenn er keine ehrlichen Absichten mit Karin hätte.
Karin hatte sich endlich entschlossen, an Tom zu schreiben. Sie wolle durch den offenen Bruch mit dem Vater das Unglück nicht von neuem herausfordern, teilte sie ihm mit. Sie trüge schwer an der Trennung, aber im anderen Falle würde sie den Vater in den Tod treiben. So teuer könne sie ihr Glück nicht erkaufen, nach all dem, was sie mit der Mutter und den Brüdern erlebt hatte. „Verstehe und verzeihe, Tom. Ich werde Dich nie vergessen.“
An diesem Abend fragte Zander Karin noch einmal, wie sie über seine Pläne denke. Karin wollte den Vater nicht gar so deutlich fühlen lassen, wie wenig Interesse sie dafür hatte. „Meinetwegen kann alles so bleiben, wie es ist“, sagte sie. Nun fraß sich ein schrecklicher Verdacht in Zander fest. Will Karin etwa abwarten, bis er stirbt, damit dann Tom doch Herr auf dem Zanderhof wird? Ist das vielleicht so abgemacht? Ist die ganze Art, wie die Karin sich gibt, nicht ein niederträchtiger Betrug?
Drei Tage später hatte Zander sein Land im Lerchenkessel verkauft. Als alle Formalitäten erledigt waren, war Zander plötzlich zumute, als hätte er sein Todesurteil unterschrieben. Er zählte vergeblich in den Millionen: er konnte den Sinn der Zahlen nicht erfassen. Einige Wochen später konnte er keinen Zentner Heu mehr dafür zurückkaufen, einige weitere Monate später keine Sichel.
Dann wurde das alte Geld außer Kurs gesetzt und neues eingeführt. In den Schieferbrüchen wurde die Belegschaft um die Hälfte verringert. Auch Tom war unter den Entlassenen. Da es auch mit den Finanzen in der Staatskasse nicht gut bestellt war, überließ die Regierung den Bauern das angekaufte Land zur Pacht. Das gab von neuem böses Blut. „Für unser Land sollen wir Pacht zahlen?“, protestierten die Bauern. „Wenn ein gewöhnlicher Mensch so eine Gaunerei macht, kommt er ins Zuchthaus, und wir sollen den Gaunern noch Belohnung zahlen? Niedergeknallt müssten sie werden, die Halunken!“
Doch der Bürgermeister, der Wirt „Zum weißen Hirsch“, und die Großbauern, die kein oder nur wenig Land verkauft hatten, waren nicht dieser Meinung. Die Landmesser, Offiziere und Zivilbeamten waren immer im „Weißen Hirsch“ zu Gast, und der Bürgermeister und die Herren vom Bauernbund und Kriegerverein waren sehr zuvorkommend gegen sie. Der Herr Vikar kam nicht mehr ins Zanderhaus, seit Zander gesagt hatte, er hätte nun bald genug vom Vaterland, das alles nimmt, die Söhne, die Frau, dann auch noch das Land, und nichts dafür gibt als schöne Worte.
Nun kam Ludwig Sterk heim. Er war zwölf Jahre Soldat gewesen und würde nun Sturmführer in der Hitlerpartei, und da er im Verkehr mit den Behörden und in der Abfassung von Schriftstücken gut Bescheid wusste, auch manchmal Artikel in der Zeitung schrieb, war er bald eine angesehene Persönlichkeit.
Zanders Haare waren weiß geworden, sein Gesicht grau und eingefallen. Er aß immer weniger. Nachts lag er wach im Bett.
Karin beobachtete die Veränderung ihres Vaters mit wachsender Angst. Doch wen sollte sie um Rat fragen? Sie schrieb an Tom. Auf dem Johannisberg trafen sie sich und nahmen auf einem gefällten Baum nebeneinander Platz.
„Wie geht’s dir, Karin? Bringst mir gute Botschaft?“, begann Tom.
„Die kann ich dir nicht bringen“, sagte Karin und wandte ihr Gesicht ab. „Ich wollte dich fragen, wie du denkst, was mit unserem Land wird. Ob wir das wiederkriegen oder ob uns das genommen ist für immer?“
„Wegen dem Land kommst du?“ Tom sah enttäuscht vor sich hin.
„Ja“, sagte Karin. „Ich habe Angst um meinen Vater.“
„Versteh schon“, antwortete Tom. „In dem Fall kann ich dir aber nicht viel Hoffnung machen.“
„Das Land ist also fort für immer?“
„Solange die, die geschröpft werden, nicht zusammenhalten und solchen Zuständen ein Ende machen, solange werden sie weiter geschröpft und niedergetrampelt. Wenn das anders werden soll, dann müssen die Arbeiter und Arbeitsbauern ihre Sache selber anpacken und das Staatsruder in die Hand nehmen. Dann wird es nicht schwer sein, Unrecht und Elend auszurotten, weil kein Mensch mehr davon profitiert.“
Karin schwieg. Plötzlich stand sie auf. „Nimm es mir nicht übel, Tom, dass ich deswegen gekommen bin.“
„Red nicht so, Karin. Zu mir kannst du immer und zu jeder Zeit kommen.“
„Du bist nimmer im Schieferbruch, Tom?“
„Nein! Ich bin wieder ein Pfannenflicker!“ Dann reichte Tom Karin die Hand. „Leb wohl, Karin. Wenn du mich wieder einmal brauchst, schreib.“
„Leb wohl, Tom!“
Die Regierung kündigte die Pachtverträge und entschied damit den Streit um das Land eindeutig zugunsten des Staates. „Und dabei“, meinte Sterk, „wär das alles zu überwinden, wenn die Karin nicht daherleben tät, als wäre es nicht Euer leibhaftiges Kind. Heut noch sagt der Ludwig ja, wenn sie ihm ein Wort gönnt. Aber lange schaut er das nimmer mit an, das hat er mir schon gesagt. Und er hat recht: In einem Haushalt, wo die Frau das Lachen vertreibt, würde er ja nicht warm. Er würde sein eigenes Unglück herausfordern. Aber dass die Karin neben ihrem eigenen Vater daherlebt, wie wenn sie blind wär, das versteh ich nicht. Das versteht überhaupt kein Mensch.“
Sterk ging nach Hause. Zander blieb in der Stube sitzen. Nach einer Weile rief er Karin. „Setz dich her, Karin“, sagte er feierlich, „ich möchte mit dir sprechen.“ Karin setzte sich, horchte misstrauisch auf. „Du weißt, Karin, wie es mit uns steht“, fuhr Zander fort. „Zeitlebens haben wir mit dem Unglück gerungen, und immer wieder haben wir es niedergezwungen. Jetzt kannst nur du noch helfen. Der Nachbar hat jetzt noch einmal gefragt, und zum letzten Mal, ob du ja sagst für Ludwig.“
„Verlange, was du willst, Vater, nur das nicht!“, antwortete Karin.
„Ich wollte dich bloß fragen, Karin“, sagte Zander, „zwingen will ich dich nicht!“
Dann ging er vors Haus und setzte sich auf die Bank. Karin zündete in der Kammer des Vaters die Lampe an. Punkt zehn Uhr ging er immer schlafen. Er saß jedoch länger, und es war ein kalter Herbstabend.
„Komm herein, Vater“, bat Karin, „du erkältest dich sonst!“
„Mir ist nicht kalt“, antwortete Zander. „Geh in dein Bett, Karin, ich komme gleich.“
Karin legte sich in ihre Kammer, aber sie wachte. Nach einer Weile ging Zander durch die Tenne in den hinteren Hof. Dort sprach er mit dem Hund. Dann ging die Scheunentür auf.
Von einem schrecklichen Verdacht gepackt, lief Karin in die Scheune. Ein schauerliches Röcheln und Rascheln bestätigte Karins Verdacht. Zander hing an einem Strick am Balken. Die Leiter hatte er weggestoßen.
Karin lief ins Haus und holte ein Messer, stellte die Leiter an, schnitt den Strick durch, fiel mit dem Vater die Leiter hinab, löste den Strick. Dann holte sie Licht, Zanders Atem wurde ruhiger, und nun erkannte er über sich das Gesicht Karins. „Warum denn nun das, Karin?“, fragte er. „Es wär doch jetzt endlich alles vorbei.“
„Red nicht so, Vater!“, sagte Karin. „Es wird auch anders gehen!“ Dann führte sie ihn ins Haus und brachte ihn ins Bett.
Ein Jahr später war Karin mit Ludwig Sterk verheiratet.
Ludwig Sterk war Mitglied der Kreisleitung seiner Partei und war auch als Kandidat für den Landtag aufgestellt worden. Er war viel als Versammlungsredner unterwegs, manchmal mehrere Tage hintereinander.
In Heiligenhain und Umgebung stieß jedoch die Agitation der Hitlerpartei auf starken Widerstand. Der Prozess der um ihr Land betrogenen Bauern wurde von Instanz zu Instanz geschleppt. Die Kleinbauern hatten sich ein Komitee geschaffen und die Forderung aufgestellt: bedingungslose Rückgabe des Landes an die früheren Eigentümer. Auch Tom war Mitglied dieses Komitees. Viele Arbeiter waren nun arbeitslos und auf ihr Land noch mehr angewiesen als früher.
Im Zanderhaus waren oft Zusammenkünfte der Nazipartei. An einem trüben Winterabend versammelten sich einige der jungen Burschen schon früher als sonst. Wenn Karin in die Stube trat, verstummten sie und saßen mit wichtigen Mienen am Tisch. Um acht Uhr sagte Ludwig zu Karin, sie könne nun zu Bett gehen. Der alte Zander schlief seit Karins Heirat in der Dachkammer.
Karin ging in das Schlafzimmer, gegenüber der Wohnstube. Nun hörte sie, dass diese von innen verschlossen wurde. Sie ließ die Tür zum Schlafzimmer angelehnt, warf noch einige Kohlen in den Ofen, löschte das Licht aus und setzte sich auf einen Stuhl an die Tür.
Bald darauf ratterte ein Motorrad heran. Der Fahrer sprang vor dem Hause ab, klopfte an die Fensterläden. Ludwig öffnete die Haustür, dann die Stubentür und schloss wieder zu. Karin hörte, wie der Motorradfahrer aufgeregt meldete: „Er ist da. Sie sitzen beim Binder!“
Karins Unruhe schlug in Schrecken um. Der Binder war der Vorsitzende des Komitees. Die Bauern in Altendorf und Hühnerfeld hatten beschlossen, nach Kulmberg zu marschieren, um so ihren Forderungen auf Rückgabe des Landes Nachdruck zu verleihen. In der Versammlung in Heiligenhain sollte Tag und Zeitpunkt des Abmarsches festgelegt werden. Karin zog ihre Schuhe aus und Hausschuhe an. Dann schlich sie an die Stubentür und hörte, wie Ludwig sagte:
„Du fährst wieder zurück und passt auf, wenn er aus dem Haus geht. Und dann kommst du sofort wieder und hupst dreimal. Weiter nichts. Und ihr geht dann durch den Wald, über die Hühnerkoppen. Bis er die Straße herumkommt, seid ihr droben. Und dann nicht lange Faxen gemacht: das Eis eingehauen, einen Stein um den Hals und hinein mit ihm in den Weiher. Bis morgen früh ist er wieder zugefroren, und die Fische haben was zu fressen über den Winter. Und dann kommst du noch einmal zurück und hupst zweimal, damit ich weiß, ob alles gut gegangen ist. Und im Fall, dass doch verschiedene Leut neugierig werden sollten: Wir sind hier in meinem Haus beisammen gewesen, und dann seid ihr heimgegangen. Zeugen sind vorhanden, darüber braucht ihr euch keine Sorgen zu machen.“
Nun wurde das Rücken von Stühlen hörbar. Karin ging in ihre Kammer zurück. Der Motorradfahrer ging aus dem Haus und fuhr los. Karin band ein Tuch um den Leib und zog ihren Mantel und Schuhe an. Sie musste ohne Tuch um den Kopf über den Hof gehen, damit sie, wenn nötig, sagen konnte, sie gehe zum Abort. Aber wenn sie durch die hintere Gartentür ist, muss sie das Tuch umbinden, damit niemand sie erkennt. Wenige Minuten später klopfte sie bei Binder ans Fenster.
„Du, Karin?“, sagte Binder erstaunt, als Karin in den Flur getreten war.
„Ist der Tom da?“
„Er soll heut nicht heimgehen. Und passt alle gut auf, euch droht nichts Gutes!“ Karin berichtete dann, was sie gehört hatte. Im Dunkel der Nacht kam sie wieder unbehelligt zurück.
Aber der Motorradfahrer kam nun doch und hupte wie verabredet dreimal. Die Burschen in der Stube brachen auf und machten sich auf den Weg. Ludwig schloss die Haustür zu und legte sich neben Karin in sein Bett. Und nach langen, bangen Stunden kam der Motorradfahrer, hupte zweimal und raste davon.
Hatte Tom die Warnung nicht beachtet? Die Stunden bis zum Morgen schienen zur Ewigkeit zu werden. Und die erste Nachricht, die Ludwig aus dem Dorf brachte, war die: Ein Eisenbahner, der in der Nacht von Hühnerfeld nach Oberndorf gegangen war, wird vermisst. Man fand seinen Esskoffer, seine Mütze und Blutspuren. Binder und Tom wurden als des Mordes verdächtig verhaftet, denn der Eisenbahner war ebenfalls ein Nazi. Tom war in der Mordnacht in Heiligenhain. Um zehn Uhr hatten Tom und Binder das Haus des Binder verlassen. Um zehn Uhr war auch der Eisenbahner fortgegangen. Dass Tom und Binder zu einem Kameraden gegangen sind, zum Veidt-Robert, glaubte man ihnen nicht. Im Gegenteil: Auch Robert wurde verhaftet, denn auch er gehörte zum Komitee. Die angesagten Versammlungen wurden verboten. Bis zum Mittag war das ganze Dorf bis in alle Einzelheiten informiert, dass niemand anders als die „Schrammbande“ den Mann erschlagen und bald aufgeklärt sein würde, wohin sie ihn verschleppt hätten.
„Traurig genug“, sagte Ludwig beim Essen, „dass verschiedene Leute nicht eher glauben, was das für Halunken sind, bis sie auf so eine traurige Art aufgeklärt werden. Aber jetzt wird ihnen ihr blutiges Handwerk schon gelegt werden. Es ist aber auch die höchste Zeit.“
„Bewiesen ist doch noch gar nichts“, sagte Karin nun. Es waren die ersten Worte, die sie an diesem Tag zu ihrem Mann gesprochen.
„Was redest du denn daher!“, fuhr Ludwig hoch. „Sonst kriegst dein Maul nicht auseinander, und jetzt willst du wohl noch Partei ergreifen für die Lumpen!“
„Ho, ho!“, mischte Zander sich ein. „Ein Wort sagen darf sie doch wohl noch.“
Ludwig schlug auf den Tisch. „Wenn ich sage, sie schweigt, dann schweigt sie!“
„Und wenn ich nicht schweige?“ Karin sah Ludwig fest in die Augen. „Du hast wohl ein schlechtes Gewissen?“
Ludwig wollte sich auf Karin stürzen – Zander sprang jedoch dazwischen. „Solang ich lebe, haust du nicht auf ihr herum, verstanden!“ Ludwig riss sich los. Draußen im Hof stürzte er sich von neuem auf Karin und würgte sie. Zander ergriff einen Knüppel und schlug auf Ludwig ein. Der ließ Karin los, griff Zander an der Brust und warf ihn rücklings über den Hauklotz. Ein Aufschrei, dann ein weinerliches Wimmern, dann verzerrte sich Zanders Gesicht und die Augen schienen sich umzudrehen.
„Vater, Vater!“, schrie Karin und warf sich über ihn. Durch Zanders Körper ging ein Ruck, und ein Blutstrom ergoss sich aus dem Mund in den Schnee. Urplötzlich stand der alte Sterk im Hof und sah mit aschfahlem Gesicht auf den toten Nachbar.
Ludwig lief ins Haus, raffte alles vorhandene Geld zusammen, setzte sich auf sein Motorrad und fuhr davon.
Karin und der alte Sterk trugen den toten Zander ins Haus.
Dann fuhr Karin nach Kulmberg zur Polizei und machte ihre Aussage. Am anderen Tage wurden Tom und seine Genossen entlassen.
Eine Woche später fuhr Binder vors Zanderhaus. Karin hatte ihre Sachen, die Sachen ihrer Mutter und einige Andenken in die beiden alten Truhen und ihren Schrank verpackt. Dann holte sie den alten Sterk und sagte:
„Da schaut her, was ich mitnehme. Und auf das Haus und das Vieh müsst ihr halt vorläufig aufpassen, bis alles vom Gericht aus geregelt ist.“
Dann luden sie die Sachen auf den Wagen. Binder fuhr sie zu Karins Onkel. Karin ging voraus durch den Wald. Dort wartete Tom auf sie.
Das letzte Wort
Es hatte bereits drei Wochen geregnet, als endlich die Sonne wieder durchkam, und Krummhofer hatte das Heu der zweiten Mahd auf den Wiesen liegen. Da durften Menschen und Vieh nicht geschont werden. Das meiste Heu kam auch gut unter Dach, nur auf das letzte Fuder, das die Krummhoferin mit den Kühen heimfuhr, prasselte ein hagelkalter Regenguss, der auch die Krummhoferin bis auf die Haut durchnässte. Anderen Tags klagte sie über Halsschmerzen, bekam Fieber, dann Lungenentzündung, und eine Woche später starb sie. An ihrem Bett standen vier Kinder: der Simon, die Martha, die Julie und der Peter. Sie waren in recht ungleichem Alter: der Simon achtzehn, die Martha zwölf, die Julie zehn und der Peter acht Jahre alt. Haus, Scheune und Vieh waren versichert, die Frau nicht. Krummhofer konnte durch doppelte Arbeit nichts aufholen, denn er hatte schon immer so viel gearbeitet, als er konnte.
Einige Wochen nach der Beerdigung zahlte Krummhofer Maria, der Magd, die Hälfte des Jahreslohnes auf den Tisch und sagte: „Wenn du noch einen Monat warten könntest mit dem andern Teil, dann tätst du mir einen großen Gefallen.“
Maria hatte in den letzten Wochen immer wieder daran denken müssen, was die Bäuerin in den letzten, lichten Stunden aus dem hohen Fieber heraus zu ihr gesagt hatte. „Maria“, hatte sie gesagt, „wenn ich fort muss, und du kannst es, hilf ihm über das Schlimmste hinweg. Und wenn du auch das könntest, ganz bei ihm bleiben, schon wegen der Kinder, dann wär mir das Sterben um vieles leichter. Und lohnen wird er es dir, kannst es mir glauben, Maria, und die Kinder auch, wenn du sie davor bewahrst, ganz ohne Mutter zu bleiben oder eine fremde zu bekommen, wo sie so mit in den Kauf genommen werden.“
„Ich brauch jetzt kein Geld“, antwortete Maria hastig. „Ich hab jetzt gar nicht damit gerechnet, wo mir doch auch noch alles so wund und weh ist. Ein paar Mark brauch ich, zum Kochen und für die Wirtschaft. Mit dem anderen Geld werden wir schon einig werden. Ich bin doch jetzt nicht auf das Geld versessen, das dürft Ihr doch nicht von mir denken.“ Doch gerade durch die Antwort Marias fiel Krummhofer plötzlich ein, dass Maria in den letzten Wochen kein Geld für den Haushalt und die Wirtschaft verlangt hatte. Krummhofer grübelte, wann er ihr zum letzten Male Geld gegeben. Er konnte sich auch entsinnen. Zehn Mark waren es, einige Tage nach der Beerdigung. Sicher hatte Maria von ihrem eigenen Geld zugelegt. Auch hatte Krummhofer ihr jedes Jahr zehn Mark zum Lohn zugelegt. In diesem Jahr hatte er nichts davon erwähnt, obgleich Maria noch früher aufstand, noch später schlafen ging, sonntags in ihrer Kammer saß und für die Kinder flickte und stopfte, hundert Dinge bedenken und machen musste, die sonst die Bäuerin gemacht hatte. „Entschuldige, Maria“, sagte Krummhofer, „es ist nicht nur der Lohn. Es sind ja so viele Sachen, die wir noch bereden müssen. Es ist halt ein großes Loch geblieben, das nicht zugedeckt werden kann wie ein Grab. Nimm das Geld für die Wirtschaft. Schreib alles genau auf, und fass das nicht falsch auf. Ich weiß, du rechnest schon richtig, aber du rechnest mehr als richtig. Und reden wir dann über das andere später.“