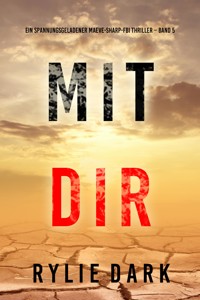4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lukeman Literary Management
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Becca Thorn FBI-Thriller
- Sprache: Deutsch
FBI-Agentin Becca Thorn ist einem Serienmörder auf der Spur, der es auf einsame Einzelgänger abgesehen hat. Er bringt seine Opfer an den Rand des Schweigens, bevor er ihnen das Leben nimmt. Mit einem einzigartigen Gift, das die Stimme raubt, hinterlässt der Killer keine Spuren. Becca muss die verdrehten Hinweise entwirren und dieses tödliche Katz-und-Maus-Spiel beenden, bevor sie selbst ins Visier des Mörders gerät. "Ein Pageturner der Extraklasse. Ich konnte das Buch nicht aus der Hand legen und habe bis zum Schluss nicht erraten, wer der Täter war!" – Leserkommentar zu "Only Murder" ⭐⭐⭐⭐⭐ "Für immer verschwunden" ist der fünfte Band einer neuen Reihe der Bestsellerautorin und von Kritikern gefeierten Krimi- und Thrillerautorin Rylie Dark, deren Bücher über 2.000 Fünf-Sterne-Rezensionen erhalten haben. Die Reihe beginnt mit "Eiskalte Spur" (Buch 1). Dieser fesselnde und erschütternde Psychothriller mit der brillanten und gequälten Protagonistin Becca Thorn ist der Auftakt zu einer packenden Krimiserie voller Action, Spannung, unerwarteter Wendungen und Enthüllungen. Mit atemberaubendem Tempo fesselt sie die Leser bis spät in die Nacht. Fans von Karin Slaughter, Teresa Driscoll und Robert Dugoni werden begeistert sein. Weitere Bände der Reihe sind in Vorbereitung. "Ich habe diesen Thriller verschlungen. Viele überraschende Wendungen und ich lag mit meinen Vermutungen völlig daneben ... Den zweiten Band habe ich schon vorbestellt!" – Leserkommentar zu "Only Murder" ⭐⭐⭐⭐⭐ "Dieses Buch startet mit einem Knalleffekt ... Eine fesselnde Lektüre, ich kann den nächsten Band kaum erwarten!" – Leserkommentar zu "See Her Run" ⭐⭐⭐⭐⭐ "Fantastisches Buch! Ich konnte es kaum aus der Hand legen. Bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht!" – Leserkommentar zu "See Her Run" ⭐⭐⭐⭐⭐ "Die Wendungen haben mich immer wieder überrascht. Ich kann es kaum abwarten, den nächsten Band zu lesen!" – Leserkommentar zu "See Her Run" ⭐⭐⭐⭐⭐ "Ein Muss für alle Fans von actiongeladenen Geschichten mit packender Handlung!" – Leserkommentar zu "See Her Run" ⭐⭐⭐⭐⭐ "Ich bin ein großer Fan dieser Autorin und diese Reihe beginnt mit einem Paukenschlag. Man bleibt bis zum Ende dran und will mehr." – Leserkommentar zu "See Her Run" ⭐⭐⭐⭐⭐ "Diese Autorin ist einfach unglaublich! Man könnte sagen, sie spielt in einer eigenen Liga. Sie wird noch weit kommen!" – Leserkommentar zu "Only Murder" ⭐⭐⭐⭐⭐ "Ich habe dieses Buch wirklich genossen ... Die Charaktere waren lebendig und die Wendungen großartig. Man liest bis zum Ende und will mehr." – Leserkommentar zu "No Way Out" ⭐⭐⭐⭐⭐ "Diese Autorin kann ich nur empfehlen. Ihre Bücher machen süchtig." – Leserkommentar zu "No Way Out" ⭐⭐⭐⭐⭐
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
FÜR IMMER VERSCHWUNDEN
EIN BECCA-THORN-FBI-THRILLER – BUCH 5
Rylie Dark
Die Bestsellerautorin Rylie Dark hat eine beeindruckende Bibliografie vorzuweisen. Zu ihren Werken zählen mehrere erfolgreiche Thriller-Reihen, darunter:
- Die sechsteilige SADIE PRICE FBI SUSPENSE THRILLER-Reihe
- Die sechsteilige CARLY SEE FBI SUSPENSE THRILLER-Reihe
- Die sechsteilige MIA NORTH FBI SUSPENSE THRILLER-Reihe
- Die fünfteilige MORGAN STARK FBI SUSPENSE THRILLER-Reihe
- Die achtteilige HAILEY ROCK FBI SUSPENSE THRILLER-Reihe
- Die sechsteilige TARA STRONG MYSTERY-Reihe
- Die fünfteilige ALEX QUINN FBI SUSPENSE THRILLER-Reihe
- Die fünfteilige MAEVE SHARP FBI SUSPENSE THRILLER-Reihe
- Die fünfteilige KELLY CRUZ FBI SUSPENSE THRILLER-Reihe
- Die siebenteilige JESSIE REACH FBI SUSPENSE THRILLER-Reihe (weitere Bände in Planung)
- Die fünfteilige BECCA THORN FBI SUSPENSE THRILLER-Reihe (weitere Bände in Planung)
- Die fünfteilige CASEY FAITH SUSPENSE THRILLER-Reihe (weitere Bände in Planung)
- Die fünfteilige ARIA BRANDT SUSPENSE THRILLER-Reihe (weitere Bände in Planung)
- Die fünfteilige HAYDEN SMART SUSPENSE THRILLER-Reihe (weitere Bände in Planung)
- Die neue fünfteilige SLOANE RIDDLE SUSPENSE THRILLER-Reihe (weitere Bände in Planung)
Als leidenschaftliche Leserin und lebenslange Liebhaberin des Krimi- und Thriller-Genres freut sich Rylie über Ihre Zuschrift. Besuchen Sie www.ryliedark.com, um mehr zu erfahren und in Kontakt zu bleiben.
© 2024 Rylie Dark. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Autorin in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln – elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder anderweitig – reproduziert, in einem Retrievalsystem gespeichert oder übertragen werden, es sei denn, dies ist durch den U.S. Copyright Act von 1976 ausdrücklich gestattet. Dieses E-Book ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch lizenziert und darf nicht weiterverkauft oder an Dritte weitergegeben werden. Wenn Sie dieses Buch mit jemand anderem teilen möchten, erwerben Sie bitte für jeden Empfänger ein zusätzliches Exemplar. Falls Sie dieses Buch lesen, ohne es gekauft zu haben, oder es nicht für Ihren persönlichen Gebrauch erworben wurde, bitten wir Sie, es zurückzugeben und Ihr eigenes Exemplar zu kaufen. Vielen Dank, dass Sie die harte Arbeit der Autorin respektieren.
Dies ist ein Werk der Fiktion. Namen, Charaktere, Orte und Vorfälle sind entweder Produkt der Fantasie der Autorin oder werden fiktiv verwendet. Jegliche Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, lebend oder tot, Ereignissen oder Schauplätzen ist rein zufällig.
PROLOG
KAPITEL EINS
KAPITEL ZWEI
KAPITEL DREI
KAPITEL VIER
KAPITEL FÜNF
KAPITEL SECHS
KAPITEL SIEBEN
KAPITEL ACHT
KAPITEL NEUN
KAPITEL ZEHN
KAPITEL ELF
KAPITEL ZWÖLF
KAPITEL DREIZEHN
KAPITEL VIERZEHN
KAPITEL FÜNFZEHN
KAPITEL SECHZEHN
KAPITEL SIEBZEHN
KAPITEL ACHTZEHN
KAPITEL NEUNZEHN
KAPITEL ZWANZIG
KAPITEL EINUNDZWANZIG
KAPITEL ZWEIUNDZWANZIG
KAPITEL DREIUNDZWANZIG
KAPITEL VIERUNDZWANZIG
PROLOG
Der Rumpf der “Solace” glitt lautlos durch den spiegelglatten See und teilte das Wasser mit einem sanften Zischen. Meredith Adams lehnte sich im Kapitänssessel ihres bescheidenen Kreuzers zurück und ließ ihren Blick über den Horizont schweifen, wo Wasser und Himmel zu verschmelzen schienen. Das Sonnenlicht tanzte auf den Wellen und zeichnete einen schimmernden Pfad, der sie von den Zwängen ihres Landlebens weglockte.
Meredith, eine Krankenschwester, die an das ständige Piepen von Monitoren und die Hektik der Krankenhausflure gewöhnt war, fand hier ihre Zuflucht. Der See, obwohl klein, bot die ersehnte Ruhe - ein wohltuender Kontrast zum Trubel von Salt Lake City. Hier in Little Port, Utah, war sie nicht Schwester Adams, sondern einfach Meredith, die den Duft frischer Kiefern einatmete und spürte, wie die Last der Welt von ihren Schultern fiel.
Sie erhob sich, streckte ihre von der letzten anstrengenden Schicht steifen Glieder und tastete sich an der kühlen Metallreling des Bootes entlang. Eine sanfte Brise trug den Ruf eines fernen Vogels heran, der ihre momentane Stimmung widerspiegelte. Die Gelassenheit der Wildnis zog sie magisch an, eine Einfachheit, nach der sie sich sehnte. Inmitten der Natur fühlte sich Meredith lebendig - lebendiger als unter den grellen Lichtern ihres Berufsalltags.
Meredith ging zum Bug, ihre Schritte trotz des sanften Schaukelns sicher, und ließ das rhythmische Plätschern des Wassers gegen die “Solace” ihre strapazierten Nerven beruhigen. Mit jedem Atemzug frischer Luft löste sich die stressbedingte Anspannung in ihrer Brust wie ein Muskelknoten. Die Ruhe des Sees war Balsam für ihre Seele, seine sanften Hügel ein Schutzwall gegen die Außenwelt.
Auf der Bootskante sitzend, die Beine über den Rand baumelnd, blickte sie in die klare Tiefe unter ihr, in der sich der Himmel spiegelte. Hier herrschte Frieden, unberührt von Notfällen oder Herzschmerz. Diese Momente erinnerten sie daran, warum sie so hart für andere kämpfte - für die Chance, die Schönheit eines einzelnen Lebens inmitten des Chaos zu bewahren.
Little Port war ihr Zufluchtsort geworden, eine Oase, in der die einzigen Geräusche die Gaben der Natur waren. Das leise Rascheln der Blätter, das sanfte Plätschern der Fische, das Flüstern des Windes - sie alle sprachen eine Sprache der Widerstandsfähigkeit und Erneuerung. Es war ein Dialog, an dem sie jedes Wochenende teilnahm, wobei ihre Seele dem Ruf der Wildnis folgte, verborgen hinter ihrer praktischen Fassade.
Hier, an Bord ihres Bootes, war Meredith Adams frei, trieb auf einem ruhigen See und war Herrin ihres eigenen Schicksals, wenn auch nur für eine Weile.
Ihre Gedanken wurden durch das leise Schnurren eines Motors unterbrochen, das ihre Träumerei durchbrach. Von Norden her näherte sich ein Boot, dessen Seiten in der untergehenden Sonne glitzerten. Ein Ruderboot. Meredith richtete sich auf und kniff die Augen zusammen, um gegen das grelle Licht den Neuankömmling zu erkennen. Es war ungewöhnlich, dass sich andere so weit hinauswagten, schon gar nicht in der Dämmerung.
„Guten Abend!”, rief eine freundliche Stimme über das Wasser. Meredith beobachtete, wie ein Mann am Ruder die Hand zum Gruß hob. „Ein herrlicher Abend zum Segeln, nicht wahr?”
„In der Tat”, antwortete sie, obwohl ihre Stimme ihn kaum erreichte. Als das Boot näher kam, konnte sie die Details erkennen - ein kleines Boot, ein Ruderboot, das sich stark von ihrem eigenen unterschied. Der Mann mit dem ergrauten Bart und den lachenden Augen trug trotz der Wärme des Tages einen einfachen Strickpullover. Seine Ausstrahlung wirkte aufrichtig.
„Bruder Andrew”, stellte er sich vor und verlangsamte das Boot, als es näher kam. „Darf ich an Bord kommen?”
Meredith zögerte, ihre Instinkte mahnten zur Vorsicht. Der See war ihr Zufluchtsort, ihre Einsamkeit eine notwendige Erholung von den Anforderungen ihres Lebens. Einen Fremden an Bord zu lassen, fühlte sich an wie ein Eindringen in ihren persönlichen Rückzugsort. „Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist”, rief sie mit fester, aber höflicher Stimme zurück.
Bruder Andrews Lächeln blieb unbeirrt. „Ich verstehe dein Zögern”, sagte er. „Aber ich versichere dir, dass ich nichts Böses im Sinn habe. Ich habe dein Segel gesehen und dachte, es wäre schön, die Schönheit dieses Abends mit jemandem zu teilen, der sie offensichtlich genauso zu schätzen weiß wie ich.”
Meredith musterte ihn und wog seine Worte ab. Sein Auftreten hatte etwas Entwaffnendes an sich, eine Aufrichtigkeit, die ihren Widerstand schwinden ließ. Nach einem Moment seufzte sie und nickte. „In Ordnung, aber nur für eine kurze Zeit. Sei vorsichtig beim Übersteigen.”
„Danke”, erwiderte Bruder Andrew, und seine Stimme klang warm vor Dankbarkeit. Mit geübter Leichtigkeit manövrierte er sein Boot längsseits, vertäute es und betrat mit einem anmutigen Nicken das Deck. „Ich möchte nicht stören. Ich habe nur dein Segel am Horizont gesehen und dachte, ich sollte dich begrüßen.”
„Hallo”, erwiderte Meredith, deren anfängliche Zurückhaltung der Neugier gewichen war. An Bord angekommen, respektierte Bruder Andrew ihren persönlichen Raum und verschränkte die Hände hinter dem Rücken, während er die Aussicht genoss.
„Meine Reisen haben mich hierher geführt”, fuhr er fort, den Blick auf die umliegenden Hügel gerichtet. „Die Welt steckt voller Wunder, aber nur wenige kommen an die Gelassenheit von Little Port heran.”
„Bist du ein Weltenbummler?” fragte Meredith, die sich mit verschränkten Armen gegen den Mast lehnte.
„So in der Art.” Er schmunzelte. „Ich lasse mich vom Wind treiben, sammle Geschichten und Erfahrungen.”
„Das muss ein erfülltes Leben sein”, sinnierte sie und stellte sich diese Freiheit vor.
„Reicher als jede Münze es messen kann”, stimmte er zu und seine Augen trafen ihre mit einem Funken Verständnis. „Man begegnet allen möglichen Menschen unterwegs. Letzte Woche zum Beispiel traf ich eine Frau, die ihre eigenen Instrumente baut. Geigen und Celli, die sie mit eigenen Händen erschafft.”
„Faszinierend”, sagte Meredith und ließ sich von seinen Erzählungen in den Bann ziehen. Für eine Frau, die ihre Tage von sterilen Wänden umgeben verbrachte, war die Verlockung des Abenteuers groß. Bruder Andrew malte mit seinen Worten Bilder, Szenen von lebhaften Basaren und stillen Bergen, und jede Geschichte entfaltete sich in den Farben ferner Länder.
„Jeder Mensch hat eine Geschichte”, sagte er und deutete auf die offene See. „Selbst an so beschaulichen Orten wie diesem.”
„Mag sein”, räumte Meredith ein und ließ ihren Blick zum Horizont schweifen. Sie fragte sich, ob ihre eigene Geschichte von langen Schichten und geretteten Leben für einen Fremden wie Bruder Andrew genauso spannend wäre.
„Vielleicht erzählst du mir eines Tages deine”, schlug er vor, seine Stimme sanft und einladend.
„Vielleicht”, wiederholte sie und wandte ihren Blick wieder diesem rätselhaften Mann mit seinem leichten Charme zu. Er hatte etwas an sich, das im Widerspruch zu seiner schlichten Erscheinung stand. Wer war Bruder Andrew wirklich? Und was führte ihn zu ihr, inmitten dieser großen Ruhe?
Als die Sonne tiefer sank und einen karmesinroten Schimmer über das Wasser warf, wurde Meredith klar, dass ihr friedlicher Abend eine unerwartete Wendung genommen hatte. Dennoch konnte sie ein Flackern der Vorfreude auf das Geheimnis dieses Fremden nicht leugnen, ein Flüstern von Abenteuer in der stillen Seeluft.
Meredith beäugte das Fläschchen mit einer Mischung aus Neugierde und Skepsis. Bruder Andrew schraubte den Deckel ab und goss eine bernsteinfarbene Flüssigkeit in zwei kleine Becher aus seiner Tasche.
„Eine besondere Mischung”, erklärte er und reichte ihr einen Becher. „Jedes Kraut wurde wegen seiner einzigartigen Eigenschaften ausgewählt, alles von meinen Reisen mitgebracht.” Seine Augen fingen das schwindende Licht ein und funkelten vor dem Reiz geteilter Geheimnisse.
Die Krankenschwester in Meredith mahnte zur Vorsicht, aber die Naturliebhaberin in ihr war von den exotischen Kräutern fasziniert. Nach kurzem Zögern nahm sie den Becher an, und ihre Finger berührten die seinen in einem flüchtigen Moment des Vertrauens. Sie hoben ihre Becher und nickten dem Zufall zu, der sie auf dieser weiten Wasserfläche zusammengeführt hatte.
„Prost”, sagte sie, das Wort kaum hörbar in der Abendbrise.
„Zum Wohl”, erwiderte Andrew mit einem überzeugenden Lächeln.
Die Flüssigkeit war mild, mit einem erdigen Unterton, der an ferne Orte erinnerte. Meredith ließ die Aromen auf ihrer Zunge tanzen, bevor sie schluckte. Ein Gefühl der Wärme breitete sich in ihrer Brust aus, eine angenehme Wärme, die die kühle Abendluft zu vertreiben schien.
Doch dann spürte sie ein Kribbeln in der Kehle, zunächst ganz subtil, wie das warnende Jucken einer Allergie. Sie räusperte sich in der Hoffnung, das Gefühl zu lindern. Bruder Andrew beobachtete sie, sein Blick undurchdringlich.
„Interessanter Geschmack”, kommentierte Meredith, aber ihre Stimme war rau und verriet sie. Die Wärme in ihrer Brust fühlte sich jetzt wie eine glühende Kohle an, und sie holte tief Luft, um das wachsende Unbehagen zu unterdrücken.
„Ziemlich einzigartig, nicht wahr?” antwortete Andrew in einem Ton, der so glatt war wie die Oberfläche des Sees.
Bei einem weiteren Versuch zu sprechen, spürte Meredith, wie sich das Raspeln in ein heiseres Krächzen verwandelte. Panik flatterte in ihrer Brust wie ein gefangener Vogel. Sie sah zu Bruder Andrew auf, ihre Augen weit aufgerissen, auf der Suche nach einem Anzeichen von Besorgnis, einem Hinweis darauf, dass er erkannte, dass etwas nicht stimmte.
Aber er lächelte sie nur an, ein ruhiges, gleichmütiges Lächeln, das nicht bis zu seinen Augen reichte. In diesen Augen, die einst warm und einladend waren, glitzerte jetzt etwas Kälteres, etwas Kalkulierendes.
„Stimmt etwas nicht, Meredith?”, fragte er mit einer Stimme, die wie ein Schlaflied klang und im krassen Gegensatz zu den Alarmglocken stand, die in ihrem Kopf schrillten.
Sie öffnete den Mund, um zu antworten, um zu fragen, was in dem Getränk war, doch kein Laut kam über ihre Lippen. Ihre Stimme, einst klar und selbstsicher, versagte ihr nun den Dienst. Hektisch deutete sie auf ihre Kehle, während sich das Gefühl ausbreitete und eine lähmende Taubheit ihre Glieder erfasste.
Bruder Andrew neigte den Kopf zur Seite und beobachtete ihr Ringen, als wäre sie ein faszinierendes Exemplar unter dem Mikroskop. „Die Macht der Natur ist wahrlich beeindruckend, nicht wahr?”, sinnierte er, fast zu sich selbst.
Merediths Gedanken überschlugen sich. Sie musste handeln, irgendetwas unternehmen, bevor ihr Körper sie vollends im Stich ließ. Doch mit jeder verstreichenden Sekunde schwanden ihre Kräfte, und sie stand der erschreckenden Gelassenheit dieses Mannes hilflos gegenüber. Als ihre Sicht verschwamm, wurde Meredith klar, dass die Einsamkeit des Meeres vielleicht ein verführerischer Lockruf gewesen war, der sie in Tiefen führte, aus denen es kein Entrinnen mehr gab.
Ihre Finger kratzten über die glatte Oberfläche der Kühlbox, ihr Griff rutschte ab, als ihr Körper sie verriet. Die Welt unter ihren Füßen geriet ins Wanken und ahmte das sanfte Schaukeln ihres Bootes auf dem Wasser nach. Panik schnürte ihr die Kehle zu, fester als der unsichtbare Schraubstock, der ihr die Stimme geraubt hatte. Sie konnte nicht mehr schreien, konnte keine Antworten mehr von dem Mann fordern, der mit einer Maske der Ruhe vor ihr stand.
Mit einem verzweifelten Satz griff sie nach dem Geländer, ihre Hände schlossen sich um das kalte Metall. Es bot einen kurzen Moment der Stabilität in dem Strudel, zu dem ihre Sinne geworden waren. Jeder Herzschlag dröhnte in ihren Ohren, ein Paukenschlag in dem Chaos, das sich in ihr ausbreitete. Ihre Beine zitterten, ihre Muskeln schienen sich unter der Anstrengung, sie aufrecht zu halten, aufzulösen.
Bruder Andrew trat einen Schritt näher, die Hände ausgestreckt, als wolle er sie auffangen. Doch Meredith wich instinktiv zurück. Das Vertrauen, das sie ihm einmal entgegengebracht hatte, war so schnell verflogen wie der Morgennebel über dem See. Sie versuchte, die Kraft aufzubringen, ihn wegzustoßen, Abstand zwischen sein Gift und ihre schwindende Entschlossenheit zu bringen, aber ihre Arme waren bleischwer und gehorchten ihr nicht mehr.
„Hilfe”, wollte sie schreien, aber es war nicht mehr als ein Flüstern, das im Wind unterging. Der Himmel über ihr drehte sich, ein schwindelerregendes Gemälde aus Blau- und Grautönen. Ihre Knie gaben nach, und sie stürzte auf das Deck. Die Welt kippte bedrohlich, während sie gegen die eindringende Dunkelheit ankämpfte.
Bruder Andrew gurrte leise, seine Worte ein grausamer Trost. „Lass los, Meredith. Es ist einfacher, wenn du dich nicht wehrst.”
Das Wort “wehren” entfachte einen Funken in ihr, ein Aufflackern der Hartnäckigkeit, die sie sowohl als Krankenschwester als auch als Frau, die den Trost des Meeres liebte, ausgezeichnet hatte. Doch der Funke war flüchtig, erstickt von der betäubenden Flut, die in ihr aufstieg und sie in einen Abgrund zog, gegen den sie machtlos war.
Als sich ihre Sicht verdunkelte, war das Letzte, was sie sah, Bruder Andrews Gesicht, das über ihr schwebte, eine teilnahmslose Maske, die ihren Abstieg in die Bewusstlosigkeit mit klinischer Distanz beobachtete. Da war keine Bosheit, keine Genugtuung, nur die kalte Neugier eines Wissenschaftlers, der ein Experiment zu Ende führt.
Dann verblasste auch das. Die Geräusche des Sees - das sanfte Plätschern des Wassers gegen den Schiffsrumpf, die fernen Schreie der Möwen - verstummten. Merediths Welt reduzierte sich auf das Nichts, eine Leere, in die das Bewusstsein entglitt und sie in einem Meer der Dunkelheit trieb.
KAPITEL EINS
Becca Thorns Atem vermischte sich mit dem Nebel, als sie das schattenhafte Gelände der Ersten Göttlichen überblickte. Ihr Herz hämmerte in der Brust, während Stille über der Landschaft Utahs lag. Sie rückte ihre Kevlar-Weste zurecht, der Stoff fühlte sich ungewohnt an, obwohl sie jahrelang für Momente wie diesen trainiert hatte. Ihr Mentor, Eli Bennett, stand neben ihr, den Blick auf die verfallenen Gebäude gerichtet, die vor ihnen lagen.
„Überprüf nochmal deine Waffe”, murmelte Eli. Es war eine überflüssige Erinnerung; Becca hatte ihre Waffe bereits zweimal kontrolliert. Trotzdem zog sie sie aus dem Holster, der Schlitten fühlte sich kalt unter ihren Fingern an.
„Alles klar”, antwortete sie mit fester Stimme, obwohl die Erinnerungen an ihre Vergangenheit hinter diesen Mauern durch ihren Kopf wirbelten.
„Vergiss nicht, wir sind wegen der Kinder und möglicher Beweise hier”, sagte Eli und sah ihr in die Augen. In seinem Blick lag das Gewicht einer gemeinsamen Geschichte, ein Verständnis, das tiefer ging als Worte.
Becca nickte. Das Bild eines jungen Mädchens mit strahlenden Augen und schüchternem Lächeln blitzte vor ihrem inneren Auge auf. Stella. Ihre Schwester, zumindest hoffte sie das. Der heutige Tag könnte einen Abschluss bringen oder alte Wunden aufreißen. Sie schob den Gedanken beiseite und konzentrierte sich auf die bevorstehende Aufgabe.
„Lass es uns zu Ende bringen”, flüsterte sie, und ihre Worte lösten sich im Nebel auf.
Sie gingen weiter, das Gras war feucht unter ihren Stiefeln. Jeder Schritt fühlte sich wie eine Ewigkeit an, jeder Atemzug war eine bewusste Anstrengung. Das Licht des frühen Morgens verlieh der Anlage einen unwirklichen Glanz, doch Becca wusste es besser. Das Leid, das sich hinter diesen bröckelnden Mauern abgespielt hatte, hatte nichts Göttliches an sich.
Als sie sich der Absperrung näherten, gab Eli ihr ein Zeichen, die Führung zu übernehmen. Beccas Puls beschleunigte sich, und die vertraute Last der Verantwortung legte sich auf ihre Schultern. Dies war mehr als nur ein weiterer Einsatz; es war etwas Persönliches. Sie war einst von diesem Ort geflohen, als verängstigtes Kind, das die Welt außerhalb der Reichweite der Sekte nicht verstand. Jetzt kehrte sie als FBI-Agentin zurück, fest entschlossen, genau das zu zerstören, was sie einst kontrolliert hatte.
Ihre Hand schwebte in der Nähe ihres Holsters, bereit für jedes Anzeichen von Bewegung. Aber da war nur Stille, die Art, die nach Erwartung, nach Hinterhalt schrie. Sie umklammerte ihre Waffe fester, bereit für das Chaos, aber betend für den Frieden - für die Kinder, die noch immer gefangen waren, für Stella und für sich selbst.
„Durchbruch in drei”, zählte Eli leise herunter.
„Zwei.”
„Eins.”
Die Tür gab mit einem Krachen nach und durchbrach den Zauber der morgendlichen Ruhe. Beccas Herz raste, als sie in die Vergangenheit trat, ihre Zukunft stand auf dem Spiel.
Beccas Stiefel sanken in die weiche Erde, ihr Atem war ein nebliger Dunst in der Kälte der Morgendämmerung. Das Gelände zeichnete sich als geisterhafte Silhouette vor dem grauen Himmel ab. Sie ging zielstrebig voran und führte das Team an, während Eli sie links flankierte. Ihre Schatten dehnten sich lang und verzerrt auf dem nebelverhangenen Boden aus, als wollten sie sie zurück in die heimtückische Dunkelheit ziehen, der sie unbedingt entkommen wollten.
Die Stille war ohrenbetäubend. Keine Stimme, kein Schritt, nichts als das gedämpfte Flüstern ihrer Bewegungen, die sich in der Morgenluft verloren. Beccas Instinkte kribbelten; Verbindungen wie diese schliefen nie, hielten nie inne - wo waren also die Wachen? Wo waren die wachsamen Augen, die sie hätten im Auge behalten müssen?
„Zu ruhig”, murmelte sie, mehr zu sich selbst als zu den anderen, und ihre Stimme erreichte Eli kaum.
„Bleib wachsam”, antwortete er, sein Tonfall war ruhig, aber mit dem gleichen Unbehagen, das Becca in den Magen griff.
Sie umkreisten das Hauptgebäude, das größte der baufälligen Gebäude, die das Herz von The First Divine bildeten. Die Fenster starrten auf sie zurück, leere Höhlen im Zwielicht. Beccas Griff um ihre Waffe wurde fester, jeder Schritt war wohlüberlegt, jeder Blick suchte nach dem kleinsten Anzeichen einer Bewegung.
Das Symbol des Ersten Göttlichen war allgegenwärtig. Auf Türen gemalt, in Wände geritzt, auf zerfledderte Fahnen gestickt, die regungslos in der stillen Luft hingen - eine Sonnenscheibe mit einem Auge in der Mitte. Es beobachtete sie, ohne zu blinzeln, und erinnerte sie ständig an die Macht, die es über diejenigen hatte, die sich darin befanden - und über Becca. Ein Schauer durchlief sie, ein Geist der Angst, die sie als Kind gekannt hatte, gefangen unter dem Blick dieses immer wachenden Auges.
Sie schüttelte die Erinnerungen ab und weigerte sich, sie an sich heranzulassen. Jetzt war nicht der Zeitpunkt, an dem die Vergangenheit ihr Urteilsvermögen trüben durfte. Die Kinder brauchten sie ganz im Hier und Jetzt, als die Agentin, zu der sie ausgebildet worden war - nicht als das verängstigte Mädchen von einst.
„Alles klar”, flüsterten die Teammitglieder, als sie die Nebengebäude überprüften. Jede Meldung durchbrach die bedrückende Stille wie feiner Riss.
Elis Blick traf den ihren, eine stumme Frage in seinen Augen. Wenn jemand den Gefühlssturm in ihr verstehen konnte, dann er. Doch Verständnis allein brach weder den Griff des Kults, noch fand es die vermissten Schwestern. Nur Taten konnten das bewirken. Und dafür waren sie hier.
„Hauptgebäude”, sagte Becca und nickte in Richtung des sich abzeichnenden Eingangs. Ihre Stimme war stählern, ihre Entschlossenheit unerschütterlich. Heute würden sie die Schichten aus Geheimnissen und Lügen abtragen. Heute würden sie Licht ins Dunkel bringen.
„Los geht's”, befahl Eli, und gemeinsam näherten sie sich der Schwelle von Beccas ehemaligem Gefängnis, das sich nun in ein Schlachtfeld verwandelt hatte.
Beccas Atem bildete kleine Wölkchen in der Kälte, als sie dem Aufbrecher zunickte, ihr Körper vor Anspannung vibrierend. Mit einem dumpfen Schlag zersplitterte der Türrahmen unter der gezielten Wucht des Rammbocks. Sie stürmten hinein, eine Flut aus taktischen Westen und gezückten Waffen ergoss sich in den düsteren Innenraum.
„Links frei!” “Rechts räumen!” Die Befehle hallten von den Wänden wider, und die Spannung stieg, während die Räume in Windeseile gesichert wurden. Becca bewegte sich mit geübter Präzision, ihr Verstand messerscharf, obwohl ihr Herz raste. Dies war kein gewöhnlicher Einsatz, sondern eine zutiefst persönliche Angelegenheit. Während die Agenten die schreienden Sektenmitglieder ��berwältigten, suchten ihre Augen fieberhaft nach dem einen Gesicht, auf das es ankam - Stellas.
Sie nahm eine Bewegung wahr - ein Kind, das zwischen den Schatten huschte. „Läufer!”, rief sie, gefolgt vom schnellen Getrappel verfolgender Stiefel. Ihre Konzentration blieb ungebrochen; diese Kinder würden jetzt in Sicherheit sein, aber Stellas Zeit lief ab.
„Thorn, mit mir”, bellte Eli. Becca löste sich von der Gruppe und folgte ihm tiefer in das labyrinthische Gelände. Jeder ger��umte Raum war ein Hoffnungsschimmer, jeder leere eine herbe Enttäuschung. Sie kannte den Grundriss wie eine vernarbte Stelle an ihrem Körper, doch die Vertrautheit trug wenig dazu bei, die Frustration zu lindern, die in ihrer Kehle brannte.
„Monroe muss hier sein”, murmelte sie, wobei der Name einen bitteren Nachgeschmack hinterließ.
„Bleib wachsam”, ermahnte Eli sie, obwohl seine Stimme die gleiche Dringlichkeit verriet. „Wir werden ihn finden.”
Sie bogen um eine weitere Ecke, und das Chaos des Überfalls verblasste zu einer fernen Kakophonie. Beccas Puls hämmerte in ihren Ohren, jeder Sinn war geschärft für die bevorstehende Aufgabe. Sie sah einen Stoffblitz, einen Vorhang, der sich dort bewegte, wo kein Wind hinreichte.
„Hier!”, rief sie und stürmte vorwärts. Eine verborgene Tür gab unter ihrer Schulter nach und enthüllte einen engen Raum, in dem es nach Weihrauch und Angst roch. Aber er war leer - kein Monroe, keine Stella.
„Verdammt”, fluchte sie, ihre Wut loderte auf. Instinktiv griff sie nach oben, die Finger streiften die kurzen Strähnen ihres Haares, eine Erinnerung an die Kontrolle, die sie jetzt über ihr eigenes Leben hatte.
„Lass uns zurückgehen”, sagte Eli und berührte leicht ihren Arm - eine Geste der Solidarität, die sie kaum wahrnahm.
„Warte”, sagte Becca und ließ ihren Blick noch einmal durch den Raum schweifen. Es musste einen Hinweis geben, etwas, das sie übersehen hatten. Doch alles, was sie anstarrte, war das spöttische Sonnensymbol, dessen Auge sie unverwandt fixierte. Und immer noch keine Spur von Stella.
„Zurück zum Hauptbereich”, drängte Eli. „Wir gruppieren uns neu und machen weiter ...”
„Ohne sie?” Beccas Stimme brach. Der Gedanke, dass Monroe sich erneut ihrem Zugriff entziehen und Stella mitnehmen könnte, war unerträglich. Aber die Leere des Raumes rief ihr ihre schlimmsten Befürchtungen ins Gedächtnis: Es könnte bereits zu spät sein.
Mit einem letzten, vernichtenden Blick drehte sie sich auf dem Absatz um und folgte Eli zurück in den Kampf, wobei sich ihre Entschlossenheit zu einem festen Entschluss verdichtete. Dies war nicht das Ende, es war ein neuer Anfang. Monroe würde einen Fehler machen, und wenn er das tat, würde sie zur Stelle sein. Und sie würde nicht aufhören - nicht bevor sie Stella gefunden und die Erste Göttliche Stück für Stück niedergerissen hatte.
Beccas Stiefel hallten auf dem kalten Boden wider, ihr Atem ging flach und schnell, als sie durch einen engen Korridor eilte. Ihr Herz raste bei jeder Wendung, jede offene Tür bot die Chance, sich der Vergangenheit zu stellen, der sie zu entkommen versucht hatte. Das Chaos des Hauptangriffs war ein entferntes Dröhnen, unterbrochen von Rufen und dem gelegentlichen Schrei eines Kindes.
„Frei”, meldete sie mit fester Stimme trotz des Aufruhrs in ihrem Inneren, als sie einen weiteren leeren Raum durchsuchte.
Während sie tiefer in das labyrinthische Gelände vordrang, hämmerte Becca jedes Detail durch den Kopf, jeder Schatten ein potenzieller Hinweis auf Stellas Versteck. Sie hielt inne, als ein leises Wimmern an ihr Ohr drang. Instinktiv folgte sie dem Geräusch und bog um eine scharfe Ecke, wo sie auf eine Gruppe Kinder stieß, die sich zitternd unter einer zerschlissenen Decke zusammenkauerten, die Augen vor Angst weit aufgerissen.
„Hey, keine Angst”, flüsterte Becca, steckte ihre Waffe weg und ging in die Hocke, um auf Augenhöhe mit ihnen zu sein. Ihr Blick wurde sanfter. „Ich bin hier, um euch zu helfen.”
Ein kleines Mädchen mit tr��nenverschmierten Wangen sah zu ihr auf. „Sind die bösen Männer weg?”
„Sie werden euch nichts mehr tun”, versicherte Becca mit beruhigender Stimme. Sie streckte ihre Hand aus, und nach kurzem Zögern ergriff das Mädchen sie. Die zarte, zitternde Berührung bestärkte Becca in ihrer Entschlossenheit. Sie würde Stella finden, koste es, was es wolle.
„Kommt, ich bringe euch in Sicherheit”, sagte sie und führte die Kinder behutsam zum Ausgang.
Nachdem die Kleinen in der Obhut ihrer Kollegen waren, widmete sich Becca wieder ihrer dringlichen Aufgabe. Der Nebel von draußen schien bis in die Mauern des Geländes vorgedrungen zu sein, die Luft war schwer vor Ungewissheit. Sie drang weiter vor, stieß Türen auf und huschte durch spärlich beleuchtete Gänge, während ihre Frustration mit jedem erfolglosen Schritt wuchs.
„Stella?”, rief sie, und ihre Stimme hallte von den abblätternden Wänden und dem zertrümmerten Mobiliar wider. Doch nur Stille antwortete auf ihr Flehen.
Jeder Raum erwies sich als Sackgasse, jeder Korridor als Schleife, die sie zu verhöhnen schien. Dieser Ort war eine Festung, darauf ausgelegt, sie in die Irre zu führen, und es funktionierte. Beccas scharfer Verstand arbeitete auf Hochtouren, versuchte, einen Plan zu erstellen basierend auf der Anlage, die sie aus ihrer Kindheit kannte und die dieser hier so ähnlich war. Doch es gab genug Unterschiede, um sie zu verwirren.
„Thorn!” Elis Stimme knisterte über Funk. „Wie ist dein Status?”
„Ich suche noch”, erwiderte sie knapp und befestigte das Funkgerät wieder an ihrem Gürtel. Sie mussten hier irgendwo sein. Monroe war zu gerissen, um spurlos zu verschwinden.
Ihr Blick blieb an einem verblassten Wandgemälde hängen, das Symbol des Sonnenaufgangs grinste sie höhnisch an, eine bittere Erinnerung an ihr früheres Leben. Beccas Hand ballte sich zur Faust. Es ging nicht nur darum, die Kinder zu retten oder die Sektenmitglieder festzunehmen; dies war eine persönliche Angelegenheit. Sie wurde das ungute Gefühl nicht los, dass Monroe ihren Zug vorausgesehen hatte, dass er Stella entführt hatte und im Morgennebel untergetaucht war.
Die Verbindung lieferte keine Antworten, sondern nur noch mehr Fragen, und die Ungewissheit nagte an ihrer Entschlossenheit. Doch Becca war nicht der Typ, der sich dem Zweifel hingab. Sie würde diesen Ort Stein für Stein auseinandernehmen, wenn es sein musste. Vater Monroe war ihnen schon einmal durch die Lappen gegangen, aber nicht dieses Mal.
„Becca”, holte Elis Stimme sie in die Realität zurück, „wir müssen uns neu formieren.”
„Verstanden”, antwortete sie mit eiserner Stimme. Als sie ihre Schritte zurückverfolgte, begann das Morgenlicht die Schatten zu vertreiben. Stella war noch da draußen, und Becca würde alles tun, um sie zu finden. Der Kampf war noch lange nicht vorbei.
Beccas Stiefel hallten auf dem kalten, harten Boden wider, als sie das Gelände durchkämmte. Ein leerer Raum nach dem anderen verspottete ihre Bemühungen mit seiner Trostlosigkeit. Agenten schlurften vorbei, ihre Gesichter gezeichnet von derselben Enttäuschung, die auch an ihr nagte. Stella und Monroe hätten hier sein sollen, inmitten des Chaos und der br��ckelnden Wände. Aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt.
„Frei!”, rief ein Agent aus einer entfernten Kammer, und das Wort schnitt wie ein Messer durch die stickige Luft.
„Irgendwelche Spuren?”, fragte Becca, obwohl sie die Antwort bereits ahnte.
„Nichts”, erwiderte der Agent, die Schultern unter der Last der Erschöpfung hängend.
Die nagende Frustration zehrte noch stärker an Beccas Entschlossenheit. Könnte Monroe Wind davon bekommen haben? Gab es einen Maulwurf in ihren Reihen? Die Fragen schossen ihr wie Kugeln durch den Kopf, doch keine traf ins Schwarze. Sie drängte weiter vorwärts, getrieben von einer Dringlichkeit, die an Leichtsinn grenzte. Stellas Gesicht flackerte vor ihrem inneren Auge auf und trieb sie an, ein geisterhaftes Leuchtfeuer in der schwindenden Hoffnung.
Ein älterer Mann wurde an ihr vorbeigeführt, die Hände gefesselt und den Blick gesenkt. Becca packte seinen Arm und zog ihn zur Seite. Sein Blick hob sich, um dem ihren zu begegnen, und für einen Moment sah sie die Jahre der Indoktrination, die sich in seine müden Züge eingegraben hatten.
„Wo ist euer Anführer?”, verlangte sie mit grimmiger Stimme zu wissen.
Die Lippen des Älteren verzogen sich zu einem schmalen Strich, sein Schweigen war vielsagender als jedes Geständnis. Sie suchte in seinen Augen nach einem Funken Menschlichkeit, den sie entfachen könnte. Doch da war nichts.
„Vater Monroe”, zischte sie, sein Name schmeckte bitter auf ihrer Zunge. „Wo ist er?”
Der Älteste schwieg beharrlich.
„Eine Frau namens Stella”, fuhr Becca fort und wandte sich in ihrer wachsenden Verzweiflung nach Antworten um. „War sie hier?”
„Ich kenne keine Frau dieses Namens”, erwiderte der Älteste resigniert. „Und Vater Monroe ... hat uns schon vor geraumer Zeit den Rücken gekehrt.”
„Den Rücken gekehrt?” hakte Becca nach. „Was meinst du damit?”
„Er ist fort. Er war nicht hier.”
„Wo zum Henker steckt er dann?”
„Ich weiß es nicht, ich schwöre.”
Seine Beteuerung klang so eindringlich, dass sie wahr sein musste. Beccas Finger schlossen sich um den Arm des Älteren, ihr Blick war kühl und unnachgiebig. Der Mann schrumpfte unter ihrem Blick zusammen, ein Seufzer der Niederlage entwich seinen dünnen Lippen.
„Wohin ist er gegangen? Wo hat er Stella hingebracht?”
„Ich weiß es nicht”, wiederholte der Älteste, und seine Schultern sackten unter seinem schlichten Gewand zusammen. „Er nahm einige von uns mit ... einige der Kinder ... sie waren willig, begierig. Er sprach von einem neuen Ort ... einem Heiligtum.”
„Und Sie haben keine Ahnung, wo das sein soll?” fragte Becca, ihre Stimme vor Dringlichkeit bebend, die von den kahlen Wänden des Geländes widerzuhallen schien.
„Nein ...” Der Blick des Mannes sank zu Boden, sein Alter und seine Reue zeichneten sich in den schlaffen Falten seines Gesichts ab. „Sie sind in der Nacht aufgebrochen ... wir haben sie nicht gehen sehen ... ich habe Monroe seitdem nicht mehr zu Gesicht bekommen.”
Becca ließ ihn los und wich zurück, als hätte sie sich verbrannt. Ihr wurde übel, eine Welle des Entsetzens wallte in ihrem Magen auf. Monroe war weitergezogen und hatte unschuldige Leben mit sich gerissen - vermutlich auch das von Stella.
Sie gab einem der anderen Agenten ein Zeichen herüberzukommen, und der Agent nahm den älteren Mann umgehend fest. Bei all den Informationen, die er preisgegeben hatte, hätte er genauso gut Luft sein können - eine Sackgasse, die nur dazu diente, ihren Fokus zu schärfen. Sie würden einen anderen Weg finden müssen. Es blieb ihnen keine andere Wahl.
KAPITEL ZWEI
Beccas Schatten fiel auf die milchige Glasscheibe des Verhörraums, ihre Haltung straff vor Anspannung. Eli Bennett stand neben ihr, seine Augen verdunkelten sich unter der Last der Enttäuschung. „Wir sind in eine Sackgasse geraten”, sagte er mit tiefer, gleichm��ßiger Stimme. „Keiner von ihnen weiß, wohin Monroe verschwunden ist.”
Das grelle Neonlicht des Flurs warf harte Linien auf Elis Gesicht und betonte die Falten, die die Zeit in seine Haut gegraben hatte. Becca spürte ein vertrautes Kribbeln im Magen, wie es bei Rückschlägen und zerplatzten Hoffnungen auftritt. Sie verschr��nkte die Arme und strich mit den Fingern über den Stoff ihrer Anzugjacke - eine bewusste Barriere gegen die aufsteigende Frustration.
„Könnte es sein, dass sie uns anlügen?” Ihre Frage durchbrach das monotone Surren der Klimaanlage.
Eli schüttelte den Kopf, sein Blick entschlossen. „Ich kenne Lügner, Becca. Die hier sind verängstigt, verwirrt. Sie wissen es wirklich nicht.”
Sie drehte sich um und warf einen Blick auf die geschlossene Tür, hinter der die Überbleibsel des Ersten Göttlichen saßen - Anhänger ohne Hirten. Monroe war wie vom Erdboden verschluckt und hatte seine Herde führungslos zurückgelassen. Für Becca wirkte das zu inszeniert, zu bequem für einen Mann wie ihn. Aber es gab keine Spur, keine geflüsterten Geständnisse von den Lippen seiner Anhänger, die sie zu Stella geführt hätten.
„Dann hat er sie tatsächlich im Stich gelassen”, murmelte sie, mehr zu sich selbst als zu Eli. Die Vorstellung, dass Monroe seine Position, seinen großen Plan, einfach aufgeben würde, nagte an ihr. Er war so anders als der berechnende Mann, an den sie sich aus ihrer Kindheit erinnerte - der Mann, der einst ihre ganze Welt in seinem eisernen Griff gehalten hatte. Monroe hatte über die Kommune geherrscht wie ein Gott und alle erfolgreich einer Gehirnwäsche unterzogen. Becca konnte sich noch daran erinnern, wie sie mit den anderen Kindern in einem riesigen Raum auf dem Boden schlief; sie erinnerte sich an Stella, die neben ihr lag und manchmal die gleiche Angst in den Augen hatte wie sie selbst.
„Sieht ganz danach aus.” Elis Antwort holte Becca aus ihren Gedanken zurück. „Und wir haben das Lager aufgelöst und die Leute befreit. Das ist ein Erfolg.”
„Ist es das?” Die Worte schmeckten bitter. „Ohne Stella fühlt es sich nicht danach an.”
„Becca ...”, setzte Eli an, doch sie hob eine Hand, um ihn zu stoppen.