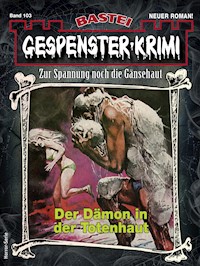1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
Chuck Wackerly, Hehler und Betrüger im großen Stil, hatte Todesangst!
Natürlich hatte er von dem Fluch gewusst, der dem Ding innewohnte, das Ganze aber für puren Aberglauben gehalten. Wenn es um eine so berühmte Waffe ging wie das Schwert des "unsterblichen Samurai" Tsukahara Bokuden, dann wucherten die Gerüchte ins Uferlose. Nichts wurde so sehr mit dem Wesen des japanischen Kriegeradels in Verbindung gebracht wie sein Schwert - es galt als die Seele des Samurai, war untrennbar mit ihm verbunden. Nichts war so erniedrigend für einen Samurai, wie von seinem Schwert getrennt zu sein. Ein Schwert zu stehlen, noch dazu aus einem Grab, war ein unvorstellbares Verbrechen, das die fürchterliche Rache des gekränkten Toten nach sich zog ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Das Schwert des toten Samurai
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabeder beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati / BLITZ-Verlag
eBook-Produktion:3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 9-783-7325-9635-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Das Schwert des toten Samurai
von Camilla Brandner
Chuck Wackerly, Hehler und Betrüger im großen Stil, hatte Angst. Todesangst.
Natürlich hatte er von dem Fluch gewusst, der dem Ding innewohnte, aber – du meine Güte, diese Menschen im Orient waren oft ziemlich abergläubisch, sahen überall Geister und Dschinns und Dämonen, und wenn es um eine so berühmte Waffe ging wie das Schwert des »unsterblichen Samurai« Tsukahara Bokuden, dann wucherten die Gerüchte überhaupt ins Uferlose!
Nichts wurde so sehr mit dem Wesen des japanischen Kriegeradels in Verbindung gebracht wie sein Schwert – es galt als die Seele des Samurai, war untrennbar mit ihm verbunden. Nichts war so erniedrigend für einen Samurai, wie von seinem Schwert getrennt zu sein. Ein Schwert zu stehlen, noch dazu aus einem Grab, war ein unvorstellbares Verbrechen, das die fürchterliche Rache des gekränkten Toten nach sich zog …
Humbug. Geschwätz. Alteweibermärchen. Kein Europäer des aufgeklärten 19. Jahrhunderts, vor allem kein Untertan der Königin Viktoria glaubte an solchen Unsinn.
Aber jetzt, wo das Schwert in einer sorgfältig verschlossenen Vitrine in seinem Trophäenzimmer hing, wurde der kleine, feiste Mann mit der wie ein Wachtelei braun gesprenkelten Glatze das Gefühl nicht los, dass es ihn beobachtete wie ein lebendiges Wesen.
Immer wieder musste er den Blick von seinem Schreibtisch wenden, um sich zu vergewissern, dass es noch an seinem Ort hing – und um es zu bewundern.
Das Katana, wie diese typisch japanischen Waffen genannt wurden, hatte einen mit Lederschnüren umwickelten Handgriff und eine etwa zwei Fuß lange, einschneidige, leicht gekrümmte Klinge ähnlich der eines Säbels. Es war stark genug, ein Holzbrett zu zerhauen, und gleichzeitig scharf genug, ein fliegendes Seidentuch in der Luft zu zertrennen.
Und was für ein wunderschönes Ding das war! Katanas galten als der absolute Gipfel der Schmiedekunst, und seine Eleganz, seine ästhetische Vollkommenheit hatte Chuck noch mehr fasziniert als der ungeheure Wert, den es in den Augen von Waffensammlern in aller Welt hatte.
Okay, es hatte eine blutige Vergangenheit – welche berühmte Waffe hatte die nicht? Der Samurai Tsukahara Bokuden war der »unsterbliche Samurai« genannt worden, weil er aus so vielen erbitterten Kämpfen unbeschadet hervorgegangen war, während seine Gegner als ein Haufen zerstückelter Leichen zurückblieben. Er hing an dem Schwert, so erzählte die Sage, wie an einem lebendigen Wesen, er liebte es mehr als alles andere auf Erden.
Er hatte bestimmt, dass es zusammen mit ihm begraben werden sollte, und das war auch geschehen. Nach altem Brauch war sein Körper verbrannt worden, dann wurden die Knochenreste von seinen engsten Verwandten aus der Asche geklaubt und in einer Urne von ungewöhnlichem Format beigesetzt, die auch das Schwert enthielt.
Kein Japaner hätte gewagt, dieses ebenso ehrwürdige wie gefährliche Grab zu entweihen. Aber da waren die europäischen Händler, die ihre Handlanger unter allerlei üblem Volk hatten …
Jedenfalls war das Schwert aus der Begräbnisstätte verschwunden, und obwohl sich ein Aufschrei allgemeiner Empörung erhob, als der Raub bemerkt wurde, war es unmöglich wiederzuerlangen, denn inzwischen war es in London gelandet.
Chuck Wackerly war sich durchaus im Klaren darüber gewesen, was fanatische Japaner mit ihm anstellen würden, wenn sie den Aufenthaltsort des Schwertes entdeckten und seinen Räuber zu fassen bekamen, also verbarg er seinen Schatz vor der Öffentlichkeit in seinem Arbeitszimmer, in dem er sich stets einschloss, wenn er wichtige Dinge zu erledigen hatte. Schließlich war der Handel mit gestohlenen Wertgegenständen aus dem Orient ein Beruf, der nach Diskretion verlangte.
Als zusätzliche Sicherheit hatte er seinen Raub mit Absicht falsch deklariert, das Zettelchen auf der Vitrine und die Eintragung im Katalog gaben »antiker Türkensäbel, Vorbesitzer unbekannt« an. Wenn man sich nicht sehr gut auskannte, musste man es für ein hübsches, aber relativ unbedeutendes Schwert halten, das unter vielen anderen Exotika die Wand schmückte.
Wackerly war bekannt dafür, dass er seine Kostbarkeiten mit irgendwelchem Ramsch untermischte, da gab es antike Perlengehänge, die als kompletter Satz zusammen mit Talmischmuck aus dem Bazaar verkauft wurden, und – nun, eben alte Türkensäbel unbekannter Herkunft.
Wieder hob er den Kopf. Es mochte nur eine Unregelmäßigkeit im Glas der Vitrine sein, aber ihm schien, als bewegte sich das Schwert. Ein Zittern durchlief die perfekte Klinge, als bebte sie innerlich vor Zorn. Klar, wenn die Alteweibermärchen stimmten und der Samurai wirklich, wie man es dieser Kriegerkaste nachsagte, seine Seele mit seinem Schwert geteilt hatte, dann war diese Seele jetzt sehr wütend.
Na ja, sollte sie wütend sein. Letztendlich war auch ein berühmtes Katana nichts weiter als ein Stück kunstvoll bearbeiteter Stahl.
Und die Geschichte von den Onryō, die seine orientalischen Mittelsmänner ihm erzählt hatten – papperlapapp. Auch so ein Geschwätz von Halbwilden. Ihnen zufolge hätte der Samurai nämlich trotz seines untadeligen Lebens im Tod keinen Frieden gefunden, da er nicht im Kampf gefallen, sondern als Greis an einer langwierigen Krankheit gestorben war.
Nach dem Glauben der Japaner war ein solcher Tod eines Kriegers unwürdig und hinterließ eine Seele, die sich schämte, zürnte und Bitterkeit gegen alle Welt empfand. Sie wurde ein Onryō, ein Totengeist. Es waren gefährliche, bösartige Kreaturen der Nacht, und wenn ein solcher verbitterter Geist dann auch noch beraubt und verspottet wurde, wie es dem Tsukahara Bokuden widerfahren war, kannte seine Rachsucht keine Grenzen.
Ein leises Geräusch wurde hörbar, ein Schwirren wie der Gesang einer Zikade, aber so zart, dass Chuck – dessen Nerven inzwischen ziemlich überreizt waren – ihn gerade noch hören konnte. Er kam eindeutig von der Vitrine her.
Der Händler sprang auf, hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, nachzusehen, was sich da abspielte, und der entsetzlichen Angst, die ihn gepackt hielt. Denn jetzt war die Bewegung der stählernen Klinge ganz eindeutig, sie vibrierte wie die Zunge einer Maultrommel, und der Griff bewegte sich deutlich sichtbar hin und her.
Packte da eine unsichtbare Hand zu? Wackerly schalt sich einen Dummkopf, aber zugleich suchte er mit schweißnassen Händen nach seinen Safeschlüsseln. So ungern er auf den herrlichen Anblick verzichtete, es war an der Zeit, das Katana an einem sicheren Ort unterzubringen. Das Glas der Vitrine mochte einbruchsicher sein, dennoch erschien es ihm plötzlich nicht mehr stark genug.
Er eilte in den dunkelsten Winkel seines Arbeitszimmers und drückte dort auf einen verborgenen Knopf. Ein Bücherregal glitt lautlos zur Seite. Dahinter wurde die mächtige, plump verzierte Eisentür eines altmodischen Safes sichtbar. Das große Schloss wirkte geradezu kindisch, aber das diente auch nur als Verzierung. Geöffnet wurde er mit vier verschiedenen feinen Schlüsseln, die in einer bestimmten Reihenfolge eingesteckt werden mussten.
Chuck Wackerly ließ beinahe den Schlüsselbund fallen, so glitschig waren seine Hände, als das Singen der Zikade lauter und lauter in seinen Ohren schrillte.
»Scheißding!«, fluchte er. »Ich hätte die Urne des alten Eisenbeißers umstoßen und die Knochenreste verstreuen sollen, dann könnte er jetzt nicht um mich herumspuken …«
Die Zikade schwieg. Chuck fuhr herum, mehr erschreckt von dieser plötzlichen Stille als von dem unheimlichen Grillengesang zuvor. Sein Blick fiel auf eine leere Vitrine. Neben ihr stand, so groß, dass der Helmkamm die Zimmerdecke streifte, eine grauenhafte schwarze Gestalt. Ein gewaltiger Ritter, von Kopf bis Fuß in zackiges Eisen gerüstet, ein schmales Schwert in den mit metallenen Handschuhen bedeckten Händen und eine schaurige, einem Totenkopf ähnliche goldene Maske vor dem Gesicht.
Er wirkte vollkommen real. Das rötliche Licht der Gaslampen spiegelte sich hundertfach in seinem blank polierten Harnisch, dessen unzählige Spitzen und Stacheln ihm das Aussehen eines menschengroßen Reptils verliehen – einer Kreatur halb Mann, halb Echse, die ein wütendes Zischen von sich gab.
Schon der Anblick genügte, dass Chuck Wackerly beinahe zu Boden stürzte. Aber da streifte auch schon ein Luftzug seine Knöchel, fadendünn und eisig kalt.
Chuck blickte hinunter, und bei der Bewegung lösten sich seine beiden Füße vom Körper und blieben für sich allein stehen, während der Rest in sich zusammensackte. So fassungslos, dass er nicht einmal Schmerz fühlte, kniete der Grabräuber auf seinen verstümmelten Beinen.
Ein Schatten beugte sich über ihn. Wieder wehte die eisige Luft ihn an, aber diesmal berührte sie ihn an der linken Halsseite, fuhr durch den Nacken, die Schulter und den rechten Oberarm. Er wollte schreien, aber aus seiner zertrennten Luftröhre kam nur noch ein krächzendes Pfeifen. Dann fiel der Kopf zu Boden und rollte in der Blutlache umher, die sich immer weiter ausbreitete.
Sein umnebelter Blick suchte noch einmal die verfluchte Vitrine. War sie zertrümmert, lag sie in Scherben? Wer hatte das Schwert geraubt und ihn damit hingerichtet?
Die Vitrine war unberührt. Ihre Glasflächen schimmerten im Lampenlicht. Im Inneren lag das Schwert auf seinem geschwungenen Ständer, unbeweglich, gleißend und von keinem Tröpfchen Blutes befleckt.
†
Die herbeigerufenen Polizisten wunderte es nicht besonders, als sie den Körper in diesem ungewöhnlichen Zustand fanden. Chuck Waverly war auch in der Unterwelt nicht beliebt gewesen, weil er selbst seine Kumpane übers Ohr haute, wo es nur ging.
Also war die einhellige Meinung der Beamten, dass konkurrenzierende Verbrecher ihn aus dem Weg geschafft hatten. Solche Leute liebten dramatische Mord-Rituale: Manche ihrer Opfer fand man, nackt, kastriert und ohne Kopf, an Laternenpfählen hängend, andere baumelten mit Taschen voll Ziegelsteinen unter einer der ehrwürdigen Brücken Londons. Sogar Tote, die statt der abgeschnittenen Zunge einen Fisch im Mund hatten, waren ihnen schon untergekommen.
Sie ließen den Leichnam von den Handlangern der rechtsmedizinischen Abteilung im Home Office zusammenpacken, und nach kurzer Beschau wurde er, da er keine Angehörigen hatte, auf Staatskosten einem Bestatter übergeben.
Der wünschte nachher, er hätte den Auftrag nicht angenommen.
Es war ein kleines, ziemlich unbedeutendes Bestattungsunternehmen, das häufig solche – schlecht bezahlten – Aufträge von der öffentlichen Hand bekam, und der Inhaber war froh, dass er für diesen Leichnam nicht viel an der Ausstattung für den Sarg und das Begräbnis aufwenden musste. So blieb mehr in seiner eigenen Kasse.
»Interessiert doch niemand, Ernie«, sagte Mr. Gowlings zu seinem Gehilfen, während er den Leichnam – der immer noch aus drei Teilen bestand – nackt in einen rohen Holzsarg legte. »Jeder ist froh, dass der Kerl weg ist, so sagte es mir jedenfalls der Polizeiinspektor, also wird niemand verlangen, ihm ein letztes Küsschen geben zu dürfen. Schraub den Sarg zu, stell ihn in den Kühlraum, und morgen früh ab die Post! Ich hab schon alles wegen eines Armengrabes arrangiert. Um 7 Uhr kommt das Fuhrwerk vom Kensal Green Cemetery.«
»Ist gut, Chef«, antwortete Ernie, wobei er eine Wolke von Alkoholdunst hervorrülpste.
Seine Hand zitterte, als er den Schraubenzieher ansetzte, und er brauchte mehrere Versuche, ehe es ihm gelang, den Deckel festzuschrauben. Mit Hilfe seines Chefs hob er ihn auf einen Karren, beförderte ihn in den Kühlraum und schloss die Tür hinter sich.
Der Tote blieb allein in einem trostlosen Gewölbe, mit rohen Steinplatten gepflastert, das mehr einer Waschküche glich als einem Raum zur Vorbereitung auf die ewige Ruhe. Hölzerne Zuber und emaillierte Waschschüsseln standen herum, Laken hingen zum Trocknen an einer quer durch den Raum gespannten Wäscheleine. Es gab eine Wasserpumpe, die Wasser unmittelbar in eine Art Badewanne laufen ließ, und eine Kiste mit Kleidern, von denen Mr. Gowlings zu sagen pflegte, Tote brauchten keine große Garderobe, also konnte man die Kleider ruhig an einen Trödler verkaufen.
»Erledigt«, verkündete Ernie.
Chuck Waverly sah das anders. Stunden vergingen, in denen der Holzsarg still und stumm auf dem Boden stand. Finsternis herrschte in dem unter der Erde gelegenen Raum, der statt Fenstern nur schmale Luken unmittelbar unter der Decke aufwies. Niemand im Haus war noch wach. Da regte sich etwas im Sarg, ein dumpfes Glucksen und Blubbern wurde hörbar.
Schwaches, grünliches Licht wie das Schimmern von faulem Holz umgab, aus dem Inneren dringend, die rohe Kiste. Das Blubbern wurde lauter, es hörte sich jetzt an, als sei der Sarg bis zum Deckel mit einer unruhig brodelnden Masse gefüllt, die herauswollte. Dann gelang ihr das auch.
Obwohl der Deckel festgeschraubt war, sickerte eine übel riechende Flüssigkeit durch den winzigen Spalt. Sie rann langsam an den Seiten herab, wie Wachs an einer Kerze herabtropft, und sie bildete auch wachs-ähnliche Pfützen, die bei der Berührung mit dem kalten Boden erstarrten.
Immer mehr und mehr davon rann aus dem Sarg, als würde es von innen herausgepresst, bis sich die halb flüssige, halb feste Pfütze über den Großteil des Bodens erstreckte. Dann verstummte das Blubbern.
Die wachs-ähnliche Substanz zog sich langsam zusammen, wurde erst zu einem Höcker, dann zu einem Ball, schließlich zu einer plumpen, halb geformten Gestalt wie ein Schneemann.
†
Als die Totengräber von Kensal Green den Sarg am nächsten Morgen abholten, erschien er ihnen erstaunlich leicht. »Was is′n da los, Ernie?«, scherzte einer. »Hast in deinem Suff eine Maus eingesargt? Das Ding ist so leicht, ich wette, da ist nichts drin.«
»Hau ab mit deinen Scherzen«, grollte Ernie, der zu so früher Stunde immer an Entzugserscheinungen litt und entsprechend schlecht gelaunt war. »Da liegt einer drin, der ist so fett wie ein Walfisch, ich hab mir fast die Schulter ausgerenkt, als ich ihn im Sarg auf den Karren hob.«
»Was heißt hier Scherze?«, fragte der andere. Dabei ergriff er den Sarg mit beiden Händen an einem Ende und hob ihn mühelos hoch. »Das soll ein Walfisch drin sein? Höchstens ein rosa Elefant, du Schnapsnase!«
Ernie sah dem Schauspiel ungläubig zu. Plötzlich war er ganz nüchtern. »Stell das wieder hin«, befahl er. Dann machte er sich mit dem Schraubenzieher ans Werk, und diesmal zitterten seine Hände nicht vom Alkohol, sondern vor Schrecken. Als er dann den Deckel abhob, wurde er kalkbleich. »Gestern war da noch einer drin!«, stammelte er. »Mister Gowlings kann es beweisen, er war da … wir haben zusammen …«
»Du hast den Toten nicht vielleicht an die Anatomie verkauft?«, fragte einer der Angestellten von Kensal Green, jetzt in deutlich schlechterer Laune. »Bringt ein bisschen Taschengeld, sowas, hm? Bringt aber auch′n Strick um den Hals.«
»Idiot!«, stotterte Bernie. »Wenn ich ihn verkauft hätte, dann hätt′ ich doch den Sarg mit Steinen gefüllt, damit keiner was merkt … ich meine, ich würde so was doch überhaupt nie tun!«
An diesem Punkt kam Mr. Gowlings dazu, der ebenso fassungslos in den leeren Sarg starrte, und nach vielen gegenseitigen Beschuldigungen und Drohungen wurden die Männer von Kensal Green bestochen – wofür das ganze Geld des Home Office draufging –, Ernie mit Schimpf und Schande davongejagt und der Sarg für einen neuen Bewohner bereitgestellt.
Später wünschte Mr. Gowlings, er hätte Ernie auf der Stelle umgebracht, statt ihn fortzujagen, denn der Kerl ging prompt ins nächste Wirtshaus, soff dort auf Kredit und erzählte die ganze Geschichte.
Zu Mr. Gowlings Glück glaubte sie ihm niemand, aber sie machte als Gespenstermärchen in immer weiteren Kreisen die Runde.
†
Chuck Wackerly hatte zu den Leuten gehört, deren Tod kein großes Bedauern hervorrief. Umso interessanter war die Auktion seiner Schätze, wobei allerdings nur Zweitklassiges unter den Hammer kam.
Seine beiden engsten Mitarbeiter hatten, noch bevor sie die Polizei verständigten, die wichtigsten und gefährlichsten Objekte zur Seite geschafft, und Mr. Esteban, der Privatsekretär, telegrafierte Herrn Kalbacher, dem deutschen Kunstsammler, der seit Langem in London wohnte.
Kalbacher wusste genau, was er zu tun hatte. Esteban stand seit langem in seinem Sold, er hielt ihn auf dem Laufenden, was Wackerly so an Schätzen angeschleppt hatte, die er niemals in einem seiner Läden zur Schau stellen würde. Deshalb wusste er auch über das wahre Wesen des »Türkensäbels« Bescheid.
Jetzt hieß es schnell sein. Wenn die Polizei erst einmal verständigt war, würde man einen genauen Katalog erstellen, die Herkunft der einzelnen Stücke nachkontrollieren. Schließlich war man bei Scotland Yard auch nicht blöde, die Detektive wussten genau Bescheid über Wackerlys Doppelleben.
Der lange, dürre Mann, der Ähnlichkeit mit einer grauen Heuschrecke hatte, wäre am liebsten vor Freude auf und nieder gehüpft. Aber jetzt war keine Zeit für Gefühlsausbrüche. Sein Komplize würde das Katana für ihn beiseiteschaffen, ehe es einem Polizisten unter die Augen kam, gegen gutes Geld natürlich, dann konnte er es seiner eigenen Sammlung verbotener privater Schätze einverleiben.