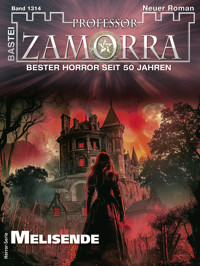1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
Als der Mann wie aus dem Nichts neben ihr auftauchte, zuckte Hannah erschrocken zusammen. Wo war der so plötzlich hergekommen?
Sie verlangsamte ihre Schritte und wartete darauf, dass er sie überholte, doch er passte sein Tempo dem ihren an und schritt in einem knappen Yard Entfernung neben ihr her. Hannah verstärkte den Griff um den Riemen ihrer Handtasche, bereit, sie von ihrer Schulter zu reißen und damit zuzuschlagen, sollte der Kerl ihr auch nur einen Zoll näherkommen. Die junge Frau war alles andere als ängstlich, doch um zwei Uhr morgens auf den leeren und nebeligen Straßen des Londoner Stadtteils Westminster mit einem Fremden neben sich wurde es auch ihr mulmig ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Gefangen in der Vampir-Welt
Vorschau
BASTEI LÜBBE AG
Vollständige eBook-Ausgabeder beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
© 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati / BLITZ-Verlag
eBook-Produktion:3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 9-783-7517-0813-5
www.bastei.de
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Gefangen inder Vampir-Welt
von Michael Schauer
Als der Mann wie aus dem Nichts neben ihr auftauchte, zuckte Hannah erschrocken zusammen. Wo war der so plötzlich hergekommen?
Sie verlangsamte ihre Schritte und wartete darauf, dass er sie überholte, doch er passte sein Tempo dem ihren an und schritt in einem knappen Yard Entfernung neben ihr her. Hannah verstärkte den Griff um den Riemen ihrer Handtasche, bereit, sie von ihrer Schulter zu reißen und damit zuzuschlagen, sollte der Kerl ihr auch nur einen Zoll näherkommen. Die junge Frau war alles andere als ängstlich, doch um zwei Uhr morgens auf den leeren und nebeligen Straßen des Londoner Stadtteils Westminster mit einem Fremden neben sich wurde es auch ihr mulmig ...
Nachdem sie einige Yards nebeneinander hergegangen waren, wurde es Hannah zu bunt. Unter einer Straßenlaterne blieb sie stehen.
Der Mann stoppte ebenfalls.
»Was zum Teufel ist los mit Ihnen?«, fuhr Hannah ihn an. Das Herz schlug ihr vor Aufregung bis zum Hals, aber sie war entschlossen, es sich nicht anmerken zu lassen. Ein selbstbewusstes Auftreten war eine gute Waffe, wenn es darum ging, Idioten abzuwehren.
Jetzt wandte sich der Fremde ihr zu.
Beinahe wäre Hannah ein zweites Mal zusammengezuckt, denn er bot einen schaurigen Anblick. Er war bestimmt zwei sieben Fuß groß. Über dem hageren Körper trug er einen schwarzen, alt und schäbig wirkenden Anzug, unter dem Jackett ein schmutzig-weißes Hemd.
Wie ein Totengräber aus einem alten Western-Streifen, dachte Hannah. Seine von grauen Strähnen durchzogenen schwarzen Haare waren zerzaust und standen in alle Richtungen ab. Das Gesicht war schmal, mit scharf geschnittenen Zügen, und wirkte im Licht der Laterne eigentümlich blass. Als sie in seine Augen blickte, lief ihr eine Gänsehaut über den Rücken. Die dunklen Pupillen wirkten leblos und strahlten eine durchdringende Kälte aus.
Jetzt öffnete der Mann langsam den Mund – und Hannah fühlte sich plötzlich in einem Albtraum versetzt. Zwischen den dünnen, blassen Lippen kamen zwei Eckzähne zum Vorschein, die mindestens doppelt so lang waren als gewöhnlich. Wie das Gebiss eines Raubtiers. Als Hannah unwillkürlich einen Schritt zurückwich, legte sich ein boshaftes Lächeln auf die Züge des Unheimlichen.
Lauf weg, rief ihr eine innere Stimme zu, doch ihre Beine gehorchten ihr nicht. Wie angewurzelt stand sie da und rührte sich auch dann nicht, als der Mann langsam dicht an sie herantrat, mit einer bedächtigen Bewegung ihren Kopf zwischen seine Hände nahm und diesen etwas zur Seite drehte. Sie registrierte, dass seine Finger eiskalt waren. Er beugte sich zu ihr herunter.
Erst spürte sie seine kühlen Lippen, dann etwas Hartes, Spitzes. Der Schmerz, als die Eckzähne in ihre Haut eindrangen, war kurz und heftig. Hannah bekam noch mit, dass der Mann an ihrem Hals saugte, bevor es schwarz um sie wurde.
†
Lucas Flex presste den Kolben des SA80 Maschinengewehrs fest gegen die Schulter und feuerte. Die Garbe holte einen über sechs Fuß großen Taliban mit einem mächtigen schwarzen Bart und einem fleckigen Turban von den Beinen.
Dessen Kamerad, mindestens zwei Köpfe kleiner, gekleidet in ein weißes Gewand und mit einem graugemusterten Turban auf dem Kopf, sprang hinter eine Mauer in Deckung. Die Kugeln aus Flex' nächster Garbe schlugen in die Mauer ein und stanzten einige Löcher hinein, konnten Stein und Mörtel aber nicht durchdringen.
Hinter ihm krachten Schüsse. Ein dritter Taliban wurde von der Wucht der Treffer in seine Brust auf den Rücken geschleudert.
»Hab dich, Drecksack!«
Das war Sam Mannings. Sein Kamerad hockte hinter ihm in dem LMV, einem Transportfahrzeug der britischen Armee. Mannings, er und Floyd Brent waren auf einer Patrouillenfahrt durch die Straßen Kabuls unterwegs gewesen, als sie von einer Gruppe der mit Kalaschnikows bewaffneten Gotteskrieger angegriffen wurden. Brent hatte am Steuer gesessen. Eine Gewehrsalve durch das geöffnete Fahrerfenster hatte ihn tödlich getroffen.
Verdammt, dachte Flex, warum hatte er Brent nicht befohlen, während der Fahrt das Fenster zu schließen? Er war immerhin Lieutenant und damit der ranghöchste Soldat bei diesem Trip.
Als Brent hinter dem Lenkrad blutüberströmt zusammengesackt war, war der LMV ausgeschert und gegen eine Hauswand gedonnert. Flex und Mannings waren zum Glück angeschnallt gewesen. Flex, der auf der Beifahrerseite gesessen hatte, hatte sofort die Tür aufgerissen, sich aus dem Fahrzeug fallen gelassen und das Feuer eröffnet. Mannings auf dem Rücksitz hatte die Tür nicht aufbekommen, durch den Unfall war vermutlich irgendetwas am Mechanismus verklemmt. Also hatte er die Scheibe heruntergelassen und aus dem offenen Fenster geschossen.
Fünf Angreifer waren es gewesen. Drei hatten sie jetzt erwischt. Einer war gleich am Anfang getürmt, der Letzte verschanzte sich nun hinter dieser Mauer, die irgendwann Teil eines Wohnhauses gewesen sein musste. Nur eine Ruine war davon übrig geblieben, vermutlich war das Gebäude von einer Rakete getroffen worden.
»Hast du gesehen? Der Mistkerl hockt hinter der Mauer«, rief Flex über die Schulter, dann wandte er sich wieder seinem potenziellen Ziel zu.
Von dem Taliban war nichts zu entdecken. Hatte er etwa auch das Weite gesucht? Nein, unmöglich. Die Mauer war nur etwa sechs Fuß breit, wenn der Typ weggelaufen wäre, hätte Flex das auf jeden Fall mitbekommen.
»Hab's mitgekriegt«, bestätigte Mannings und gab auf gut Glück einen Schuss ab. Die Kugel pfiff über die Mauerkrone und schlug irgendwo in der Ruine dahinter ein.
Während er den Finger der rechten Hand am Abzug hielt, wischte Flex sich mit der Linken den Schweiß von der Stirn. Der Tag war so heiß wie jeder andere in diesem Land, die Sonne brannte vom wolkenlos blauen Himmel gnadenlos auf ihn hinab. Unter der sandfarbenen Tarnuniform schwitzte er wie verrückt, der MK6-Helm schien Tonnen zu wiegen. Flex lag auf dem Bauch, die Mündung des Maschinengewehrs auf die Mauer gerichtet. Der heiße Sand unter ihm machte die Situation nicht angenehmer.
Der Kampf hatte bis jetzt keine zwei Minuten gedauert. Es war alles so schnell gegangen, dass sie noch nicht einmal Meldung machen und Verstärkung anfordern konnten.
Zeig dich, verflucht.
Flex widerstand der Versuchung, einfach zu feuern, nur um das angespannte Nichtstun zu beenden. Es wäre reine Munitionsverschwendung gewesen.
Schüsse krachten von links, direkt vor ihm schlugen Kugeln im Boden ein, kleine Sandfontänen stiegen empor. Ohne darüber nachzudenken, riss er das SA80 in die Richtung und drückte ab. Er war so gut gedrillt, dass er das Ziel nicht unbedingt sehen musste, um zu treffen.
Ein Mann lag etwa zwanzig Yards entfernt im Sand. Das war der Taliban, der vor kaum zwei Minuten getürmt war, Flex erkannte ihn an der auffälligen roten Weste. Offenbar war ihm eingefallen, dass es bei seinen Kameraden nicht gut ankam, wenn er einfach abhaute. Jetzt rührte der Mann sich nicht mehr, die Kalaschnikow hielt er noch in den Händen. Wo immer Flex ihn getroffen hatte, die Kugeln waren tödlich gewesen.
Aus dem Augenwinkel nahm er von rechts eine Bewegung wahr. Er schwenkte das Maschinengewehr wieder herum und feuerte sofort die nächste Salve ab, aber diesmal verfehlte er sein Ziel. Der Kerl mit dem grauen Turban hatte sich nur kurz hinter der Mauer vorgewagt und sich sofort wieder zurückgezogen.
Flex fluchte. Die Aktion hatte ihn die letzten Patronen gekostet, er musste nachladen. Die Tasche, in denen er die Reservemagazine aufbewahrte, war vor seiner Brust an der kugelsicheren Weste befestigt. Er stützte sich auf dem linken Arm auf und tastete nach dem Verschluss.
Der Taliban tauchte plötzlich auf der anderen Seite der Mauer auf. Und er hatte einen Raketenwerfer über der Schulter!
Er muss ihn die ganze Zeit dort versteckt haben, schoss es Flex durch den Kopf.
»Mannings, aufpassen, Raketenwerfer!«, brüllte er.
Er hörte das Maschinengewehrfeuer hinter sich, aber Mannings, eigentlich ein sicherer Schütze, schoss tatsächlich vorbei. Offenbar hatte er beim Anblick der schrecklichen Waffe die Nerven verloren.
Flex nestelte hektisch an der Magazintasche, bekam sie aber einfach nicht auf. Scheiß drauf, dachte er, ließ das SA80 los und griff nach der Glock, die an seiner rechten Hüfte im Halfter steckte. Mannings feuerte noch einmal, traf den Taliban aber wieder nicht. Flex riss die Pistole hoch.
Zu spät.
Der Mann hatte den Auslöser betätigt. Mit einem ohrenbetäubenden Pfeifen löste sich die Rakete aus der Abschussvorrichtung und raste direkt auf den LMV zu. In der nächsten Sekunde wurde Flex von einer gewaltigen Explosion erfasst. Der Boden unter ihm schien zu beben, eine Welle brennender Hitze raste über ihn hinweg, und er hatte das Gefühl, dass die Sohlen seiner Stiefel zu schmelzen begannen. In seinen Ohren klingelte es, alle Geräusche um ihn herum schienen verstummt zu sein.
Er sah den Taliban, das Gesicht zu einer triumphierenden Fratze verzerrt. Ohne darüber nachzudenken, richtete Flex die Pistole auf ihn und schoss. Der Mann brach zusammen, der Raketenwerfer glitt ihm aus den Händen.
Flex rollte sich auf den Rücken. Das Innere des LMV brannte lichterloh, die Rakete musste durch das geöffnete Fenster eingeschlagen sein. Er konnte ihn zwar nicht sehen, aber ihm war klar, dass Mannings tot war.
Durch seine Schuld. Er hatte sich von diesem verfluchten Terroristen zum Narren halten lassen.
Flex öffnete den Mund und schrie vor Wut, Schmerz und Verzweiflung. Durch das Klingeln konnte er seine Schreie nicht hören, aber er konnte auch nicht mehr damit aufhören.
†
Seine eigenen Schreie hatten ihn aus dem Schlaf gerissen.
Lucas Flex saß aufrecht in seinem Bett. Sein T-Shirt klebte ihm schweißnass am Körper, er fühlte seine feuchten Haare an der Stirn. Genau wie damals unter der heißen Wüstensonne in Kabul. Nur dass die Temperaturen in diesem November in London wie immer kühl waren. Es war der Albtraum, der ihn so schwitzen ließ. Der immergleiche Albtraum, der alle paar Nächte wiederkehrte.
Von draußen warf der Vollmond sein fahles Licht in das kleine Schlafzimmer, dessen Einrichtung sich mit einem Bett und einem alten Kleiderschrank auf das Nötigste beschränkte. Flex stand auf und ging zum Fenster. Drei Stockwerke unter ihm lag die Straße, die tagsüber von Lärm und Hektik zahlloser Autos und Menschen erfüllt war, ruhig und friedlich da. Nebelschwaden wehten im Mondlicht wie gespenstische Schlieren durch die Dunkelheit.
Flex wandte den Kopf und sah auf den Radiowecker, der auf dem Boden neben dem Bett stand. Die grellroten Ziffern zeigten 1.37 Uhr. Er hatte den Abend damit verbracht, in diesem kleinen Pub keine zweihundert Yards von seiner Wohnung entfernt abwechselnd in sein Bierglas zu starren und es zu leeren, worauf ihm Barney, der Wirt, so lange unaufgefordert ein gefülltes Glas gereicht, bis Flex irgendwann abgewinkt hatte.
Dieses kleine Ritual hatten sie an den vielen Abenden, die er in letzter Zeit dort am Tresen hockte, perfektioniert. Er zählte die Biere inzwischen nicht mehr, und eigentlich wollte er auch gar nicht wissen, wie oft Barney nachzapfte. Irgendwann war immer der Punkt erreicht, an dem er genug hatte, bezahlte und ging.
Wenn er sich recht erinnerte, war er gegen elf Uhr ins Bett gefallen und sofort in das inzwischen ziemlich ungemütlich gewordene Reich der Träume abgetaucht. Also hatte er nur etwa zweieinhalb Stunden geschlafen. So wie seine regelmäßigen Abende im Pub war auch das inzwischen zur Routine geworden, der Albtraum schreckte ihn stets zuverlässig gegen halb zwei aus dem Schlaf. Und wie immer würde er auch heute so schnell nicht wieder einschlafen können.
Flex drehte sich um und tappte durch die dunkle Wohnung ins Badezimmer. Er betätigte den Lichtschalter. Die Deckenlampe funktionierte seit einiger Zeit nicht mehr, vermutlich musste er nur die Glühbirne wechseln, wozu er sich aber nicht aufraffen konnte. Aber die in dem kleinen Badschrank verbaute Lampe spendete für seine Bedürfnisse genügend Licht.
Aus den auf den Schranktüren aufgebrachten Spiegeln blickte ihm das blasse Gesicht eines Mannes Anfang dreißig mit zerrauften blonden Haaren entgegen. Flex hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Schauspieler Daniel Craig, und Freunde zogen ihn gerne damit auf, dass er wohl der jüngere Bruder von James Bond sei.
Jedenfalls war das vor Kabul so gewesen.
Jetzt hatten sich tiefe Furchen in sein Gesicht gegraben, seine hellblauen Augen wirkten müde und gequält. Es war nicht zu übersehen, dass das Leben heftige Spuren an ihm hinterlassen hatte.
Er zog sich das vor Schweiß klamme T-Shirt über den Kopf und musterte seinen Oberkörper. Noch hatte er die Muskulatur eines durchtrainierten Ex-Soldaten, aber es war nicht zu übersehen, dass seine Bauchmuskeln allmählich einer dicker werdenden Fettschicht das Feld überließen. Das viele Bier machte sich bemerkbar. Wenn er nicht so wenig essen würde, wäre es wahrscheinlich schon schlimmer.
Mit solchen Problemen hatte James Bond sicher nicht zu kämpfen.
Er drehte den Wasserhahn auf, ließ das kühle Nass auf seine Handflächen laufen und spritzte es sich ins Gesicht. Das tat gut.
Du bist schuld an Mannings' Tod.
Flex schüttelte heftig den Kopf, als könne er den Gedanken damit vertreiben.
Sein Verstand – ebenso wie seine Freunde, seine ehemaligen Kameraden und der Psychologe, mit dem er so viel Zeit verbracht hatte, ohne dass sich wirklich etwas zum Besseren verändert hätte – sagte ihm, dass ihn natürlich keine Schuld traf. Er war es schließlich nicht gewesen, der die Rakete in den LMV abgefeuert hatte. Aber sein Gefühl sprach eine ganz andere Sprache. Hätte er den Taliban getroffen, als der sich kurz hinter der Mauer hervorgewagt hatte. Hätte er das Magazin rechtzeitig gewechselt. Hätte er nicht so viel Zeit verplempert mit dem Versuch, das Gewehr nachzuladen, sondern gleich die Pistole gezogen ...
Verflucht, Mannings hatte eine Frau und drei Kinder hinterlassen.
Flex spritzte sich noch etwas Wasser ins Gesicht. Sein Blick fiel auf das kleine Schwarzweißfoto, das er auf der rechten der drei Schranktüren mit einem Klebestreifen befestigt hatte. Es zeigte eine Frau Ende zwanzig mit nackenlangen, gelockten schwarzen Haaren. Sommersprossen umspielten ihre kleine Stupsnase, die Lippen waren voll, die Augen groß, und obwohl es auf einem Schwarzweißfoto natürlich nicht zu sehen war, wusste er, dass sie in einem tiefen Grün schimmerten.
Die Frau war Lucy Sheavers, seine Ex-Freundin und wie er Ex-Angehörige der britischen Armee. Lucy war nicht in Afghanistan gewesen, doch sie hatte sich alle Mühe gegeben, ihn zu verstehen und ihm zu helfen, als er vor acht Monaten nach diesem schrecklichen Ereignis zurückgekehrt war. Aber irgendwann waren ihre Geduld und ihre Nerven am Ende gewesen.
Lucy hatte nach seiner Rückkehr aus Afghanistan ein halbes Jahr um ihn gekämpft, dann war es ihr zu viel geworden. Knapp neun Wochen war das jetzt her.
Er konnte es ihr nicht verübeln. Seit seiner Rückkehr war er oft mürrisch und gereizt. Menschenansammlungen machten ihn nervös und vermittelten ihm ein Gefühl latenter Bedrohung, was in einer Stadt wie London ein echtes Problem darstellte. Also blieb er lieber daheim, von seinen Besuchen im Pub einmal abgesehen.
Die Albträume hatten ihn nach einem Monat so zermürbt, dass er immer öfter zum Bierglas gegriffen hatte. Irgendwann hatte er mit Barney mehr Zeit verbracht als mit Lucy, was ihr noch weniger gefallen hatte als alles andere. Als er eines Abends wieder einmal angetrunken nach Hause gekommen war, war sie verschwunden. Der Brief, den sie ihm zum Abschied hinterlassen hatte, war kurz. Inzwischen konnte er ihn fast auswendig, so oft hatte er ihn gelesen.
Er hatte keine Ahnung, wo sie jetzt wohnte. Sie schrieben sich hin und wieder Nachrichten über WhatsApp. Während dieser irgendwie deprimierenden Unterhaltungen spürte er zwar, dass er ihr noch nicht gleichgültig war, aber sie machte ihm keine Hoffnungen. Die Tür war zugefallen, und nichts und niemand konnte sie wieder öffnen.
Ein Kloß bildete sich in Flex' Kehle, und seine Augen wurden feucht. Immer, wenn er nüchtern war, vermisste er sie wie verrückt. Was wiederum ein Anlass war, sich die Jacke überzuwerfen und zu seinem guten alten Freund Barney zu eilen, der nie dumme Fragen stellte und ihm immer mit einem Lächeln das nächste Bier zapfte.
Jetzt war es natürlich zu spät, der Pub hatte längst geschlossen. Trotzdem musste er an die frische Luft. Wenn niemand anderes unterwegs war, war es für ihn eh die beste Zeit für einen Spaziergang.
Er zog seine Shorts aus und ließ sie einfach auf dem Badezimmerboden liegen. Dann tappte er durch die dunkle Wohnung zurück ins Schlafzimmer, knipste das Licht an und öffnete seinen Kleiderschrank. Als Lucy noch bei ihm gewohnt hatte, war der beinahe bis zum Platzen gefüllt gewesen, jetzt nur noch zu etwa einem Drittel. Flex schnappte sich eine Jeans, ein Shirt und einen schwarzen Pullover und schlüpfte in alles hinein. Dann zog er sich ein paar dicke Socken und schwarze Halbstiefel über. Nachdem er seine braune, gefütterte Lieblings-Lederjacke übergestreift hatte, war er startklar.
Noch nicht ganz.
Er zog das Fach mit den dünnen Sommersocken auf und griff unter den Stapel. Seine Finger ertasteten die Glock. Er zog die Pistole hervor und steckte sie sich hinten in den Hosenbund. In England durfte er nicht mit einer scharfen Schusswaffe auf der Straße unterwegs sein, aber das war ihm egal. Sie verlieh ihm ein Gefühl der Sicherheit, und deshalb führte er sie außer bei seinen Spritztouren zu Barney immer bei sich.
Eine Minute später stand Lucas Flex auf der Straße und sog die kühle Luft ein. Beim Ausatmen kondensierte sein Atem zu kleinen Dampfwölkchen. Er schätzte, dass es nur wenige Grad über Null waren. Der Nebel war ein wenig dichter geworden, und er konnte kaum weiter als zwanzig Yards sehen. Die Hände in den Jackentaschen vergraben, machte er sich auf den Weg.