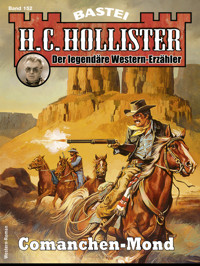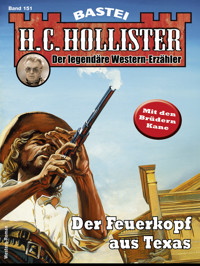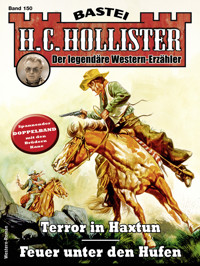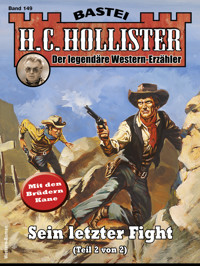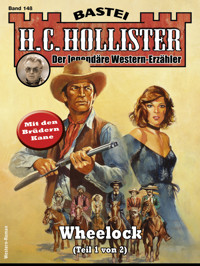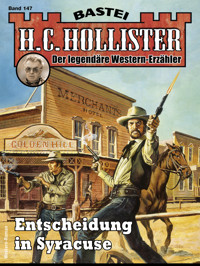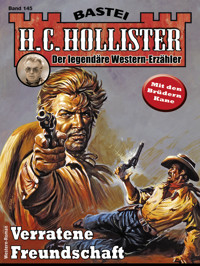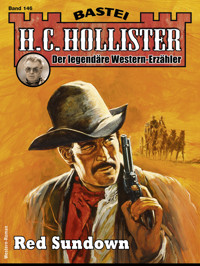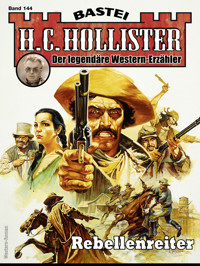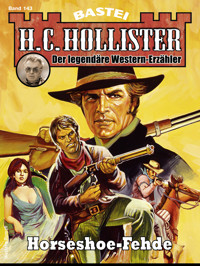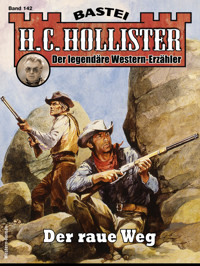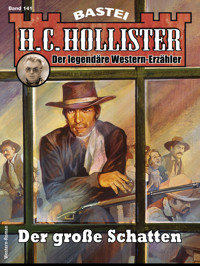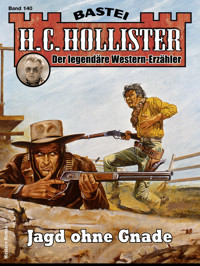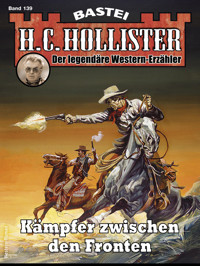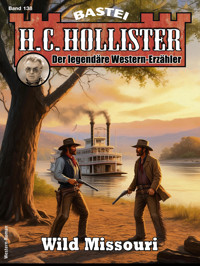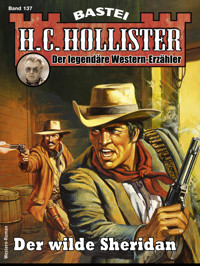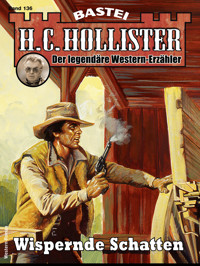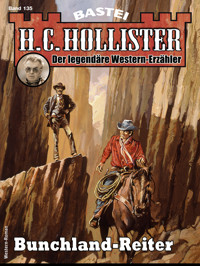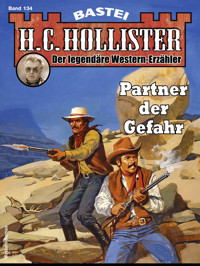1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie trieben ihre Longhorns mehr als achthundert Meilen nach Norden und sollten dann - kurz vor dem Ziel - um den Lohn ihrer Mühen betrogen werden. Dunkelmänner waren am Werk. Jedes Mittel war ihnen recht, um die Parry-Mannschaft zu vernichten. Sie versetzten die Riesenherde in eine Stampede, sie arbeiteten mit Mord und Totschlag. Aber ein Texaner ergibt sich nicht widerstandslos in sein Schicksal! Die Parrys nehmen den Kampf auf, den Kampf um eine freie Weide.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
REITER IM ZWIELICHT
Vorschau
Impressum
REITER IM ZWIELICHT
Sie trieben ihre Longhorns mehr als achthundert Meilen nach Norden und sollten dann – kurz vor dem Ziel – um den Lohn ihrer Mühen betrogen werden.
Dunkelmänner waren am Werk. Jedes Mittel war ihnen recht, um die Parry-Mannschaft zu vernichten. Sie versetzten die Riesenherde in eine Stampede, sie arbeiteten mit Mord und Totschlag. Aber ein Texaner ergibt sich nicht widerstandslos in sein Schicksal! Die Parrys nehmen den Kampf auf, den Kampf um eine freie Weide.
Im Jahr 1876 fegte das War Department, das Kriegsministerium der Vereinigten Staaten, die Laramie-Verträge mit den Dakota-Stämmen der Sieben Ratsfeuer vom Tisch und begann einen Feldzug gegen die Sioux und Cheyennes. Man unterschätzte dabei den Gegner, der seine Gefährlichkeit schon oft bewiesen hatte. Die Zeche zahlte der »Boy-General« Custer mit seinem Kavallerieregiment am Little Bighorn. Die Truppe – 277 Reiter – wurde von den Dakotas unter Sitting Bull in einem entsetzlichen Gemetzel bis auf den letzten Mann niedergemacht.
Die Legende berichtet, dass der große Hunkpapa-Medizinmann seinem verhassten Feind »Gelbhaar« Custer eigenhändig das Herz aus der Brust riss. Das berühmteste Ereignis der Indianerkriege ist unter der Bezeichnung »Custer's Last Stand« – Custers letzter Kampf – in die Geschichte eingegangen. Dieser bedeutendste Sieg der Dakotas war für sie zugleich der Anfang vom Ende. Sie wurden in einer Reihe von Gefechten geschlagen und aufgerieben. Ein großer Teil von ihnen ergab sich und wurde in Reservationen gepfercht. Sitting Bull und einige Dutzend seiner Getreuen entkamen in das »Land der Großmutter«, also über die Grenze nach Kanada.
Diese Begebenheiten sind schon viele Male in historischen Darstellungen oder in Romanform geschildert worden. Ein Stoff ist dabei unbeachtet geblieben, der es wie kaum ein anderer verdient, der Nachwelt überliefert zu werden: der Trail der Parry-Herde aus den Llanos von Texas in das »neue Land im Norden« – und der Kampf einer Texaner-Mannschaft um die freie Weide.
Sie trieben ihre Longhorns mehr als achthundert Meilen und wurden dann, endlich am Ziel, um den Lohn ihrer Mühe betrogen. Aber sie hätten keine Texaner sein dürfen, wenn sie sich widerstandslos in ihr Schicksal ergeben hätten.
Dies ist die Geschichte von Jim Parry, den sie »Palomino-Jim« nannten ...
✰✰✰
Der Himmel über Lubbock hatte jene fahle, unwirkliche Bläue, die an die klirrende Kälte des Winters erinnerte und doch schon den Frühling ankündigte. Jason Parry trat aus dem Lonestar Inn, blinzelte gegen das grelle Licht und warf dann einen Blick auf seine große Taschenuhr.
»Eine Viertelstunde noch«, sagte er, und in seiner Stimme lag Grimm, der seine eiserne Selbstbeherrschung zu sprengen drohte. Mit eckigen Bewegungen streifte Parry seine Reithandschuhe über.
Neben ihm tauchte die hünenhafte Gestalt Dragos auf. Der Vormann der Star-P-Ranch hatte mexikanisches Blut in seinen Adern und war ein Ausbund an Hässlichkeit. Zwei schwere 45er Texas-Pattersons baumelten tief an seinen Schenkeln.
»Dafür möchte ich diesem Bastard mein Monogramm in die Haut schneiden«, sagte er kehlig. »Sie wollen uns demütigen – das ist es, nicht wahr?«
»Yeah«, gab der Rancher einsilbig zurück, und sein mageres Gesicht wurde noch kantiger. »Deshalb haben sie den Zeitpunkt der Entlassung schon Tage zuvor in alle Winde posaunt. Aber was daraus wird – das liegt bei uns, Drago!«
Der narbengesichtige Segundo zog ein starkes Green-River-Messer aus dem Gürtel und wetzte es an seinem Lederhemd. Anschließend brachte er einen Strang Tabak zum Vorschein, schnitt ein Stück davon ab und schob es hinter seine braunen Zähne.
»Ich will verdammt sein, wenn ich von diesen Schuften noch etwas hinnehme«, knirschte er. »Dem nächsten dieser P.C.S.-Desperados, der seine Zunge galoppieren lässt, werde ich kurzerhand ...«
»Genug, Drago!«, sagte der Rancher leise, und die zwei Worte ließen den Segundo augenblicklich verstummen. Jason Parry war fast einen halben Kopf kleiner als sein Vormann, aber es ging eine Autorität von ihm aus, die nicht von Äußerlichkeiten herrührte.
Der Vormann griff nach seinem Ohrläppchen und rieb es zwischen Daumen und Zeigefinger. Das Läppchen war der Länge nach gespalten, sodass es zwei langgezogene Zipfel bildete. Über diese Missbildung waren verschiedene Geschichten in Umlauf. Drago selbst hatte sich nie dazu geäußert. Für ihn waren solche Narben eine Nebensächlichkeit. Er hatte an seinem Körper weit schlimmere aufzuweisen, und auch in seinem Gesicht klaffte ein rotes Wundmal, das von seinem linken Wangenknochen quer über beide Lippen bis zur Kinnspitze verlief.
Der Segundo wurde dadurch derart entstellt, dass es manchen Leuten schwerfiel, ihn ohne Schauder anzublicken. Die Narbe rührte vom Skalpmesser eines Lipan-Apachen her. Jetzt, nachdem die Wunde längst verheilt war, hätte man nicht sagen können, ob der Zug von Grausamkeit dem Charakter jenes Mannes entsprang oder ob nur die Narbe und sein breiter, dünnlippiger Mund diesen Eindruck erweckten.
»Yeah, Patron«, erwiderte der Vormann respektvoll.
Seit mehr als sechs Wochen saß Jim Parry, der einzige Sohn des Ranchers, unter fadenscheinigem Vorwand im Gefängnis. Er war erst zwei Monate zuvor aus dem Osten zurückgekehrt. Die Verhältnisse in den Llanos hatten sich geändert, seit das P.C.S. hier eingedrungen war. Die mächtigen Burschen des Syndikats wussten nur zu gut, wie Jason Parry am besten unter Druck zu setzen war. Sie hatten seine schwache Stelle gesucht und gefunden – in seinem Sohn Jim.
»Da«, sagte der Rancher starr und ausdruckslos.
Drago nickte und rückte seinen riesigen Sombrero wieder zurecht. Auf der Straße, die zwischen Posthalterei und Gerichtsgebäude auf die Plaza mündete, erschien eine Reitertraube von mehr als einem Dutzend Männern. Man war in den Llanos weder nachtragend noch wählerisch, aber diese Burschen des Syndikats rechtfertigten die Bezeichnung »Desperados«, die Drago gebraucht hatte; sie gehörten zum Abschaum der Grenze.
Sie schwenkten nach links und lenkten die Pferde an den Holm des Saloons, der sich an die Posthalterei anschloss. Auch unter den kahlen Platanen und Cottonwoods auf der anderen Seite tauchten immer mehr Menschen auf. Der Zeitpunkt von Jim Parrys Entlassung stand unmittelbar bevor.
»Komm!«, verkündete der Rancher und setzte sich in Bewegung. Drago ging neben ihm her. Bei jedem seiner langen Schritte klatschten die Halfter mit den schweren Texas-Pattersons gegen seine Schenkel.
Drei wettergegerbte Burschen, die am Holm bei den Star-P-Pferden gewartet hatten, folgten ihnen mit verschlossenen Mienen. Keiner von ihnen hätte es jemals zugegeben, aber vor sich selbst gestanden sie es sich ein: Dieser Ritt nach Lubbock kam für die Star-P-Ranch einer Kapitulation gleich. Drüben im Gerichtshaus würde der formelle Akt vollzogen werden, mit dem Jason Parry seine Weide dem Syndikat überschrieb.
Sie hatten diese dürren Llanos mit all ihren Tücken, Staubstürmen, Präriebränden, Blizzards und blutdürstigen Rothäuten öfter als einmal verflucht. Aber der Mensch gewöhnt sich selbst an das Leben in der Hölle, und so war diese raue Parry-Weide ihnen zur Heimat geworden, deren Verlust sie hart traf.
Vielleicht hätten sie alles leichter hingenommen, wenn sie in offener Fehde verloren hätten. Das Syndikat jedoch hatte mit anderen Mitteln gearbeitet. Keith Sundance, der Manager des P.C.S., verstand sich auf die Methoden eines versteckten Kampfs. Er wusste Macht, finanzielle Möglichkeiten und politischen Einfluss der Gesellschafter an den richtigen Stellen zur Geltung zu bringen und seinen Handlungen das Mäntelchen einer fadenscheinigen Rechtmäßigkeit umzuhängen.
Es hieß, dass Keith Sundance ein heruntergekommener Winkeladvokat mit zweifelhafter Vergangenheit war, bevor er gewisse Leute kennenlernte, die seine Fähigkeiten dem Syndikat dienstbar machten. Die Männer, die mit finsteren Gesichtern hinter Jason Parry und dem Segundo schritten, hätten diese Dinge schwerlich in Worte kleiden können. Sie hegten nur einen dumpfen Groll, und ein Teil ihres Zorns richtete sich auch gegen Jim Parry, der jetzt im Gefängnis auf seine Entlassung wartete.
Dabei war er an dieser Entwicklung so unschuldig wie jeder andere Star-P-Reiter. Keith Sundance hatte den Sohn benutzt, um den Rancher zu erpressen. Natürlich geschah das nicht offen. Aber immerhin hatte Jim Parry – »Palomino-Jim«, wie sie ihn nannten – einen Revolverhelden des Syndikats niedergestreckt und einen anderen Mann angeschossen.
Wenn die richtigen Zeugen beizubringen waren, ließ sich daraus leicht eine Mordanklage herleiten. Niemand zweifelte daran, dass Keith Sundance eine Verurteilung durchgesetzt hätte. Da genügten also gewisse Andeutungen, um Jason Parry zum Nachgeben zu veranlassen.
Auf dem Gehsteig vor dem Gerichtshaus erschien die vierschrötige, schnauzbärtige Gestalt von Sheriff Jack Bayliss. Sein rotes Gesicht wirkte verlegen. Er wartete ab, bis der Rancher vor ihm stand, dann sagte er gedämpft:
»Sie dürfen nicht glauben, dass es mir Vergnügen bereitet, Parry. Aber ich habe ohne Ansehen der Person meine Pflicht zu tun, und solange die Anzeige gegen Ihren Jungen nicht zurückgezogen ist ...«
Jason Parry blickte ihn aus schmalen Augen an, wie man ein Reptil betrachten würde.
»Schon gut, Bayliss«, unterbrach er den Sheriff schroff. »Ich wusste von Anfang an, dass Sie sich in Ihrem Amt genauso von der Strömung treiben lassen würden, wie Sie es auch sonst getan haben.«
Die Miene des schnauzbärtigen Mannes erstarrte.
»Zum Teufel, Parry, sind Sie hergekommen, um mich zu beleidigen?«
Drago schob sich einen Schritt vor, hakte die schwieligen Daumen hinter seinen Gurt und grinste auf entnervende Art. Dann knurrte er:
»Wenn Sie sich durch die Wahrheit beleidigt fühlen, ist das Ihre Sache, Bayliss. Aber spielen Sie hier nur nicht den tragischen Helden, der mit Tränen in den Augen seine Pflicht tut! Wir erinnern uns noch deutlich, dass Sie als erster an das Syndikat verkauft haben und kurz darauf Ihren Posten erhielten. Eine Hand wäscht die andere, nicht wahr?«
Es sah so aus, als wolle Jack Bayliss aufbegehren, aber der Segundo starrte ihn so hart und herausfordernd an, dass der Widerstand des Sheriffs zerbrach.
»Was hätte ich denn tun sollen?«, murmelte er heiser und senkte hilflos den Kopf. »Ich wäre längst den Fluss hinuntergespült worden, wenn ich versucht hätte, gegen den Strom zu schwimmen.«
»Yeah«, sagte Jason Parry rau, »das ist allerdings richtig. Und Sie sind noch nie ein besonders guter Schwimmer gewesen, Bayliss. Lassen wir es also dabei bewenden ...«
Noch während er sprach, hatte er den Blick zur Seite gewandt, wo ein zweispänniger Buggy um die Ecke bog und jenseits des Holms zum Stehen kam. Auf dem Bock hielt ein großer, starkknochiger Mann die Leinen, dessen graue, buschige Brauen ein Paar unruhiger, tief in den Höhlen liegender Augen überschattete.
Neben ihm saß ein junges Mädchen mit schmalem, ernstem Gesicht und hielt einen Deckelkorb auf dem Schoß. Widerwillig griff sich Jason Parry an den Hut, und der Segundo folgte seinem Beispiel.
»Guten Tag, Cally!«, sagte der Rancher, wandte sich daraufhin an den Mann und setzte ausdruckslos hinzu: »Hallo, McCabe!«
Nathan McCabe war der Besitzer der Halliday-Ranch und Cally Hallidays Stiefvater. Er räusperte sich und erwiderte den freudlosen Gruß mit einem kurzen Nicken.
»Hören Sie, Jason«, erklang seine belegte Stimme, »im Zusammenhang mit dieser dummen Geschichte an den Lipan Sinks sind böse Worte gefallen. Ich kann verstehen, dass Sie auf mich nicht sonderlich gut zu sprechen sind, aber Sie müssen doch begreifen, dass ich das alles nicht voraussehen konnte, als ich die Sinks verkaufte. Ich stecke durch diesen Tiefstand der Rinderpreise nicht weniger in der Klemme als jeder andere Viehzüchter in Texas.«
Zunächst sah es so aus, als ob Jason Parry überhaupt nicht antworten wollte. Seine Lippen waren nur ein dünner Strich. Doch dann brach seine Erregung durch.
»Wir hatten einen Pachtvertrag über die Sinks, den wir jetzt schon seit vier Jahren stillschweigend verlängert haben, McCabe! Als Jim mit seiner Crew zu den Lipan Sinks hinausritt und dort diese verdammte Drahtmannschaft des Syndikats vorfand, musste er also glauben, dass die Burschen im Begriff waren, mehr als achthundert Star-P-Rinder widerrechtlich von unserer Weide abzuschneiden.
Das wäre nicht geschehen, wenn Sie mich rechtzeitig unterrichtet hätten, dass Sie den Pachtvertrag diesmal nicht verlängern wollten und die Lipan Sinks an das Syndikat verkauft hatten.«
Schuldbewusst beschäftigte sich Nathan McCabe mit den Leinen seines Gespanns.
»Ich weiß, Jason«, murmelte er betreten. »Natürlich wäre das der einzig richtige Weg gewesen. Aber wie konnte ich damit rechnen, dass Sie so früh die Vorbereitungen zum Round-up treffen würden? Ich hatte auch keine Ahnung, dass Keith Sundance sofort nach Abschluss des Kaufs seine Drahtmannschaft losschicken würde. Auf diese Weise kam das unglückselige Zusammentreffen erst zustande.
Um ehrlich zu sein – ich habe mich vor der Benachrichtigung gedrückt, weil ich Ihnen gegenüber ein schlechtes Gewissen hatte. Aber schließlich blieb mir keine andere Wahl. Jeder in diesem Jahr verkaufte Stier ist ein Verlustgeschäft. Man muss versuchen, flüssig zu bleiben, solange einem das Wasser noch nicht bis zum Hals steht.
Im Augenblick habe ich noch einen halbwegs annehmbaren Preis für die Lipan Sinks erzielt. Wenn ich in der Klemme säße, hätte mir Keith Sundance seine Bedingungen diktiert!«
Über Jason Parrys Nasenwurzel standen zwei steile Falten. Was er hier zu hören bekam, waren wortreiche Entschuldigungen und Ausflüchte, doch sie vermochten nichts mehr an der Lage ändern.
»Es – es tut uns sehr leid, Mr. Parry«, sagte das Mädchen stockend. »Ich bin sicher, Nathan hätte die Lipan Sinks nicht verkauft, wenn er auch nur die leiseste Ahnung gehabt hätte, was daraus für Sie entstehen würde.«
McCabe nickte eifrig zu dieser Beteuerung.
»Das stimmt, Jason. Der Himmel ist mein Zeuge, dass ich ...«
»Schon gut, McCabe«, fiel ihm Jason Parry ins Wort. »Jetzt ist ohnehin nichts mehr daran zu ändern. Gehen wir, Bayliss?«
Der Sheriff wandte sich ab und schritt auf den Eingang des Gerichtshauses zu. Jason Parry griff wieder an seinen Hut und folgte ihm. Der Segundo schloss sich ihnen an, während die drei lederhäutigen Star-P-Reiter an den Stufen des Gehsteigs zurückblieben.
Keith Sundance, der Manager des P.C.S., wartete bereits im Gerichtshaus. Er war groß, breitschultrig und strotzte vor Gesundheit. Wenn der leichte Bauchansatz nicht gewesen wäre, hätte man seine Gestalt durchaus als athletisch bezeichnen können. Mit seinem sorgfältig gestutzten roten Schnurrbart und seinen leicht hervorquellenden Augen hätte der Manager des Syndikats einen belustigenden Eindruck erweckt, aber diese farblosen Augen strahlten eine eiskalte Berechnung aus.
Jason Parry entging auch die Aufbauschung von Sundances brauner Cordjacke in der Gegend der linken Achselhöhle nicht. Der Mann, der neben ihm an einem Tisch saß und mit nervös zuckendem Gesicht Papiere und Schreibutensilien vor sich ausbreitete, war der Notar, der alle Geschäfte des P.C.S. zu beurkunden pflegte.
Ohne sich mit einem Gruß oder irgendwelchen Floskeln aufzuhalten, sagte der Manager geradezu:
»Wir haben alles vorbereitet, Parry. Es fehlt nur noch Ihre Unterschrift, dann kann ich Ihnen den Scheck aushändigen.«
»Yeah«, bestätigte Jason Parry kurz, während er das umfangreiche Schriftstück überflog, »und vor allem können Sie dann Bayliss Anweisungen geben, Jim aus seinem Käfig zu entlassen, nicht wahr? Das ist eine schmutzige Erpressung, Sundance!«
Die Mundwinkel des Managers zogen sich herab.
»Erpressung?«, murmelte er sarkastisch. »Niemand zwingt Sie dazu, diesen Vertrag zu unterschreiben, Parry. Falls Sie sich aber doch entschließen, wird sich das Syndikat für diese kleine Gefälligkeit revanchieren und auf eine Anklageerhebung gegen Ihren Sohn verzichten. Das Ganze ist ein Geschäft wie jedes andere. Und was den Sheriff betrifft, so ...«
»... tut er nur seine Pflicht«, fiel der Rancher bissig ein. »Ich weiß schon, Sundance!«
»Wir haben es inzwischen oft genug gehört«, setzte Drago grimmig hinzu und maß den Sheriff mit einem verachtungsvollen Seitenblick.
»Aber Gentlemen«, murmelte der Notar vorwurfsvoll. »Ich dachte, es ginge darum, ein Geschäft zum Abschluss zu bringen, dessen Einzelheiten längst geklärt sind. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen finde ich die Bedingungen durchaus fair.«
»Eben«, sagte Keith Sundance mit gekräuselten Lippen.
Der Segundo gab einen gereizten Laut von sich. Jason Parry aber studierte schweigend das Schriftstück, griff dann nach dem Federhalter und setzte stehend in harten, steilen Zügen seine Unterschrift unter das Dokument. Das Ende der Star-P-Ranch war besiegelt, soweit es die Llanos von Texas betraf.
Jack Bayliss stieß einen erleichterten Seufzer aus, erstarrte aber schuldbewusst, als der Manager ihn scharf und tadelnd ansah. Auch der Rancher wandte sich ihm zu.
»Also«, stieß er rau hervor, »worauf warten Sie noch, Bayliss? Dass sich vielleicht noch mehr Zuschauer einfinden oder dass die Pest aus Abilene ankommt?«
Der Sheriff schob den Unterkiefer vor, verzichtete jedoch auf eine Erwiderung und begab sich in sein Office, an das sich der Gefängnistrakt anschloss.
»Und hier ist Ihr Scheck, Sir«, sagte der Notar höflich. »Ich gratuliere zum erfolgreichen Abschluss!«
Vermutlich war das nichts weiter als die übliche Floskel, aber Drago schien sie als blanken Hohn zu empfinden und packte den Mann mit seinen behaarten, schwieligen Fäusten bei den Rockaufschlägen. Der ächzende Notar hing schon halb über dem Tisch, ehe Jason Parry eingreifen konnte und scharf befahl:
»Lass das, Drago! Wir gehen!«
Schnaubend ließ der Segundo sein Opfer fahren, das sich hastig vor seinen Pranken in Sicherheit brachte.
»Ihr Texaner«, sagte Keith Sundance und lächelte dünn. »Ihr nehmt alles viel zu ernst und zu persönlich ...«
Der Rancher verharrte reglos. Erst nach einer Weile öffnete er die Lippen und erwiderte schwerfällig:
»Vielleicht werden Sie es nie begreifen, Sundance, aber eines Tages wird man auch Ihnen die Rechnung für Ihre Lumpereien präsentieren, selbst wenn Sie sich noch so sehr hinter dem Gesetz und scheinheiliger Rechtmäßigkeit verschanzen. Solange Leute wie Sie das Heft in der Hand haben, ist in Texas kein Platz mehr für Texaner: Also – triumphieren Sie nicht zu früh!
Ich kenne die Sorte von mächtigen Burschen, die Ihnen Befehle erteilen. Ein Rinder-Imperium in den Llanos wird ihnen nicht genügen. Für einen so fähigen Mann wie Sie wird man bald neue Aufgaben finden – und ihn im Stich lassen, wenn er bei seiner schmutzigen Arbeit einen Schritt zu weit gegangen ist. – Nehmen Sie es als eine Prophezeiung, wenn Sie wollen.«
Nur mit den Fingerspitzen stützte sich Keith Sundance auf den Tisch und setzte ein fadenscheiniges Lächeln auf.
»Sie besitzen fünf- oder sechstausend Longhorns, Parry«, erwiderte er ironisch, »aber Sie denken noch immer wie ein lausiger Drei-Kühe-Rancher. Das Syndikat hingegen rechnet in Größenordnungen, die Sie sich nicht einmal vorstellen können. Solchen Männern gehört die Zukunft, Parry. Altmodische Texaner wie Sie sind eine aussterbende Rasse. Das ist meine Antwort ...«
»Und ich frage mich, warum du die Redensarten dieses Kerls überhaupt anhörst, Sir«, sagte eine beherrschte Stimme von der Tür her.