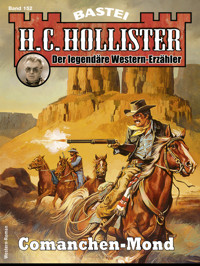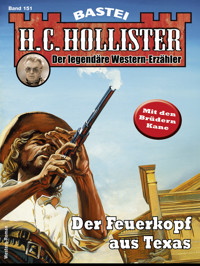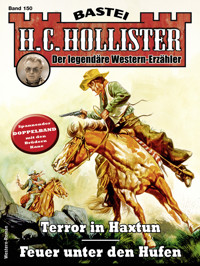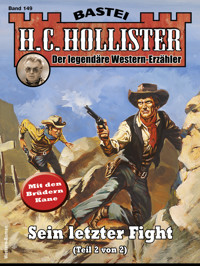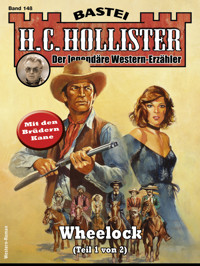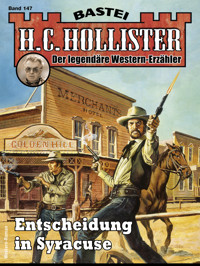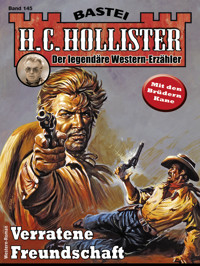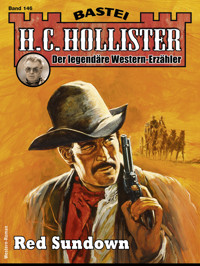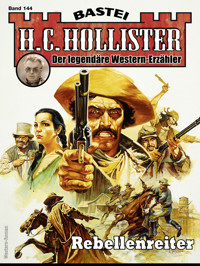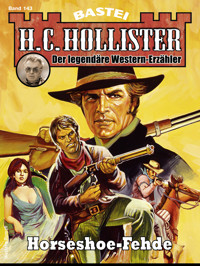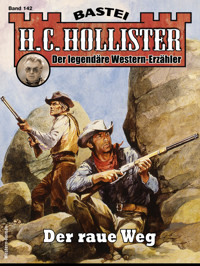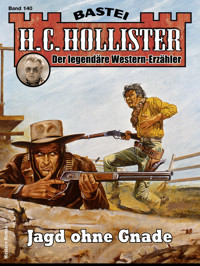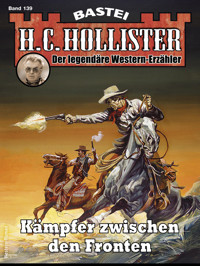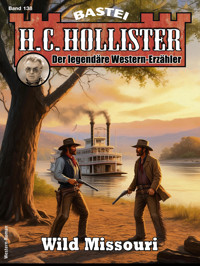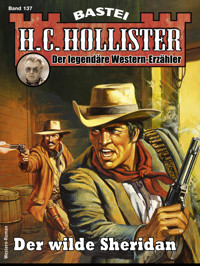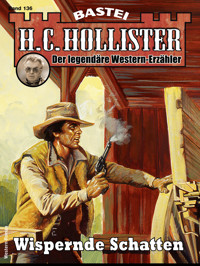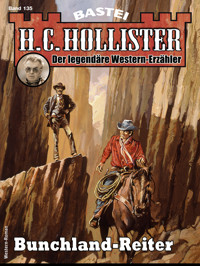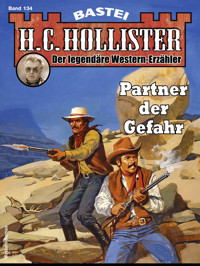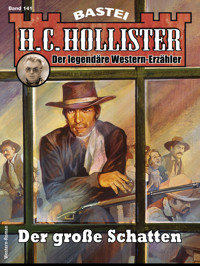
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie hatten ihn in der Falle. Es gab keine Cayusen in Campo Verde, es gab nur den Schatten. Der Mann, der aus der Cantina trat, war groß, hager und schwarzgekleidet - wie ein Schatten, den die Nacht vergessen hatte. "Zur Hölle, Shad, was hast du vor?", keuchte einer der Desperados. "Nicht!", kreischte Mahoney. "Bist du verrückt, Shad?" Der Mann lächelte dünn und erbarmungslos. Mit einer abgerissenen Bewegung lud er die Winchester durch. Dann peitschte der Schuss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
DER GROSSE SCHATTEN
Vorschau
Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen?
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsbeginn
Impressum
DER GROSSE SCHATTEN
Sie hatten ihn in der Falle. Es gab keine Cayusen in Campo Verde, es gab nur den Schatten. Der Mann, der aus der Cantina trat, war groß, hager und schwarzgekleidet – wie ein Schatten, den die Nacht vergessen hatte.
»Zur Hölle, Shad, was hast du vor?«, keuchte einer der Desperados. »Nicht!«, kreischte Mahoney. »Bist du verrückt, Shad?«
Der Mann lächelte dünn und erbarmungslos. Mit einer abgerissenen Bewegung lud er die Winchester durch. Dann peitschte der Schuss.
Für einen Saloonkeeper war Jesse Winslow trotz seines mürrischen Bullenbeißergesichts ein ausgesprochen gutmütiger Mann. Nur Fremden gegenüber war er argwöhnisch, und der Fremde, der jetzt an der Bar stand und Matt Morgan in ein Gespräch verwickelt hatte, gefiel ihm ganz und gar nicht. Der Mann, der sich Mahoney nannte, hatte dunkle, unstete Augen, eine gequetschte Falsettstimme und einen scharfen, berechnenden Zug um den Mund.
Draußen auf der Straße wurde Hufschlag laut. Mahoney wandte sich um und schaute durch die geöffnete Tür hinaus. Auf einem leichten Zweispänner fuhr ein großer, schlanker Mann vorüber und lenkte sein Gespann im Trab zum Mietstall. Neben ihm auf dem Bock stand eine braune Ledertasche, und in einem Halter daneben steckte eine abgesägte Schrotflinte.
»Alles in Ordnung«, seufzte Jesse Winslow und tauchte zwei Gläser in das Spülbecken. »Wir können Saul Pollack heute Abend zum Nachwuchs gratulieren. Wenn etwas schiefgegangen wäre, hätte Gentry seine Gäule im Schritt gehen lassen.«
Mahoney wandte den Kopf über die Schulter und blinzelte.
»He?«, fragte er verständnislos.
»Das war John Gentry, unser Doc«, erklärte Jesse Winslow. »Er ist zur Pollack-Ranch hinausgefahren, um Sauls Frau beizustehen. Seit gestern Abend war er weg.«
Er bemerkte Mahoneys immer noch fragendes Gesicht und setzte polternd hinzu: »Mein Gott, begreifen Sie denn immer noch nicht, Mister? Paulette erwartete ein Baby – ihr erstes!«
»So ist das also«, sagte Mahoney endlich.
»Yeah«, stöhnte der Saloonkeeper, »so ist das.« Dann wandte er sich zu Matt Morgan und fuhr fort: »Es ist wirklich jammerschade um den Doc.«
Matt Morgan hatte nur einen raschen Blick auf die Straße geworfen und sofort wieder weggeschaut.
»Schade? Wieso?«
Winslow lächelte trübsinnig.
»Er hat einen klangvollen Bariton, wie man ihn selten findet. Seit Monaten versuchen Cecil Corner und ich, ihn für unser Quartett zu gewinnen. Gerade jetzt proben wir ›Home on the Range‹, ein ganz wundervolles Lied. Aber die Stimme von Simon Fry ist einfach zu dünn. Er verpatzt den ganzen Eindruck. Yeah, wenn wir den Doc bloß herumkriegen könnten ... Aber er erfindet immer neue Ausreden. Dabei ist doch Cecil Corner schon fast sein Schwiegervater.«
»Ach so.« Irgendwie schien Matt Morgan erleichtert. »Sie reden von Ihrem Männerquartett.«
»Was haben Sie denn gedacht?«
»Ich weiß nicht«, gab Matt Morgan mit einem leichten Lächeln zurück. »Aber an Ihrer Stelle würde ich nicht so laut davon reden, dass die Stimme unseres ehrenwerten Hilfssheriffs zu dünn ist. Das hört Simon Fry bestimmt nicht gern.«
Der Saloonkeeper zwinkerte listig.
»Und wenn ich Sie wäre, Matt, dann würde ich mich gut mit Doc Gentry stellen. Sie sind jetzt seit einem Jahr verheiratet, und die Double-M-Pferderanch ernährt ihren Mann. Da sollte man meinen, auch Emily brauchte irgendwann dieselbe Hilfe wie heute Paulette Pollack.«
Dunkle Röte überflutete Matt Morgans Gesicht, als der Fremde neben ihm zu kichern begann.
»Hören Sie, Jesse«, murmelte er rau, »ist das nicht allein Emilys und meine Sache?«
Jesse Winslow zuckte mit den Achseln.
»Mein Gott, Matt, seien Sie doch nicht so empfindlich. Man wird doch noch einen kleinen Witz machen dürfen.«
»Schon gut, Jesse. Ich bin vielleicht ein bisschen gereizt.« Ohne eine Entgegnung abzuwarten, drehte sich Matt Morgan dem Fremden an seiner Seite zu.
»Und es sind wirkliche Cayusen, sagten Sie, Mahoney?«
Der Mann nickte eifrig.
»Darauf können Sie Gift nehmen, Mister. Beste indianische Zucht würde ich sogar behaupten. So etwas wie diese beiden Hengste werden Sie in ganz Texas nicht mehr finden. Und wenn Sie gleich bezahlen können, ließe sich noch über den Preis reden.«
Matt Morgans Interesse war geweckt.
»Wieviel?«, fragte er knapp.
Mahoney wiegte den Kopf.
»Zweihundert.«
»Hundertfünfzig«, entgegnete Matt Morgan. »Wenn sie wirklich so gut sind, wie Sie mir erzählen. Wo sind die Pferde jetzt?«
»In Campo Verde«, gab Mahoney zungenfertig zurück. »Sie werden neu beschlagen. Der Greaser-Schmied dort soll für seine sorgfältige Arbeit bekannt sein.«
»Das stimmt«, warf Jesse Winslow ein. »Vargas ist ein Künstler in seinem Fach. Aber fragen Sie Mahoney doch mal, wie er an die Hengste gekommen ist, Matt. Wenn er ein Pferdehändler wäre, dann hätte er sich bestimmt nicht so ohne weiteres herunterhandeln lassen.«
»Richtig.« Mahoney grinste wie ein Faun. »Deshalb gebe ich ehrlich zu, die Gäule sind mir nur ein Klotz am Bein. Ich will durch die Indian Nations nach Kansas hinauf. Aber das ist für mich noch lange kein Grund, sie zu verschenken. Hundertfünfzig ist mein Limit.«
Matt Morgan nahm einen Schluck von seinem Ingwerbier. Er war ein schlanker Mann von etwa achtundzwanzig Jahren in abgewetzter, aber ordentlicher Weidekleidung. Den Colt trug er links in einem tief ausgeschnittenen Halfter. Seine blauen Augen waren so ungewöhnlich hell, dass die Pupillen sich dagegen jettschwarz ausnahmen. Er schien von Jesse Winslows Misstrauen angesteckt zu sein, denn er runzelte die Brauen und erwiderte sanft:
»Sie haben noch immer nicht gesagt, woher Sie die Pferde bekommen haben, Mister.«
Mahoney zeigte nicht die geringste Verlegenheit.
»Halten Sie mich für einen Pferdedieb? Dann hätte ich mir bestimmt keine Cayusen ausgesucht, Morgan.«
»Vielleicht. Aber können wir nicht zum Kern der Sache kommen?«
»Ich habe sie beim Stud-Poker gewonnen, in Fort Worth«, sagte Mahoney.
»Aah, wirklich?« In Jesse Winslows Tonfall lag blanker Hohn.
»Yeah.« Mahoney nickte. »Und da ich kein grüner Anfänger bin, ist hier die Bescheinigung, von dem Verlierer und zwei ehrenwerten Zeugen unterschrieben.«
Er feixte erneut und setzte erklärend hinzu: »Das heißt, bei dem einen haben wir Pech gehabt. Er konnte nur drei Kreuze machen. Deshalb habe ich selbst seinen Namen hinzugefügt.«
Er langte in die Brusttasche, brachte ein Papier zum Vorschein und entfaltete es mit einer schlenkernden Bewegung.
Jesse Winslow war schneller als Matt Morgan.
»Sieht so aus, als ob alles seine Richtigkeit hätte«, murmelte er, nachdem er die wenigen Zeilen überflogen und die Unterschriften studiert hatte. »Jedenfalls wären Sie mit diesem Wisch gedeckt, Matt.«
»Ich gehe zur Bank, um Geld abzuheben«, entschied Matt Morgan. »Dann können wir meinetwegen nach Campo Verde reiten. Einverstanden?«
»Mir recht«, erwiderte Mahoney und winkte ab, als er sah, dass Matt Morgan zahlen wollte. »Lassen Sie nur, das hier geht auf meine Rechnung.«
»Danke«, sagte Matt Morgan und ging hinaus.
Palo Pinto war eine kleine Stadt und zählte kaum mehr als 200 Einwohner. Sie bestand hauptsächlich aus Holzhäusern und Adobehütten, die sich um die Hauptstraße und wenige Nebengassen gruppierten. Nur die Bank war aus Backstein erbaut, und daneben erweckte auch Frank Bowmans General Store einen respektablen Eindruck.
Der Buchhalter in der Bank war bereits im Begriff, seinen Schreibtisch aufzuräumen. Er nahm Matt Morgans Quittung entgegen und holte noch einmal sein Zählbrett aus dem Tresor, um den Betrag auszuzahlen. Plötzlich öffnete sich die Tür von Cecil Corners Privatbüro und seine Tochter Joan betrat den Schalterraum.
»Wie geht's auf der Ranch, Mr. Morgan?«, fragte sie freundlich.
Joan Corner bot einen herzerquickenden Anblick. Ihre Frische und Natürlichkeit sowie ihr warmherziges und temperamentvolles Wesen sicherten ihr die Sympathie jener Damen aus der Stadt, die sonst bei den Kaffeekränzchen der Frauenliga, einer Vereinigung für Sitte und Moral, jeden durchzuhecheln pflegten. Nur einmal hatte man in Palo Pinto die Köpfe geschüttelt – damals nämlich, als Cecil Corner die Verlobung seiner Tochter Joan mit dem ernsten und schweigsamen Doc John Gentry bekanntgegeben hatte, und es waren Stimmen laut geworden, dass eine Verbindung so ungleicher Charaktere und Temperamente niemals zu einem glücklichen Ende führen könne.
Man hatte sich auch wieder an die seltsamen Umstände erinnert, unter denen John Gentry vor mehr als zwei Jahren nach Palo Pinto gekommen war: ein staubiger Mann auf abgehetztem, erschöpftem Pferd, der außer seiner Arzttasche und der Deckenrolle nichts weiter bei sich führte als jene abgesägte Schrotflinte, die ihn auch jetzt noch auf all seinen Fahrten über Land begleitete.
Für Palo Pinto war John Gentry ein Mann ohne Vergangenheit, dem ein angesehener Bürger wie Cecil Corner kaum seine Tochter anvertrauen konnte. Inzwischen hatte man sich aber damit abgefunden. John Gentry hatte sich trotz seines verschlossenen Wesens allgemein Respekt erworben und war in den Kreis der achtbaren Bürger aufgenommen worden, sodass seiner Heirat mit Joan Corner nichts mehr im Wege stand.
Er hatte seine Praxis und zwei Privaträume im Haus von Mrs. Polly McPartland, einer verwitweten Viehhändlergattin, aber es hieß, dass ihm Cecil Corner, sein zukünftiger Schwiegervater, nahegelegt hätte, sich standesgemäß zu etablieren und selbst ein Haus zu bauen.
Von Joan Corner nahm man an, dass sie solche Pläne freudigen Herzens unterstützte. All diese Dinge kamen Matt Morgan in den Sinn, als er das Mädchen begrüßte und sagte:
»Danke, Miss Joan. Auf der Ranch ist alles in Ordnung. Emily liegt mir ständig in den Ohren, wir sollten endlich einen Brunnen bohren, damit sie so eine moderne Pumpe in die Küche bekommt, aber dazu reicht es vorerst noch nicht. Man kann nicht alles auf einmal schaffen, nicht wahr?«
»Das sind eben die Sorgen eines Hausvaters, Mr. Morgan«, stichelte Joan Corner lächelnd. »Und was machen die Pferde?«
»Achtzehn gesunde Fohlen dieses Jahr«, berichtete Matt Morgan stolz. »Das lässt sich schon hören. Nächstes Jahr werden es bestimmt noch mehr sein. Ich habe eben Geld abgehoben, um zwei Zuchthengste zu kaufen, echte Cayusen, die ein Mann namens Mahoney in Campo Verde stehen hat. Das könnte ein blendendes Geschäft werden.«
»Dann lassen Sie sich nur nicht übers Ohr hauen, Mr. Morgan«, gab das Mädchen zurück.
»Keine Sorge, wenn es um Pferde geht, kann mir niemand etwas vormachen«, erwiderte Matt Morgan und schob seinen verrutschten Gurt zurecht. »Trotzdem dürfen Sie mir die Daumen drücken, Miss Joan.«
»Das werde ich tun«, versprach das Mädchen, um gleich fortzufahren: »Ist Ihnen vielleicht auf dem Weg zur Stadt Doc Gentry begegnet? Er ist schon seit gestern Abend zur Pollack-Farm ...«
»Ich weiß«, fiel ihr Matt Morgan ins Wort. »In ganz Palo Pinto redet man nur noch von Saul Pollacks Nachwuchs. – Nein, auf dem Weg zur Stadt ist mir der Doc nicht begegnet ...« Er ließ eine Pause eintreten und setzte dann hinzu: »Aber vor fünf Minuten kam er drüben aus der Einfahrt des Mietstalls, wenn Ihnen mit dieser Auskunft gedient ist.«
Seine anzügliche Sprechweise ließ Joan Corner erröten.
»Sie sollten sich schämen, eine vereinsamte Braut so auf den Arm zu nehmen.«
»Yeah«, Matt Morgan kicherte. »Nur habe ich leider keine Zeit, um mir die passende Ecke zu suchen. So long, Miss Joan!«
Das Mädchen nickte ihm lächelnd zu, als er eilig die Bank verließ und wieder dem Blue Cimarron zustrebte. Mahoney stand bereits draußen bei den Pferden.
»Haben Sie das Geld, Morgan?«
Matt löste die Zügel seines kastanienbraunen Wallachs und schwang sich geschmeidig in den Sattel.
»Das werden Sie schon merken, wenn ich Ihre Cayusen gesehen habe«, gab er schleppend zurück. »Und wenn ich sie noch bei Tageslicht sehen will, müssen wir uns beeilen.«
»Womit habe ich nur ein solches Misstrauen verdient«, seufzte Mahoney. »Reiten wir also!«
Gleich darauf galoppierten sie gemeinsam aus der Stadt.
Das Palo Pinto County war ein wildes, ziemlich trockenes und nicht besonders fruchtbares Stück Land im Norden von Texas, nicht weit entfernt von der Grenze der Indian Nations. Nur in den Flussniederungen des Brazos River hatten sich einige Farmer niedergelassen, den Dornbusch und wuchernden Mesquite gerodet und ihre Äcker unter den Pflug genommen.
Ansonsten wurde in dieser Gegend Rinderzucht betrieben. Eine Ausnahme machte lediglich Matt Morgan mit seiner Pferderanch. Sie lag am Rand des Breaks in der Nähe des Brazos, und er hatte sie erst vor zwei Jahren mit wenig Mitteln und viel Tatkraft und Optimismus gegründet. Der Erfolg, den er in dieser Zeit zu verzeichnen hatte, rechtfertigte seine Zuversicht.
Die ersten Monate waren reichlich hart gewesen. Doch das hatte Matt Morgan nicht daran gehindert, Emily Sheldon zu heiraten, die in Mineral Wells ein kleines Modewarengeschäft betrieb. Emily hatte den kleinen Laden verkauft und den Erlös mit in die Ranch gesteckt. Auf diese Weise konnte Matt seinen Pferdebestand vergrößern, und sie waren rascher als erwartet über den Berg gekommen, für einige Lästermäuler sogar viel zu rasch.
Campo Verde, eine langsam verfallende Mexikanersiedlung, lag in der einsamsten und trostlosesten Ecke des Countys. Der Grundwasserspiegel in dieser Gegend war während der vergangenen Jahrzehnte abgesunken, sodass der Ackerbau nur noch in unmittelbarer Nähe des Criollo Creeks möglich war. Die Trockenflächen dehnten sich immer weiter aus, und der Name Campo Verde – Grünes Feld – traf schon längst nicht mehr zu.
Bei den Mexikanern trug die Ortschaft den Beinamen Pueblo de las Viudas – Dorf der Witwen –, weil die meisten Männer als Vaqueros auf den Ranches der weiteren Umgebung arbeiteten und monatelang abwesend waren. Die Hälfte der schäbigen Adobehütten von Campo Verde stand bereits leer. Die Zahl der Menschen, die dauerhaft dort lebten, belief sich auf drei oder vier Dutzend. Es gab ein paar Korrals, eine Cantina und die Schmiede von Felipe Vargas.
Als Matt Morgan und sein Begleiter die Ansammlung schäbiger Hütten erreichte, stand die Sonne bereits tief im Westen. Die Zeit der geheiligten Siesta war also längst vorüber. Trotzdem lag die Ortschaft wie ausgestorben und der Hufschlag weckte in den Gassen ein hohles Echo.
»Was ist denn hier los?«, fragte Matt Morgan erstaunt.
Mahoney zuckte mit den Achseln.
»Woher soll ich das wissen? Vielleicht sind die Greaser alle drüben in der Missionskirche. Sie haben ja jeden dritten Tag das Namensfest irgendeines Heiligen. Heute Morgen sah ich zufällig, wie eine Frau Sträuße von gelben Kaktusrosen hineinschleppte.«
Die Erklärung kam so geläufig, dass Matt Morgan davon beschwichtigt wurde. So gelangten sie zum Zócalo, den staubigen Platz in der Mitte des Pueblos. Mahoney lenkte sein Pferd unter ein schattiges Vordach, saß ab und wartete, bis Matt Morgan seinem Beispiel gefolgt war. Dann gingen sie gemeinsam auf die Cantina zu.
»Wollen wir nicht erst nach den Hengsten sehen?«, fragte Matt und räusperte sich.
»Ihrer Kehle würde ein Schluck auch nicht schaden«, versetzte Mahoney. In seinem Gesicht zeigte sich eine seltsame Anspannung. »Sie krächzen schon so heiser wie ein Rabe. Für die Pferde bleibt uns noch genug Zeit. Ich nehme an, Vargas hat sie in den Korral hinter der Schmiede gebracht.«
Zögernd behielt Morgan die Richtung bei.
»Ich habe einen langen Rückweg«, gab er zu bedenken.
»Dann brauchen Sie erst recht einen Drink«, erwiderte Mahoney und fuhr sich mit dem Halstuch unter das Hemd, um den Schweiß von der Brust zu wischen.
Von der Seite her schaute Matt Morgan ihn an. Selbst der Tonfall seines Begleiters hatte sich plötzlich verändert und zeugte nun von Unruhe und Nervosität. Da sah er drüben an der Schmiede einen stoppelbärtigen Burschen im roten Unterhemd, der die Ärmel aufgerollt und den speckigen Hut in den Nacken geschoben hatte und beide Daumen hinter seinen Gurt hakte.
In der nächsten Gassenmündung erschien ein zweiter Mann, ein dritter am Ende der Mauer bei der Mission. Im selben Moment veränderte sich schlagartig Mahoneys Ausdruck.
Matt Morgans Hand sank zum Schenkel hinab, seine Lippen wurden schmal.
»Mahoney«, stieß er scharf hervor, »was hat das zu bedeuten?«
Der Glasperlenvorhang an der Tür der Cantina klirrte leise. Der Mann, der dort hervortrat und eine der Schnüre lässig von der Schulter streifte, war groß, hager und schwarz gekleidet – wie ein Stück Schatten, das die Nacht vergessen hatte. Alles an ihm war schwarz – Stiefel, Hose, Hemd, Lederweste und Hut, selbst der Revolvergurt mit den beiden tiefgeschnallten Revolvern. Sein hohlwangiges Gesicht wies dunkle Bartstoppeln auf.
Am stärksten beeindruckten jedoch seine bernsteingelben Augen. Dieser Mann hatte das Gesicht eines hungrigen Wolfs.
»Hallo, Matt!«, murmelte er mit falscher Freundlichkeit. »Ich wusste doch, dass wir uns eines Tages wiedersehen würden.«
✰✰✰
Zwei Jahre friedlichen Aufbaus hatten genügt, um Matt Morgan vergessen zu machen, dass ein großer Schatten über seinem Leben lag. Ein altes Sprichwort sagte: Wer dem Frieden nachläuft, muss lange Beine haben. Irgendwann holte die Vergangenheit jeden ein, der vor ihr davonlief. Für Matt Morgan war dieses »Irgendwann« ein Tag im September des Jahres 1872.
Sein Blick wanderte zur Hofeinfahrt der Cantina. Auch dort standen jetzt zwei abgerissene Desperados, und zwei weitere tauchten bei den staubigen Ulmen an der Ecke der kleinen Missionskirche auf. Sie hatten ihn in der Falle, und Mahoney war der Köder gewesen. Es gab keine Cayusen in Campo Verde, es gab nur den großen Schatten.
»Hallo, Shad«, sagte auch Matt Morgan, und seine Stimme klang tatsächlich so heiser und krächzend wie die eines Raben.
»Yeah«, entgegnete der Schwarzgekleidete schleppend, »es hatte wirklich keinen Sinn, dass ihr vor mir davongelaufen seid.« In seinen gelben Wolfsaugen zeigten sich böse Lichter, als er zynisch fortfuhr: »Es hat ziemlich lange gedauert, und euer Schlupfwinkel ist geschickt gewählt, aber gefunden habe ich euch doch.«
Seine Rechte, die er bis dahin scheinbar lässig auf dem Rücken gehalten hatte, kam plötzlich zum Vorschein und schwang den Lauf einer Winchester hoch. In der großen, knochigen Hand Shads nahm sich der leichte Sattelkarabiner fast wie ein Spielzeug aus.
Während er den Kolben mit dem Ellbogen gegen die Rippen drückte und die Mündung auf Matt Morgan richtete, griff er mit der Linken in die Hosentasche. Morgan wusste bereits, was jetzt folgen würde, diesen Trick hatte Shad schon damals beherrscht. Er war also nicht überrascht, als der Schwarzgekleidete eine schon fast fertig gedrehte Zigarette zutage förderte und zum Mund führte, um das Blättchen mit der Zunge anzufeuchten. Shads Blicke hafteten dabei unverwandt und mit neugieriger Grausamkeit an seinem Opfer.
»Hör mich an, Shad«, sagte Matt Morgan gepresst. »Das sind doch nur Hirngespinste. Wir haben dich damals für tot gehalten, sonst hätten wir dich nicht zurückgelassen.«
Der Schwarzgekleidete hatte die Zigarette bereits in den Mundwinkel gehängt.
»Wirklich?«, entgegnete er mit beißendem Sarkasmus. »Und warum habt ihr dann sorgfältig eure Spur verwischt und euch hier verkrochen?«
»Das weißt du doch ebenso gut wie ich«, sagte Matt Morgan beschwörend.
Der andere zog die Brauen in die Hohe.
»Ich verstehe, Kleiner. Ihr wolltet nicht gern mein Schicksal teilen und die besten Jahre eures Lebens hinter Gittern verbringen« Plötzlich nahm seine Stimme eine schneidende Schärfe an »Aber für mich ging es nicht nur um ein paar Jahre, bei mir ging es um Kopf und Kragen. Daran habt ihr wohl nicht gedacht, wie? Euch hätte es nichts ausgemacht, wenn man mir den Strick um den Hals gelegt hätte.«
Seine Augen waren jetzt in weite Fernen gerichtet, so als ob er die Bilder einer rauen Vergangenheit wieder vor sich sähe.
»Was hätten wir denn tun können, Shad«, stieß Matt Morgan ächzend hervor »Als wir erfuhren, dass du noch am Leben warst, war es doch längst zu spät.«
Der Schwarzgekleidete schien die Worte gar nicht gehört zu haben.