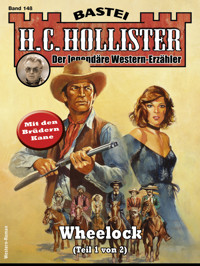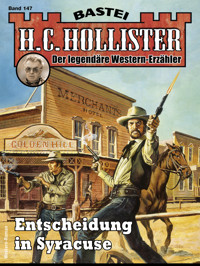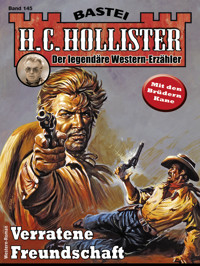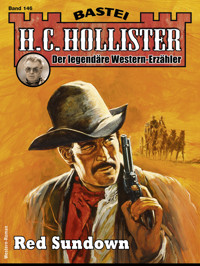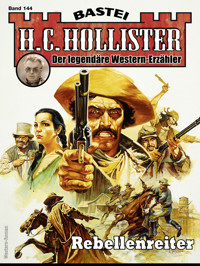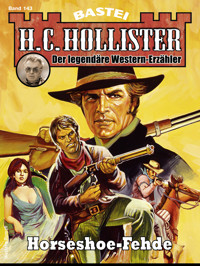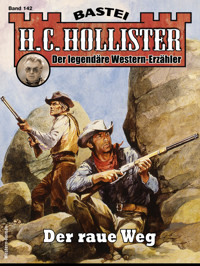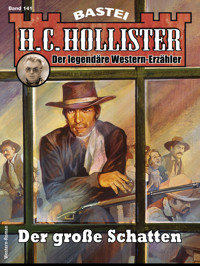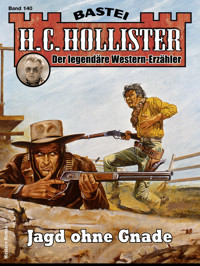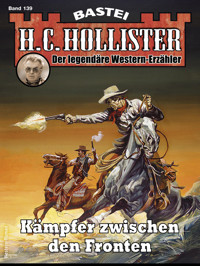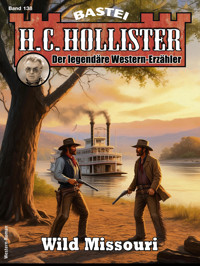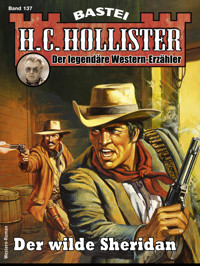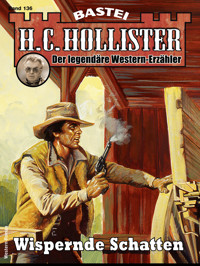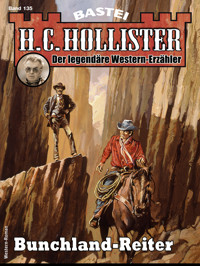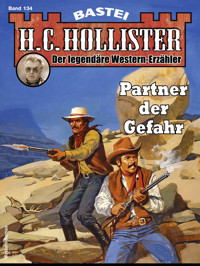1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Unendliche Wüste, brennende Sonne, Durst, Schüsse - das sind die letzten Dinge, die Jesse Nash wahrnimmt, bevor er, am Ende seiner Kraft, zu Boden stürzt. Hat er Minuten oder Stunden in dem Kakteenverhau gelegen, als Yazoo ihn findet und ihm hilft? Die Desperados, die ihn jagten und sein Pferd erschossen, sind verschwunden. Doch Jesse Nash vergisst sie nicht. Er rechnet mit ihnen ab ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der Ruf der Wüste
Vorschau
Impressum
Der Ruf der Wüste
Unendliche Wüste, brennende Sonne, Durst, Schüsse – das sind die letzten Dinge, die Jesse Nash wahrnimmt, bevor er, am Ende seiner Kraft, zu Boden stürzt.
Hat er Minuten oder Stunden in dem Kakteenverhau gelegen, als Yazoo ihn findet und ihm hilft? Die Desperados, die ihn jagten und sein Pferd erschossen, sind verschwunden. Doch Jesse Nash vergisst sie nicht. Er rechnet mit ihnen ab ...
Der Wallach war ein Brasada-Pferd, geschult und gehärtet im mörderischen Texas-Dornbusch am Rio Grande. Doch achthundert Meilen Indianerland und Einöde hatten seine Kräfte aufgezehrt. Und die Sonora-Wüste war nicht mit der Brasada zu vergleichen. Hier herrschte selbst im Herbst noch immer die Gluthitze des Sommers.
Jesse Nash ging zu Fuß und zog den narbigen Grauschimmel hinter sich her. Seit Tagen schon hielt er diesen Rhythmus bei – eine Stunde Ritt und dann eine halbe Stunde Fußmarsch. Achtundvierzig Stunden zuvor hatte er das letzte Wasser aus seiner filzbezogenen Satteltasche mit seinem vierbeinigen Partner geteilt. Jetzt waren sie beide am Ende.
Sie durften nicht mehr rasten, obwohl der feurige Sonnenball schon hoch am Himmel stand und sie mit seinen gnadenlos sengenden Strahlen ausdörrte. Jesse Nash war sicher, dass der Wallach nicht mehr auf die Beine kommen würde, wenn er sich einmal niedergelegt hatte. Er hatte die Karte verflucht, nachdem er zwei der darin eingezeichneten Wasserlöcher trocken vorfand. Wertvolle Kraft hatte er damit vergeudet, nach Wasser zu graben. Sie mussten um jeden Preis noch heute Rio Perdido erreichen, die Wüstenstation der Ranger.
Wie ein matter Kupferball tauchte die Sonne in den bleigrauen Dunst am westlichen Horizont, als Jesse Nash den Rauch erblickte, der nur knapp eine Meile vor ihm direkt aus dem Boden aufzusteigen schien. Im ersten Moment glaubte er an eine Wahnvorstellung, aber sobald sein Verstand zu arbeiten begann, erinnerte er sich an ein merkwürdiges Geräusch, das er kurze Zeit zuvor vernommen hatte. Hatte es sich dabei um Schüsse gehandelt?
Unvermittelt tat sich vor ihm ein weiter Arroyo auf. Nash kniff die entzündeten Lider zusammen, als er den Flammenschein brennender Gebäude erkannte. Unter ihm lagen Rio Perdido, raschelnde Alfalfa-Felder, Gruppen von Cottonwoods, Korrals und ein paar Koppelzäune.
Der Arroyo mit seinen steil abfallenden Wänden maß wohl eine halbe Meile in der Breite. In seiner Mitte glitzerte das gewundene Band seines Creeks. Rot spiegelten sich die Flammen darin wider.
Unmittelbar unterhalb von Nashs Standort trieben verwegen aussehende Reiter ein Pferderudel auf der Koppel zusammen und scheuchten es mit wilden Schreien nach Süden. Die Kerle waren Mexikaner. Einige trugen gekreuzte Patronengurte über der Brust. Zwei von ihnen entdeckten die Gestalt oben an der Abbruchkante, die sich gegen den türkisfarbenen Abendhimmel abhob, und machten ihre Kumpane durch kehlige Rufe aufmerksam. Sekunden später krachten die Schüsse, und Nash pfiffen die Kugeln um die Ohren.
Schwankend zog er sich zurück, riss seinen Sattelkarabiner aus dem Scabbard und ließ sich zu Boden fallen. Der Grauschimmel wieherte matt und warf den Kopf hoch. Die Witterung des Wassers musste ihn rasend machen. Er trabte ein Stück an der Felskante entlang, um einen Abstieg zu suchen. Doch während er noch mit den Vorderhufen nach einem Halt tastete, zuckte er plötzlich zusammen. Nash wollte schreien, aber mehr als ein ersticktes Krächzen kam nicht über seine rissigen Lippen.
Der Wallach entfernte sich torkelnd vom Rand des Arroyos. Nach wenigen Schritten brach er mit einem menschlich anmutenden Seufzer zusammen und streckte sich.
Für ein paar Sekunden schloss Jesse Nash die Augen. Erst das Poltern von Steingeröll und zwei weitere Schüsse brachten ihm zu Bewusstsein, dass dies alles kein Alptraum, sondern grausame Wirklichkeit war. Die Wüstenstation der Ranger war einem Überfall mexikanischer Grenzbanditen zum Opfer gefallen.
Auch wenn der rettende Rio Perdido hundert Meilen entfernt gewesen wäre, hätte er für einen vor Durst halb wahnsinnigen Mann nicht unerreichbarer sein können. Der Schmerz über den Verlust seines vierbeinigen Partners überwältigte Nash nur für wenige Sekunden, dann robbte er an die Kante des Arroyos und schob seinen Karabiner über einen Felsbrocken.
Zwei Gestalten kamen den Steilhang heraufgeklettert und fühlten sich sicher im Feuerschutz ihrer Kumpane, von denen drei auf dem Grund des Wüstentals abgesessen waren und ihre Gewehre in Anschlag hielten. Nash ließ sich dadurch nicht beirren. Er visierte kurz und drückte ab. Der vorderste der beiden Desperados riss die Arme hoch und stürzte mit einem Schrei die Rinne hinab, seinen Begleiter mit sich reißend.
Schon war der Arroyo in blaue Schatten gehüllt. Grell stachen die Mündungslichter der drei Gewehre daraus hervor, aber nur eine Kugel klatschte neben Jesse Nash an den Felsen. Er hatte bereits repetiert und schoss zum zweiten Mal. Der mittlere der Schützen brach lautlos zusammen, während aus dem Einstieg der Rinne ein Mann kam, der hinkend zu den Pferden rannte.
Kurz darauf jagten die Berittenen davon, um dem Schussbereich zu entrinnen. Wenig später gelangten auch die anderen zu den Pferden und brachten sich ebenfalls in Sicherheit. Zwei Schüsse, die Nash ihnen nachschickten, blieben ohne Wirkung.
Bei den brennenden Gebäuden zeigten sich weitere Gestalten. Aus einer der Adobehütten schienen sie etwas herauszuschleppen. Eine schrille Stimme schrie Befehle in spanischer Sprache. Auch jenseits des Creeks tauchten nun Reiter auf, formierten sich zu einer dichten Traube und galoppierten nach Süden, wo der Arroyo allmählich in die offene Wüste überging. Insgesamt musste es sich um mehr als zwei Dutzend Desperados handeln.
Die Absicht ihres Anführers war klar. Da es sich als lebensgefährlich erwiesen hatte, die Wand des Arroyos in direkter Linie zu erstürmen, sollten seine Bravos das Hindernis umgehen und den Gegner von der anderen Seite packen. Ein Wunder hätte geschehen müssen, wenn Nash gegen acht oder neun bestehen wollte. Es sah so aus, als habe er am Ziel seines Ritts zugleich auch das Ende seiner Fährte erreicht – ebenso wie jene armen Teufel in der Station, die zweifellos bei diesem Überfall ihr Ende gefunden hatten.
Verzweiflung, Mutlosigkeit und Erschöpfung drückten Jesse Nash nieder. Dann jedoch kroch er vom Rand des Arroyos zurück und erhob sich. Wenn es ihm gelang, sich vor den berittenen Verfolgern zu verstecken, dann konnte er vielleicht im Laufe der Nacht an einer anderen Stelle in den Arroyo schleichen und trinken.
Mechanisch bewegte er die Lippen, um sie anzufeuchten, doch die tiefen Kerben platzten auf, und er empfand nichts als den süßlichen Geschmack seines eigenen Bluts, das aus einem dieser Risse quoll.
Rings um ihn war Nacht. Nur im Westen zeigte sich noch ein fahler Schimmer über dem Horizont, und am Rand des Arroyos flackerten die Flammen des Brands. Noch strahlte das Gestein die Tageshitze zurück, aber in spätestens zwei Stunden, wenn der Boden ausgekühlt war, würde ihm die schneidende Kälte der Nacht bis ins Mark dringen.
Nash schleppte sich weiter, so rasch es seine Kräfte erlaubten. Er mochte etwa eine Viertelmeile zurückgelegt haben, als er Hufschlag vernahm und sich umwandte. Schemenhaft hoben sich die Reiter von der Kante des Wüstentals ab, der sie unbeirrt folgten. Schon waren sie an jener Stelle angelangt, wo Nash noch bis vor kurzem gelegen hatte. Wenig später schienen sie den toten Grauschimmel gefunden zu haben.
Einer von ihnen schrie etwas in den Arroyo hinab und bekam sofort Antwort. Dann teilte sich das Rudel und schwärmte aus. In Gedanken verfolgte Jesse Nash, was nun dort drüben vor sich ging. Die Burschen würden seine leere Sattelflasche entdecken und dadurch ein Bild seiner Lage gewinnen. Dann würden sie sich auf die Lauer legen und warten. Ein Mann ohne Wasser und ohne Pferd war in der Wüste verloren. Rio Perdido war die einzige Wasserstelle auf dreißig Meilen im Umkreis. Das wussten die Desperados ebenso gut wie er.
Das Gelände wurde steiniger und öder. Hinter einem Felsbrocken sank Nash zusammen und verfiel in einen Zustand dumpfer Teilnahmslosigkeit. Er hörte Hufgeklapper und Stimmen in der Nähe, aber das alles drang nicht mehr in sein Bewusstsein.
Er musste vor Erschöpfung eingeschlafen sein, denn als er aufwachte, stand ein fahler Mond hoch über den Dirty Devil Mountains, und die beißende Kälte der Wüstennacht ließ seine Glieder erstarren. Nash wurde nur noch von dem unbändigen Verlangen nach Wasser beherrscht. Weiter und weiter kämpfte er sich durch die bizarren Felsformationen, bis er wieder sandigen Grund unter den Füßen spürte und sich einem Verhau von Kakteen gegenübersah.
Stacheln drangen durch seine weichgegerbten Chaps in die Beine und zwangen ihn, die Richtung zu ändern. Irgendwo dort vorn musste Rio Perdido liegen. Er glaubte selbst dann noch daran, als er schon fast drei Stunden dahingeschwankt war und ein feuriger Saum im Osten den nahenden Tag ankündigte.
Seine Zähne schlugen in Fieberschauern aufeinander. Noch immer hielt er seinen Karabiner umklammert, doch er musste das Gewehr als Stütze benutzen, weil seine Beine ihm den Dienst zu versagen drohten. Rings um ihn erstreckte sich endlos die rote Sonora-Wüste.
Noch glomm ein Funke seines Lebenswillens, auch wenn sein Bewusstsein längst ausgeschaltet war. In dem groben, körnigen Sand blieb eine Schleifspur zurück, als er sich auf wunden Füßen ziellos weiterschleppte und dabei sein Gewehr am Lauf hinter sich herzog.
Der Schatten vor ihm wurde kürzer und wies bereits nach Nordwesten, als Nash wieder einmal strauchelte und dabei einen Blick rückwärts warf. Bis zum Horizont erstreckte sich die furchtbare Wüste, und mitten in dieser Einöde schimmerte eine blaue Wasserfläche, erschienen die weißen Häuser einer Stadt. Nash reckte die Hand, als wolle er danach greifen. Doch alles zerfiel in nichts – eine Fata Morgana! Von diesem Augenblick an war sein Durchhaltewillen gebrochen. Er stürzte, und über ihm schwebten drei Geier und zogen ihre Kreise allmählich tiefer.
✰✰✰
Yazoo, der Yaqui-Indianer, war ein Geschöpf des Wüstenhochlands. Neben seinem Maultier schritt er mit gelassener Ruhe einher. Auf seinen bronzenen Zügen lag der melancholische Ernst eines aussterbenden Volks, das seit Jahrzehnten von den Mexikanern verschleppt und ausgerottet wurde, sich aber mit der Zähigkeit und der unbegreiflichen Lebenskraft aller Wüstengeschöpfe zur Wehr setzte.
Die Sonne stand im Zenit, als der Yaqui den leblosen Körper zwischen einigen Kakteen ausgemacht hatte und sich ihm näherte. Einer der Geier hockte bereits wenige Schritte davon entfernt am Boden und erhob sich mit schwerfälligem Flügelschlag, als der Mann und das Maultier sich auf ihn zubewegten. Für Yazoo war dies das beste Zeichen, dass er noch nicht zu spät gekommen war, auch wenn die Gestalt, die dort mit dem Gesicht im Sand lag, keine Lebenszeichen mehr von sich gab.
Yazoo schob die braune Hand unter das Hemd des Mannes und spürte den schwachen Herzschlag. Dann lief er zu seinem Maultier, holte die Kalebasse und setzte sie dem Verdurstenden an den Mund. Wenig später hing Jesse Nash schlaff und zusammengesunken auf dem Packsattel des Maultiers, und Yazoo stützte ihn. So zogen sie einem fahlgrünen Fleck in der Ferne entgegen, der nur mit qualvoller Langsamkeit näher rückte.
Als Nash zu sich kam und die entzündeten Lider öffnete, war es bereits wieder Nacht, und vor ihm brannte ein winziges Feuer aus dürren Mesquite-Wurzeln.
»Wasser ...« Nur mühsam formte Nash das Wort.
Der Yaqui kam mit einem Becher zu Nash und hockte sich auf die Fersen.
»Nicht Wasser«, sagte er in einem gutturalen Spanisch. »Bisnaga-Saft.«
Nash schluckte. Die Flüssigkeit war weißlich und trübe und schmeckte leicht säuerlich, doch ging eine belebende Wirkung von ihr aus. Nash spürte eine wohltuende Entspannung, die ihn rasch wieder in einen Dämmerschlaf sinken ließ.
Yazoo verschwand mit seinem Messer und einem Leinenbeutel in der Dunkelheit. Nur ein kurzes Stück von der geschützten Mulde entfernt wuchsen die Bisnagas, kniehohe, stachelige Fasskakteen. Der Yaqui köpfte sie im oberen Drittel. Unter der spröden, stacheligen Schale waren die Wüstengewächse mit weißem schwammigem Mark gefüllt, das Yazoo nun herauskratzte und in seinem Beutel sammelte.
Vier oder fünf Bisnagas machte er auf diese Weise den Garaus, ehe er mit seiner Ausbeute zum Camp zurückkehrte. Als er das Kaktusmark ausgedrückt hatte, war eine seiner Kalebassen zur Hälfte mit Bisnaga-Saft gefüllt. Wieder erhielt Jesse Nash einen halben Becher davon. Er trank gierig, ohne dabei aufzuwachen. Dann machte sich der Yaqui an die Zubereitung einer Mahlzeit.
Später wusste Nash sich nur zu erinnern, dass er irgendwann in der Nacht gefüttert worden war. Anschließend hatte ihn der Yaqui entkleidet und sich an seinen zerschundenen Füßen und den von Kaktusstacheln gespickten Beinen zu schaffen gemacht. Er hatte etwas gesagt und seine spanischen Worte mit ernsten Gesten unterstrichen. Nur ein traumhafter Eindruck davon blieb in Jesse Nashs Gedächtnis haften.
Als er aufwachte, war es heller Tag. Der Yaqui und sein Maultier waren verschwunden. Der Sattelkarabiner, nur flüchtig von Staub und Sand gereinigt, lehnte am rissigen Stamm eines Palo christi. Daneben standen eine Kalebasse und ein kleiner rußgeschwärzter Topf mit undefinierbarem Brei, in dem ein Blechlöffel steckte. Mit einem unüberhörbaren Knurren des Magens verlangte der ausgedörrte Körper sein Recht. Nash fühlte sich seltsam leicht und schwerelos, als er die indianische Decke zurückstreifte. Dann erst bemerkte er, dass seine Beine bis hinab zu den Fußsohlen mit einem Pflanzen- oder Wurzelbrei bestrichen waren, den die Körperwärme inzwischen trocken, spröde und rissig gemacht hatte.
Bei jeder Bewegung zeigten sich neue Sprünge in der Masse, die sich nun leicht von der Haut lösen ließ. Der Erfolg der Behandlung war offensichtlich: Einige Reste Stacheln und Dornen, die der Yaqui nicht hatte entfernen können, hafteten an der zähen Kruste, als Nash sie nun abbröckelte. Natürlich hatte das Mittel Yazoos keine Wunder vollbringen können; Nashs Füße waren immer noch wund und zerschunden, schienen aber ohne Entzündung zu heilen.
Jesse Nash kroch zu dem Stamm, lehnte sich mit dem Rücken dagegen und legte das Gewehr quer über seinen Schoß. Jetzt sah er auch seine Hose, Chaps und Stiefel daliegen. Die durchlöcherten formlosen Wollfetzen daneben waren ein Paar Socken gewesen. Am wichtigsten aber schien ihm der patronengespickte Gurt mit den beiden 44er Revolvern, den sein Retter an einen Ast des Palo christi gehängt hatte.
Die mit rauem Elkhorn eingelegten Kolben der blauschimmernden Waffen ragten unversehrt aus den Halftern. Nash richtete sich auf und wollte den Gurt umschnallen, als ihm die Unmöglichkeit seines Aufzugs bewusstwurde und er zunächst in seine Hose fuhr. Dann aber griff er nach der Kalebasse und zwang sich, in kleinen Schlucken zu trinken. Wieder spürte er die belebende Wirkung des Getränks, das der Yaqui mitten in der Wüste gewonnen hatte.
Nachdem er den Brei aus dem rußigen Topf gegessen hatte, ließ er sich zurücksinken und zog den Tabaksbeutel aus der Tasche seiner verschossenen, sonnengebleichten Buschjacke. Während er noch seine Pfeife stopfte, vernahm er einen leisen Hufschlag und griff nach dem Gewehr. Dann erschien in dem lichten Kakteen- und Dornengestrüpp am Rande der Mulde auch schon der Yaqui, diesmal im Sattel eines hochbeinigen Falben, gefolgt von einer gedrungenen Gestalt von abenteuerlichem Aussehen.
Der Mann, der ebenfalls einen Silberfalben ritt und ein weiteres Pferd derselben Gattung an der Leine führte, war ein Weißer, obgleich sein lederhäutiges, von tausend Runzeln und Falten durchzogenes Gesicht daran Zweifel aufkommen lassen konnte.
Seine Kleidung bestand aus hellem, fast weißem Wildleder. Weiß waren auch das lange Haupthaar und der Bart, der ihm wie ein dünner Zipfel von der Kinnspitze hing. An den Füßen trug er indianische Mokassins, und in seinem Gürtel steckte eine uralte doppelläufige Reiterpistole mit einem pechschwarzen Griff aus Ebenholz.
Ehe er sich ächzend aus dem Sattel gleiten ließ, zog er ein nicht weniger abenteuerlich anmutendes Gewehr aus dem Scabbard. Nash fühlte sich unwillkürlich an ein Kentucky Rifle erinnert; denn als der Mann erst auf dem Boden stand und den Kolben des Gewehrs aufstemmte, reichte es ihm fast bis an die Schulter.
»Buenos dias, amigo«, klang seine krächzende Stimme. »Wieder von den Toten auferstanden?«
»Was sagt man in einem solchen Fall?«, versuchte Nash es in englischer Sprache. »Sehr erfreut, Sie zu sehen, Sir?«
Das runzlige Mumiengesicht des Alten zeigte keinerlei Regung, doch in seinen Augen glomm ein Funke Humor.
»Schon wieder zu Scherzen aufgelegt, wie?«, erkundigte er sich ebenfalls in Englisch. »Das spricht für Ihre Zähigkeit, mein Freund. Aus Ihnen könnte noch ein knorriges Wüstengewächs werden.«
Ohne weitere Umstände ließ er sich mit gekreuzten Beinen im Sand nieder und brachte ebenfalls eine Pfeife zum Vorschein. Nash reichte ihm den Tabaksbeutel, und der Mann bediente sich. Seine Blicke ruhten auf Jesse Nashs beiden Halftern, als er fortfuhr: »Welcher Wind hat Sie in die Sonora-Wüste geweht?«
Nash versorgte sich mit Feuer und gab das brennende Zündholz an sein Gegenüber weiter.
»Mein Name ist Jesse Nash«, erklärte er. »Ich komme aus der Brasada am Rio Bravo.«
»Aus Texas also«, nickte der weißhaarige Alte. »Man hört es am Zungenschlag. – Ein verdammt langer Ritt.«
»Yeah«, erwiderte Nash.
»Und so was unternimmt man nicht ohne Grund ...«
»Das ist richtig.«
Der Alte schien aus der Einsilbigkeit seine Schlüsse zu ziehen.
»Schon gut«, murmelte er und hüllte sich in blaue Rauchwolken. »In der Sonora-Wüste steht es einem Mann frei, Fragen zu beantworten – oder es bleibenzulassen. Aber vielleicht wollen Sie ein paar Worte darüber verlieren, auf welche Weise Sie zu Fuß und ohne Packtier in diese Bratpfanne geraten sind.«
»An die Stelle, wo Ihr Indio mich gefunden hat?«
Tadelnd schüttelte der Mann den Kopf.
»Yazoo ist kein Indio«, versetzte er beherrscht. »Er ist ein Yaqui, und die Yaquis sind Bergazteken, die letzten Überreste eines einstmals starken und mächtigen Volks.«
Ohne Verlegenheit hielt Jesse Nash dem Blick der scharfen Augen stand.
»Ich fürchte, Sie haben mich missverstanden, Mister. Wenn ich ihn einen Indio nannte, dann war das gewiss nicht abfällig gemeint. Immerhin ist Yazoo mein Lebensretter, nicht wahr?«
»Weiß Gott, das ist er«, bestätigte der seltsame Alte im Tonfall höchsten Respekts.
»Ich war auf dem Weg nach Rio Perdido«, erklärte Nash. »Zwei Wasserstellen, die auf meiner Karte eingezeichnet waren, fand ich ausgetrocknet. So waren mein Pferd und ich die letzten achtundvierzig Stunden ohne Wasser. Trotzdem haben wir die neunzig Meilen bis Rio Perdido geschafft. Vor Durst waren wir halb wahnsinnig.«
»Ich kenne diesen Zustand«, nickte der Mann verständnisvoll. »Und mir gefällt die Art, wie Sie von Ihrem Pferd sprechen. Aber fahren Sie fort.«
»Die Schufte haben meinen Grauschimmel erschossen!«, stieß Nash rau hervor. »Das beste und zäheste Brasada-Pferd, das ich je herangezogen und trainiert hatte, haben sie blindlings niedergeknallt, als ich am Rand des Arroyos auftauchte. Es war eine Bande von Greasern – ungefähr dreißig Mann stark, schätze ich. Sie haben die Wüstenstation überfallen. Die Gebäude standen in Flammen, und gerade waren ein paar Kerle dabei, die Pferde auf der Koppel zusammenzutreiben.
Zwei von ihnen habe ich erwischt. Dann machten sie Jagd auf mich. In der Dunkelheit bin ich ihnen entkommen und irgendwo zwischen den Felsen vor Erschöpfung zusammengebrochen. Als ich wieder einigermaßen zu mir kam, hatte ich die Orientierung verloren. Ich bin marschiert, bis ich irgendwann bewusstlos wurde. Wo das war, kann Ihnen nur der Yaqui sagen.«
»Er hat es mir schon gezeigt«, erwiderte der Alte. »Sie müssen ein Wunder an Zähigkeit sein, Nash. Die Stelle lag mehr als fünfundzwanzig Meilen von Rio Perdido entfernt. Und nach Ihrem Bericht waren Sie zu diesem Zeitpunkt bereits seit drei Tagen ohne Wasser. Sogar für einen Yaqui wäre das eine respektable Leistung.«