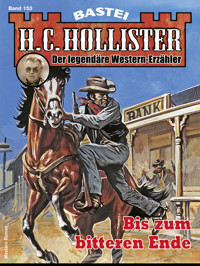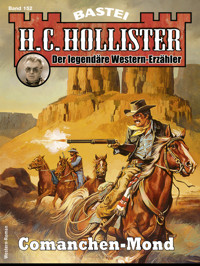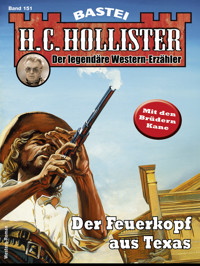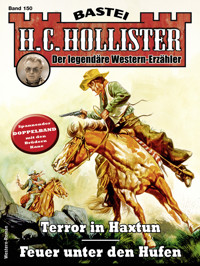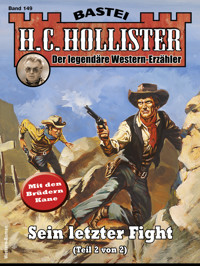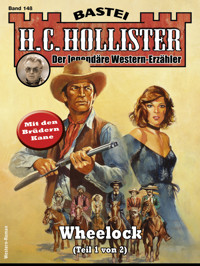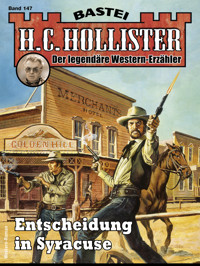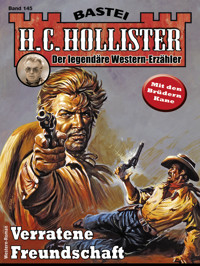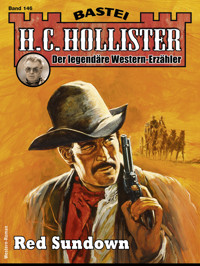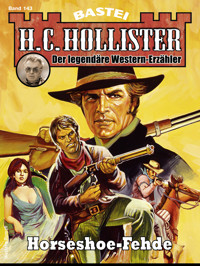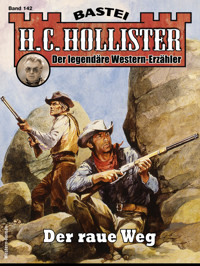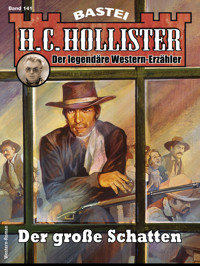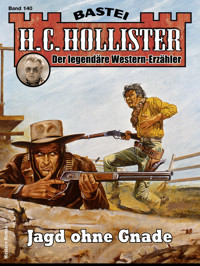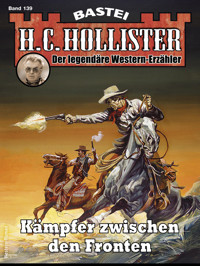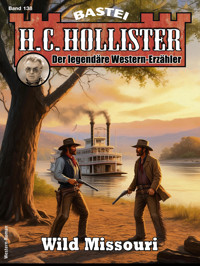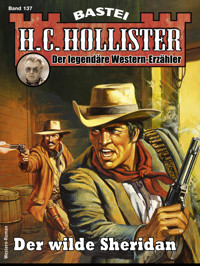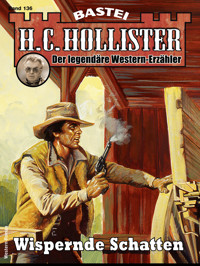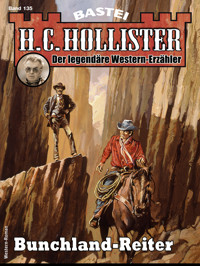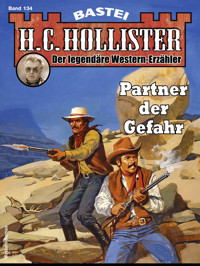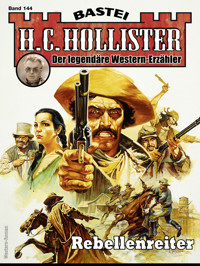
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Aus den Augenwinkeln bemerkte der Ranger den Schatten, der unter den Cottonwoods auftauchte. Seine Hand zuckte zum Halfter und wirbelte den Colt heraus. "Keine Bewegung, Leute! Kommt von der Tür weg und schnallt ab!" Die tödliche Betroffenheit der drei Rebellenreiter währte keine zwei Sekunden. Wie ein Blitz riss der eine Bursche plötzlich den Lauf seiner Schrotflinte in die Höhe. Der Ranger ließ sich fallen und schoss. In diesem Moment krachten von der Stallecke her die Navy-Colts des Captains. Mit einem Schlag brach das Inferno herein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
REBELLENREITER
Vorschau
Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen?
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsbeginn
Impressum
REBELLENREITER
Aus den Augenwinkeln bemerkte der Ranger den Schatten, der unter den Cottonwoods auftauchte. Seine Hand zuckte zum Halfter und wirbelte den Colt heraus. »Keine Bewegung, Leute! Kommt von der Tür weg und schnallt ab!«
Die tödliche Betroffenheit der drei Rebellenreiter währte keine zwei Sekunden. Wie ein Blitz riss der eine Bursche plötzlich den Lauf seiner Schrotflinte in die Höhe. Der Ranger ließ sich fallen und schoss. In diesem Moment krachten von der Stallecke her die Navy-Colts des Captains. Mit einem Schlag brach das Inferno herein.
Das schimmernde Band des Flusses glitzerte wie poliertes Messing im Schein der tiefstehenden Nachmittagssonne. Clay Sheridan ritt auf dem alten spanischen Rio-Grande-Trail – und sein großer, lehmgelber Wallach trottete mit der ausdauernden Zähigkeit eines langgedienten Kavalleriepferdes dahin.
Man schrieb den 14. September 1866. Überall in Texas und im ganzen Süden fand man in dieser düsteren Nachkriegszeit Männer, die noch Teile der ehemaligen grauen Südstaatenmontur trugen. Clay Sheridan machte davon keine Ausnahme! Sein verschossener Feldhut, sein McClellan-Sattel und der Mantelsack kennzeichneten ihn als Rebellenreiter.
Im Scabbard steckte ein 52/56er Union-Spencer-Karabiner. Außerdem trug Clay Sheridan im Buscadero-Gurt zwei blauschimmernde 36er Navy-Colts mit rauen, verblichenen Elkhorngriffschalen.
Selbst bei diesem einsamen Ritt war seine sandfarbene Buschjacke so weit zurückgeschlagen, dass er jederzeit ungehindert an die Waffen gelangen konnte. Immerhin befand er sich westlich des Pecos' im Gebiet der berüchtigten Big Bend, dem Schlupfwinkel von Outlaws, Desperados und Geächteten, wo kein Gesetz existierte und Vorsicht jederzeit am Platze war.
Clay Sheridan ritt zusammengesunken und mit langgeschnallten Bügeln. Er hielt den Kopf gesenkt, sodass sein bronzehäutiges Gesicht vom Hutrand beschattet wurde – und die Zügel lagen lässig in seiner Linken.
Er kam von Westen und folgte schon seit mehr als einer Stunde der gelben, zerklüfteten Hügelkette, von der sich steinige Arroyos durch das Vorland zum Fluss hinunterzogen. Der alte spanische Trail war kaum mehr als eine Doppelspur staubiger Radfurchen, die mitunter dicht am Fluss entlangführten, um sich dann wieder den Hügeln zuzuwenden. Stellenweise verschwanden sie bereits unter wucherndem Unkraut.
Der Fluss bildete die Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten – und seitdem drüben eine blutige Revolution tobte, zogen die meisten Frachtfahrer die Van-Horn-Route im Inneren des Landes vor. Mexikanische Desperados pflegten sich nicht an politische Grenzen zu halten und dehnten oft ihre Raubzüge über den Rio Grande aus.
An diese Dinge wurde Clay Sheridan jäh erinnert, als dünn und schwach das Krachen von Schüssen über den Fluss drang. Sheridan gab seinem Wallach eine Parade und hielt an. Das Pferd stand reglos wie eine Bildsäule, als der Reiter mit geübtem Griff seinen Karabiner aus dem Sattelschuh zog und auf den Schenkel stemmte.
»Hast du's auch gehört, Yank?«, murmelte Sheridan, als erneut und diesmal bedeutend näher zwei Schüsse ertönten und die Ohren des Wallachs zu spielen begannen. »Da ist etwas im Gang – und wir können es uns nicht leisten, einfach weiterzureiten. Los, sehen wir uns wenigstens an, wer da seine Munition vergeudet!«
Eine leichte Veränderung der Schenkelhaltung genügte und der Wallach ging aus dem Stand in einen abrollenden, raumgreifenden Galopp über. Etwa eine halbe Meile entfernt ragten graue, verwitterte Klippen über Scrubwoods und Kakteen-Verhaue empor.
Als Sheridan dort anlangte und aus dem Sattel glitt, befand er sich oberhalb eines Arroyos und hatte freien Ausblick über den Fluss, der hier eine weite Schleife zog. Dann sah er sie!
Zwei Reiter tauchten drüben aus einer Hügelfalte auf und jagten unterhalb eines langgestreckten Felsabbruchs dem Fluss entgegen. Allem Anschein nach handelte es sich um Amerikaner. Einer von ihnen trug einen schwarzen Prince-Albert-Rock und einen schwarzen Stetson mit flacher Krone. Er beugte sich tief über den Hals eines hochbeinigen Rotfuchses und wandte ein paarmal den Kopf nach seinem Begleiter, der ein paar Längen zurücklag.
Der zweite Mann ritt auf einem Kastanienbraunen mit weißen Vorderfesseln und trug die Reste einer Südstaatenmontur. An seiner grauen Hose waren deutlich die gelben Streifen auszumachen – und auf dem Kopf hatte er noch die Uniformmütze, eine Kappe mit steifem Lacklederschirm und schräg nach vorn geneigtem Deckel. Man sah, wie der Reiter sein Pferd rücksichtslos anspornte, um nicht noch weiter hinter dem schnellen Rotfuchs zurückzubleiben.
Genau zwischen den beiden Fliehenden wirbelte plötzlich ein Staubwölkchen am Boden auf. Der Knall der Schüsse folgte erst mit merklichem Abstand. Und endlich erschien auch das Rudel der Verfolger in der Geländefalte.
Clay Sheridan kniff die Augen zusammen. Er zählte sieben Mexikaner, die an ihren großen Sombreros, den Charro-Jacken sowie den über der Brust gekreuzten Patronengurten leicht zu erkennen waren. Auch sie forderten ihren Pferden das Letzte ab, um den beiden Flüchtenden den Weg zu verlegen.
Die Kavalkade hinterließ eine wehende Staubfahne, die im Schein der tiefstehenden Sonne golden schimmerte. Von Zeit zu Zeit gab einer der Männer einen Schuss ab, obwohl die Distanz noch zu groß und ein genaues Zielen vom Rücken eines galoppierenden Pferdes aus unmöglich war.
Das Ufer war drüben ziemlich flach, aber das Vorland bedeckten Geröll und größere Steinbrocken. Vom letzten Hochwasser waren morastige Pfützen zurückgeblieben. Angeschwemmte, schlammbedeckte Büsche und Treibholz bildeten am Ende einer Landzunge einen verfilzten Wall. Genau diese Landzunge schienen die beiden Amerikaner erreichen zu wollen, weil nur dort der Boden einigermaßen eben war.
Noch einmal verschwanden sie hinter einem Gebüschstreifen, dann jagten sie in verzweifeltem Spurt auf die freie Fläche hinaus.
Die Mexikaner hielten an. Sie schienen einzusehen, dass sie mit ihrer bisherigen Taktik zu spät kamen. Clay Sheridan war sich nicht sicher, ob er Desperados und Banditen oder republikanische Guerilleros, also Juaristas, vor sich hatte. Im Zweifelsfall existierte da auch kein großer Unterschied.
Südländisches Temperament, romantische Vorstellungen und die fortwährende Unterdrückung und Ausbeutung der mexikanischen Landbevölkerung machten es jedem Desperado leicht, sich als Revolutionär und Kämpfer für die Freiheit aufzuspielen.
Auch der »Colonel« Tonio Zapata, der dieses Gebiet mit seinen Guerilla-Verbänden beherrschte, hatte früher einmal als »edler« Bandit gegolten und wäre vermutlich längst von den gefürchteten Rurales gejagt und aufgeknüpft worden, wenn ihm nicht der Bürgerkrieg zum Range eines »Obersten« verholfen hätte. – Diese Gedanken schossen Clay Sheridan durch den Kopf, als er sah, wie zwei der Mexikaner mit Gewehren das Feuer eröffneten.
Die beiden Amerikaner galoppierten jetzt bereits in das seichte Wasser. Man sah die Fontänen der Geschosseinschläge ganz in ihrer Nähe, doch das Glück war den beiden hold. Die Sprünge ihrer Pferde wurden schwerfälliger, je mehr die Wassertiefe zunahm.
Dann plötzlich geschah es! Der hochbeinige Fuchs bäumte sich auf, als ihm das Wasser schon bis an den Bauchgurt reichte. Ob er schwer getroffen worden war, ließ sich nicht entscheiden. Im letzten Moment warf sich der Reiter aus dem Sattel, während sich das Pferd rückwärts überschlug.
Das gelbe, trübe Wasser des Rio Bravo schäumte, als der verletzte Fuchs wild um sich keilte, unterging und noch einmal auftauchte. Mit verzweifelt gerecktem Kopf wälzte sich das Tier in der Flut. Es mühte sich vergebens, wieder Grund unter die Hufe zu bekommen. Unversehens schien es in eine tiefere Rinne zu geraten, wurde von der Strömung erfasst und weggerissen. Als es unterhalb von Sheridans Standpunkt vorbeigetrieben wurde, kämpfte es mit letzter Kraft gegen das Ertrinken und hielt nur noch mühsam den Kopf über Wasser.
Das Feuer der Mexikaner verstärkte sich. Aus drei Gewehren wurde pausenlos geschossen. Aber die Ziele waren zusammengeschrumpft. Man sah jetzt nur noch die Köpfe des Kastanienbraunen und der beiden Männer. Die Entfernung betrug zweihundert Yards.
Normalerweise hätten die Mexikaner dicht ans Ufer galoppieren und von dort aus der Sache ein Ende bereiten können. Daran wurden sie jedoch durch das Geröll gehindert. Vier von ihnen versuchten, an den Fluss zu gelangen – aber sie mussten auf dem holprigen Grund ihre Pferde im Schritt gehen lassen. Einer von ihnen sprang sogar ab und zerrte den Gaul am Zügel hinter sich her, weil er auf diese Weise fast schneller vorankam als seine Begleiter.
Die beiden Amerikaner hielten sich bei dem Kastanienbraunen und arbeiteten sich schräg durch die Strömung. Der Mann, der seinen Fuchs verloren hatte, schien ein zäher und verbissener Bursche zu sein. Während des Sturzes hatte er ein Gewehr in der Hand gehalten – und auch jetzt hatte er es noch nicht losgelassen, obgleich es ihn sicherlich beim Schwimmen behinderte. Von Zeit zu Zeit sah man den Lauf der Waffe auftauchen.
Zwei der Gewehrschützen hatten inzwischen das Feuer eingestellt und folgten ihren Kumpanen zum Fluss. Ihre Chance war jedoch verpasst! Gerade hatte der Kastanienbraune Grund gefasst. Der Mann mit der alten grauen Uniformkappe hing an seinem Sattel, während sich sein Partner mit dem schwarzen Stetson in die Mähne des Pferdes klammerte.
Triefend stolperten sie ans Ufer. Zwei Kugeln klatschten nahe bei ihnen in den Sand. Und drüben trieb nun auch das Gros der Mexikaner die Gäule in den Fluss. Anscheinend wollten sie die Verfolgung nicht aufgeben. Ihre Überlegung lag auf der Hand: Die beiden Opfer waren jetzt gemeinsam auf ein einziges Pferd angewiesen. Unter diesen Umständen mussten sie rasch einzuholen sein.
Clay Sheridan presste die Lippen zusammen. Es juckte ihn, die Tragweite seines Union-Spencer-Karabiners auszuprobieren, aber gleichzeitig sagte er sich, dass er das vielleicht entscheidende Überraschungsmoment nicht vergeuden durfte.
Gerade sah er den Mann im triefenden Prince-Albert-Rock hinter einem Weidenbusch niederknien und das Gewehr an die Schulter reißen. Der Schuss peitschte auf. Zwischen den Mexikanern spritzte das Wasser von dem Einschlag, und der letzte Gewehrschütze, der sich noch am jenseitigen Ufer befand, duckte sich erschreckt zusammen.
Der Amerikaner repetierte und schien erneut abzudrücken. Diesmal folgte kein Knall. Wenn man mit dem Gewehr in der Hand den Rio Bravo durchschwamm, war es natürlich reine Glückssache, ob die Munition noch intakt war. Die eine Patrone funktionierte, die andere versagte. Die Mexikaner hatten diesem Umstand Rechnung getragen und hielten ihre Waffen in die Höhe. Sie blieben selbst dann noch im Sattel, als ihre Pferde ebenfalls schwimmen mussten.
Mit einem wilden Satz schnellte der Amerikaner hinter dem Busch hervor und rannte seinem Partner nach, der gerade auf dem Kastanienbraunen zwischen das Gestrüpp und die Felsbrocken des Arroyos jagte. Unaufhaltsam und in einer langgezogenen Kette kamen die Verfolger über den Fluss. Sie hatten eine der zahlreichen Sandbänke erwischt, und schon nach kürzester Zeit hoben sich ihre Pferde wieder aus dem Wasser und trabten zu einer Gruppe von Cottonwoods und Espen.
Nur einer von ihnen, der Nachzügler, hatte Pech und wurde von der Strömung weitergetrieben, sodass er erst hundertfünfzig Yards unterhalb auf festen Boden gelangte. Gerade er schien entschlossen, die beiden Gringos in der Flanke zu fassen, und jagte von der Seite her auf die Mündung des Arroyos zu.
Clay Sheridan erkannte die Gefahr, stürmte zu seinem Wallach zurück und schwang sich in den Sattel. Durch die Kronen einiger Walnussbäume gegen Sicht geschützt, lenkte er das Pferd dicht vor den Klippen hangabwärts und ritt durch eine Mulde voller Felstrümmer und Dornengestrüpp bis zum nächsten Kamm. Dort ließ er Yank, den Wallach, mit schleifenden Zügeln stehen und arbeitete sich über bröckelndes Gestein weiter zu dem Arroyo hinüber.
Er war gerade neben einem grauen Felsbrocken angelangt, als drüben ein Gewehrschuss krachte. Ein Pferd wieherte schrill, und irgendwo in diesem zerklüfteten Gelände schrie eine helle, kehlige Stimme Befehle in spanischer Sprache.
Mit wenigen Sprüngen umrundete Clay Sheridan auch das letzte Hindernis. Zuerst sah er das ledige Sattelpferd, das mit wild pendelnden Bügeln zum Fluss zurückgaloppierte und dort von einem der Mexikaner eingefangen wurde. Dann bemerkte er auch die Gestalt, die neben einem Strauch von Stachelbirnen verkrümmt und reglos auf der Seite lag. Einer der Bravos hatte seine überstürzte Verfolgung mit dem Leben bezahlt.
Drei seiner Compañeros rannten bereits zu Fuß in das Gestrüpp, das sich von drüben her bis an die weite, ebenfalls von Geröll und Felstrümmern übersäte Mündung des Arroyos erstreckte.
Die beiden Amerikaner saßen in der Falle. Zwar fanden sie hier überall gute Deckung und konnten sich notfalls auch weiter in die felsige Schlucht zurückziehen, aber irgendwann mussten sie von ihren Gegnern eingekreist werden, zumal sie sich auf ihre Munition nicht mehr verlassen konnten.
Plötzlich schnellte der Mann mit der Uniformkappe aus einer Rinne in die Höhe und riss sein Gewehr an die Schulter. Auf weniger als fünfzig Yards war vor ihm einer der Gegner aufgetaucht. Der Mexikaner warf sich augenblicklich in Deckung, ohne dass ein Schuss gefallen wäre. Wahrscheinlich hatte es schon wieder einen Versager gegeben. Dafür pufften nun an zwei anderen Stellen blaue Rauchwölkchen aus den Scrubwoods. Der Hall der Schüsse brach sich zwischen den geborstenen Wänden des Arroyos und weckte ein rollendes Echo.
Unmerklich hatte die Tageshelligkeit nachgelassen. Eine flammende Wolkenbank lag über dem westlichen Horizont, und der Arroyo mit seinem zerklüfteten Vorgelände war in ein unwirkliches rotes Licht getaucht.
Clay Sheridan glitt geduckt vorwärts. Einer der Mexikaner war tot, ein anderer befand sich unten bei den Pferden. Er hatte es also mit fünf Desperados zu tun. Wenn es ihm gelang, sie in der Flanke zu fassen, konnte er hoffen, sie in die Flucht zu schlagen. Seine Stärke bestand darin, dass sie von seinem Vorhandensein keine Ahnung hatten. Sheridans Ziel war ein großer Felsbrocken am Rand des Gestrüpps.
Wieder krachten Schüsse, noch ehe er dort angelangt war, und aus dem Arroyo klang das langgezogene, zornige Brummen eines Querschlägers. Gerade als Sheridan sich mit unterdrücktem Fluchen von einer Dornenranke befreite, die sich in seiner Buschjacke verfangen hatte, bemerkte er die Bewegung oben am Felsrand.
Der Angriff durch das Gestrüpp war demnach ein Ablenkungsmanöver gewesen, um die beiden belagerten Amerikaner so lange zu beschäftigen, bis einer der Bravados sich dort oben eine beherrschende Stellung verschafft hatte.
Aus dieser Höhe konnte er den vorderen Teil des Arroyos bestreichen, und es sah so aus, als befände er sich bereits im Rücken der beiden Opfer. Er schob sich vorsichtig bis zu einer überhängenden Felskanzel, stockte dort unvermittelt und hob langsam das Gewehr; fast wie ein Jäger, der bisher unentdeckt geblieben war und nun ein Wild aufs Korn nehmen will, ohne durch eine hastige Bewegung dessen Aufmerksamkeit zu erregen.
Clay Sheridan riss seinen Karabiner an die Schulter. Der Union-Spencer bellte hart und schmetternd. Der Bursche auf dem Felsrand begann zu schwanken. Zuerst polterte sein Gewehr herab, dann folgte der Mann selbst, klatschte gegen die steil abfallende Wand, überschlug sich wie eine verrenkte Gliederpuppe und verschwand in einem Kakteengestrüpp auf der Sohle des Arroyos.
Aus den Scrubwoods ertönte ein überraschter Schrei. In Sheridans Nähe feuerte jemand kopflos mit dem Revolver in die Büsche, kaum dass der Knall des Karabiners verhallt war. Clay Sheridan hechtete dicht an den großen Felsbrocken und wirbelte mit der Linken einen seiner Navy-Colts heraus, der im Nahkampf eine beweglichere und wirkungsvollere Waffe war. Auch an einer anderen Stelle knackte es im Gestrüpp.
Derselbe Desperado, der sich vorher in Deckung geworfen hatte, versuchte nun, eine freie Fläche zu überqueren. Er prallte in tödlicher Überraschung zurück, als er sich plötzlich Sheridan gegenübersah. Clay Sheridan hatte den Revolver erhoben, zögerte aber noch mit dem Schuss. Ganz deutlich sah er, wie die Augen des Mannes hervorquollen, wie sich sein Mund öffnete und er sein Gewehr fallen ließ, um sich zu ergeben.
In diesem Moment krachte es von der Mündung des Arroyos her. Der Mann mit dem schwarzen Stetson war hinter einem Steinbrocken aufgeschnellt, und diesmal hatte sein Gewehr nicht versagt. Der Mexikaner taumelte, als ihn die Kugel von der Seite her traf.
Er schien noch etwas sagen zu wollen und hob in einer beschwörenden Geste die Hände, aber dann verließen ihn die Kräfte, und er sank schlaff in sich zusammen.
Clay Sheridan presste die Zähne aufeinander und fuhr herum. Wieder setzte das Knacken und Prasseln in den Scrubwoods ein. Etwa siebzig oder achtzig Yards entfernt erkannte er Gestalten, die rennend und stolpernd der Baumgruppe am Fluss zustrebten.
Erst ein Keuchen machte ihn darauf aufmerksam, dass der Amerikaner mit dem flachen Stetson neben ihm angelangt war. Das scharfgeschnittene Gesicht des Mannes verzerrte sich zu einer von Hass entstellten Grimasse, als er über den Lauf seines Sharps-Gewehrs spähte, kurz visierte und abdrückte. Doch es löste sich kein Schuss. Nur ein leichtes metallisches Klicken zeigte an, dass der Schlagbolzen der Waffe auf eine taube Patrone getroffen war.
»Verdammt – so schießen Sie doch, Mister!«, fuhr der Bursche ihn an. »Jetzt zeigen wir es diesen Greaser-Bastarden! Oder wollen Sie sie etwa über den Fluss entkommen lassen?«
Mit verschlossener Miene senkte Clay Sheridan seinen Karabiner.
»Die werden Ihnen nicht mehr gefährlich, Freund«, versetzte er rau. »Außerdem scheinen Sie zu vergessen, dass dies nicht mein Kampf, sondern Ihrer ist!«
Die Mexikaner waren bereits zwischen den Cottonwoods verschwunden. Gleich darauf kamen sie wieder zum Vorschein. Von der Canyonmündung her krachte nochmals ein Schuss, der jedoch keinen Schaden anrichtete.
Die Bravados galoppierten ein Stück am Ufer entlang und ritten dann ins Wasser. Die ledigen Sattelpferde ihrer getöteten Compañeros zogen sie mit.
Das Gesicht des Mannes in dem durchnässten, triefenden Prince-Albert-Rock war verkniffen, als er sich erneut Clay Sheridan zuwandte:
»So – es ist also nicht Ihr Kampf? Aber Sie sind sich hoffentlich darüber im Klaren, dass die Greaser bald mit Verstärkung zurückkommen werden. Wölfe dieser Art jagen immer in großen Rudeln.«
Mit einem Wink des Kopfes deutete Clay Sheridan zum westlichen Horizont, wo sich die wilden, flammenden Farben des Sonnenuntergangs allmählich zu einem satten Violett verdichteten.