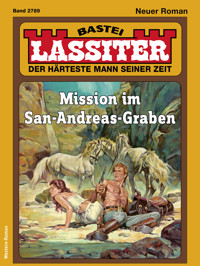1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nachdem der schillernde Staradvokat Charles Gulbranson, Verteidiger des korrupten Präsidentschaftskandidaten Jack Tover, einem heimtückischen Mord zum Opfer gefallen ist, beauftragt die Brigade Sieben Lassiter mit der Suche nach dem Mörder. Dem Vernehmen nach wurde Gulbranson von Sallie Winslow ermordet, der Schwester seiner Geliebten Anne Winslow, die es auf eine Sammlung wertvoller Gewehre abgesehen haben soll. Um an die berüchtigten Winslow-Schwestern heranzukommen, die in North Dakota eine Viehranch besitzen, muss sich Lassiter gegen seinen Willen mit der Agentin Carolyn Sparrow zusammentun, die er von einem früheren Auftrag kennt. Das Paar gibt sich als Immigrantenfamilie aus und nimmt Sparrows Ziehsohn Thomas zu sich. Bald gerät die vermeintliche Familie in den mörderischen Kampf konkurrierender Viehbarone - und Carolyn Sparrow in tödliche Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Zwei Schwestern schießen scharf
Vorschau
Impressum
Zwei Schwestern schießen scharf
von Marthy J. Cannary
Fünfzigtausend Pfund hatte Bill Reiley auf Tover gesetzt, siebzehntausend Cockley, elftausend Bracks und generöse sechzigtausend der alte Fellowman. Sie hatten in seinem Büro gesessen, die edlen Magnolia-Zigarren geraucht, die von N.L. Hansen in Amsterdam kamen, und waren mitunter bis spät hinein in die Nacht geblieben. Manchmal war Tover selbst erschienen, hatte seinen aufgedunsenen Leib in einen der Sessel gewuchtet und sich stundenlang über die Lage Nordamerikas echauffiert.
Nicht ohne Stolz zählte Charles Gulbranson die Dollarnoten. Er hatte seinen Profit zu vier stattlichen Stapeln aufgeschichtet, die er jetzt mit der Ehrfurcht eines Mannes betrachtete, den unverhofft ein gutes Schicksal ereilt hatte.
Bei Tovers erster Präsidentschaftsbewerbung hätte kein Zeitungsjunge auf den ordinären Schreihals aus Illinois gewettet, nun gaben sich die angesehensten Herrschaften der Stadt die Klinke in die Hand. Sie wollten Tover auf dem Präsidentensessel sehen. Darin lag der entscheidende Unterschied zu dessen Bewerbung vor acht Jahren.
»Sind Sie zufrieden?«, fragte Gulbransons Sekretär Daniel Rockney. Er arbeitete bereits seit zehn Jahren für das Gulbranson-Büro. »Man wird Sie künftig überall als Advokat zu Rate ziehen. Ich hörte, dass Mr. Brink und Mr. Sethhard äußerst beeindruckt von Ihren Leistungen seien.«
Gulbranson war geschmeichelt. »Tover ist noch nicht frei, Mr. Rockney. Die Lorbeeren gebühren demjenigen, der diesen Bastard aus dem Gefängnis holt. Er hat fast siebentausend Dollar dafür eingestrichen, dass er die Maystad Lumber Company in seiner Senatsrede in gutes Licht rückt.« Er zuckte mit den Schultern. »Ich hätte ein Urteil gegen ihn befürwortet, hätte er nicht mich mit seiner Verteidigung beauftragt.«
Die Präsidentschaftskandidatur von Jack Tover war ein heilloses Wirrwarr gewesen, bevor Gulbranson die Fäden in die Hand genommen und jeden von ihnen sorgsam entwirrt hatte. Auf seinen Rat hin wurde Tovers engster Berater entlassen, einige Männer als Redenschreiber engagiert und das Gerücht entkräftet, dass Tover im Bürgerkrieg auf der Seite der Yankees und der Konföderierten zugleich gekämpft hätte. Die meisten Menschen in North Carolina und British Columbia, die mit Gulbranson gesprochen hatten, konnten sich inzwischen vorstellen, den Raufbold-Kandidaten aus Illinois zum Präsidenten zu wählen.
»Mr. Tover bedeutet Ihnen nichts«, hielt Rockney trocken fest und hob angestrengt die Schultern. Mit dieser Geste pflegte er ein unangenehmes Gespräch zu beginnen. »Ich muss Ihnen sagen, dass Mr. Tover darüber nicht allzu erfreut ist. Er hat in der Zelle getobt und gewütet, als er von Ihrer Haltung erfahren hat.« Er seufzte leise. »Er will Sie des Mandates entbinden, Mr. Gulbranson.«
Gelassen griff Gulbranson nach seiner Teetasse und trank sie auch. »Nie und nimmer wird er das Mandat beenden. Er weiß ebenso wie ich, dass es niemanden dort draußen gibt, der mir das Wasser reichen kann. Er würde unter Skandalen verschüttet, würde ich auspacken.« Er lächelte und sah seinen Sekretär an. »Von Tover haben wir am wenigstens zu befürchten.«
Die eleganten Empfänge in den Herrenhäusern der Hauptstadt, die geschwinden Droschken auf den Avenues, die anerkennenden Worte eines jeden Senators, der ihm begegnete, auf diese Annehmlichkeiten wollte Gulbranson nicht mehr verzichten. Er hatte sich emporgearbeitet, von einem subalternen Angestellten des Justizministeriums zum bekanntesten Anwalt von Washington D.C. Der Herald hatte mit einem gewissen Neid über Gulbranson geschrieben, dass dieser von den Hügeln des Dakota-Territoriums gekrochen wäre, um Washington in Unruhe zu versetzen.
Bei dem Gedanken an diese Zeilen musste Gulbranson lächeln.
Zum einen bestand das Dakota-Territorium mitnichten allein aus Hügelland, zum anderen bekräftigte Gulbransons Karriere die Magie des amerikanischen Traumes, die jedem zu Ruhm verhalf, der sich nur entsprechend ins Zeug legte. Die Verteidigung von Jack Tover, der mittlerweile der aussichtsreichste Kandidat der im November anstehenden Präsidentschaftswahlen war, brachte ihm, dem Fremden aus dem Dakota-Territorium, ein Renommee ein, das er sich noch vor einem Jahr nicht zu erhoffen gewagt hatte.
»Ich gehe schlafen, Mr. Rockney.« Gulbranson gähnte und stand auf. »Die nächsten Tage bringen Arbeit für uns. Die Senatstermine, der Gerichtshof, der Tover-Abend.«
»Alles vermerkt und organisiert!«, erklärte Rockney und hielt Gulbranson das Notizbuch hin. »Ich wünsche Ihnen eine friedliche Nacht, Sir. Die Aufregung um Mr. Tover wird sich morgen zerstreut haben.«
»Davon gehe auch ich aus«, erwiderte Gulbranson und kehrte Rockney den Rücken zu. Er brachte seine Teetasse zur Anrichte, sah nach einem Buch im Regal, das er in den kommenden Tagen lesen wollte, und steuerte auf die hintere Tür des Salons an. »Stellen Sie bitte sicher, dass ich –«
Mitten im Satz durchfuhr Gulbranson ein stechender Schmerz.
Der Rechtsanwalt glaubte zunächst, dass ihm das Herz in der Brust stillstand, griff sich an selbige und fasste in die blutige Spitze eines Dolches. Als er an sich herunterblickte, verschwand die Dolchklinge wieder in seinem Körper, als sie ihm jemand aus dem Rücken zog. Er sah Blut rinnen, dickes Blut auf dem Seidenstoff seines Hemdes, und die Beine sackten ihm weg.
Ohne einen Ton kippte Gulbranson vornüber auf den Teppich und schlug mit dem Schädel gegen den Fuß der Anrichte. Er schmeckte einen Schwall Blut im Mund, spie ihn aus und holte tief Luft, was zu einem heiseren Röcheln führte.
Dann traf Gulbranson ein zweiter und dritter Stich.
✰
Vor den vierstöckigen Fabrikationshallen der Sioux City Linseed Oil Works, die von einem Meer aus glänzenden Eisenbahnschienen umgeben waren, hielten die Fuhrwerke und wurden entladen. Sie brachten die Frachtsäcke des Dampfers Kingsley, mit dem auch Lassiter den Missouri River hinaufgefahren war. Die Ölwerke zählten zu den größten Leinölwerken Amerikas und wurden von einem Mann geführt, der seit siebzehn Jahren für die Brigade Sieben als Mittelsmann arbeitete.
Douglas Jacobson war hochgewachsen und hatte die Ausstrahlung eines Stierkämpfers, der auf das Erscheinen des Bullen wartete. Er stand mit leicht gespreizten Beinen und gefalteten Händen in der Mitte seines Büros, scheuchte seine Sekretärin heraus und wies Lassiter ungeduldig einen Platz auf der Sitzgarnitur zu, die in einer Ecke des Raumes stand.
»Mr. Jacobson«, grüßte Lassiter und setzte sich. Er wusste, dass seine Ankunft vom Hauptquartier per Telegramm gemeldet worden war. »Ich freue mich, dass Sie so rasch Zeit für mich finden.«
Jacobson setzte sich ebenfalls, lehnte sich aber sogleich nach vorn, als wollte er wieder aufspringen. »Die Zeit ist in der Tat ein wertvolles Gut für mich. Ich werde noch in dieser Nacht in unser Büro nach St. Louis aufbrechen, wollte Sie jedoch über den Auftrag informieren, den wir für Sie vorbereitet haben.«
Dem Telegramm aus dem Hauptquartier war nur zu entnehmen gewesen, dass Jacobson Lassiter in einer dringenden Angelegenheit sprechen wollte, bei der es um den Präsidentschaftskandidaten Jack Tover ging. »Ich darf annehmen, dass Sie mit mir über Tover sprechen wollen.«
Der Wahlkampf des Mannes aus dem Dakota Territorium war turbulent verlaufen, nicht zuletzt durch die zahlreichen Ausfälle und Beleidigungen, die Tover in den Schlagzeilen der großen Wochenzeitungen gehalten hatten. Vor einer Woche hatte Tover den beliebten Senator McCarney als »feigen Yankee« beschimpft, in den Monaten davor war er mit einem Dutzend Prostituierten erwischt worden, die mit ihm auf einem Kanonenboot der US-Army, das im Potomac vor Anker lag, gefeiert hatten. Die Zeitungen waren sich einig, dass Tover das Land nicht regieren durfte.
»Tover.« Jacobson nickte seufzend. »Ich muss Ihnen nicht sagen, wie ich über diesen ordinären Schreihals denke, der alles Lügen straft, wofür Amerika im Grunde steht. Vor einigen Tagen ist jedoch Tovers Anwalt Charles Gulbranson ermordet worden. Die höhere Gesellschaft von Washington D.C. ist seither in Aufruhr.«
Ein Richter in Washington D.C. hatte Tover vor einigen Wochen in Gewahrsam nehmen lassen, nachdem er bei einer Senatsrede die Maystad Lumber Company in einer Weise hervorgehoben hatte, dass man es ihm als Beeinflussung einer Kammer des Kongresses ausgelegt hatte. Die ganze Angelegenheit war dadurch pikanter geworden, dass Tover einen nicht unerheblichen Aktienanteil an der Maystad Lumber hielt.
»Man hat das Justizministerium regelrecht bedrängt«, fuhr Jacobson fort und zog dabei eine trübe Miene. »Dieser Mann scheint überall Freunde zu besitzen. Das Ministerium verlangt von der Brigade Sieben, dass der Mörder rasch und ohne großes Aufsehen gefunden wird.«
Lassiter sah Jacobson verständnislos an. »Im Dakota-Territorium? Tover kommt aus British Columbia, Gulbranson aus Boston. Sie dürften mit diesem Teil des Landes kaum Verbindung haben.«
»Sie haben Bedürfnisse«, widersprach Jacobson. »Eine dieser sündhaften Vergnügungen hört auf den Namen Anne Winslow, die einige Meilen nördlich der Black Hills eine Ranch besitzt. Sie war Gulbransons letzte Geliebte, seit er vor einigen Monaten im Dakota-Territorium für Tover den Wahlkampf organisiert hat.«
Das Dakota-Territorium erschien Lassiter als kaum geeigneter Ort für eine Romanze. »Mrs. Winslow soll Gulbranson ermordet haben?«
»Miss Winslow«, sagte Jacobson und trommelte mit den Fingerspitzen einer Hand gegen die der anderen. »Sie ist nicht verheiratet und lebt mit ihrer Schwester Sallie auf der Ranch. Der Ruf dieser beiden Frauen ist ...« Er verstummte und suchte nach Worten. »Er ist ... schlecht. Man sagt ihnen nach, dass sie mit leichtem Gewerbe Dollars machten und sich als Viehdiebinnen versucht hätten. Ich kann nichts davon prüfen. Uns stehen kaum Leute im Dakota-Territorium zur Verfügung.«
Das Dakota-Territorium wurde vom Reservat der Sioux durchschnitten und war bis auf wenige Forts der US-Army dünn besiedelt. Die Brigade Sieben hatte nur mit Mühe Informanten in diesen Kreisen rekrutieren und noch weniger Agenten ausbilden können.
»Sie müssen sich eines Tricks bedienen«, meinte Jacobson und holte ein Kuvert von seinem Schreibtisch. Er reichte Lassiter den Umschlag und schwieg, bis dieser ihn aufgerissen hatte. »Das Hauptquartier erwartet von Ihnen, dass Sie mit Carolyn Sparrow zusammenarbeiten. Sie hat einen Sohn, der sie begleitet. Sie und Miss Sparrow werden eine Siedlerfamilie bilden, die den Winslow-Schwestern zwei Rinder anbieten wird.«
»Carolyn Sparrow?« Lassiter hielt mitten in der Bewegung inne. Er kannte Miss Sparrow von einer Mission in Wyoming, die gehörig schiefgegangen war. »Ich wollte nicht wieder mit Miss Sparrow arbeiten. Sie ist unzuverlässig und keine talentierte Agentin.«
Der Direktor pflichtete ihm mit eiligem Nicken bei. »Sie ist eine furchtbare Agentin. Aber gegenwärtig gibt es keinen Ersatz für sie.« Er musterte Lassiter eine Zeitlang. »Darüber hinaus hatte, glaubt man dem Hauptquartier, Miss Sparrow eine Schwäche für Sie.«
Nichts hätte Lassiter in diesem Augenblick unangenehmer sein können, als an die Affäre mit Carolyn Sparrow erinnert zu werden, die ihn fast Kopf und Kragen gekostet hätte. Er war mit Carolyn fast einen ganzen Monat auf der Jagd nach einer Horde Bankräuber gewesen, die sich in den Rocky Mountains herumgetrieben hatte. Die Affäre hatte der Bande immer wieder die Flucht ermöglicht.
»Diese Tage liegen hinter mir.« Lassiter blätterte das Kuvert durch und hielt mit einem eine Kohlezeichnung von Carolyn in der Hand. Sie hatte dem Zeichner das Gesicht halb zugewandt und sich die kastanienbraunen Haare hinters Ohr gesteckt. »Ich werde nicht zulassen, dass diese Frau eine weitere Mission verdirbt.«
»Davon wollen und müssen wir ausgehen«, sagte Jacobson und deutete auf das Kuvert. »Sie finden alle nötigen Abrechnungen, Schuldscheine und Empfehlungsschreiben darin, um sich mit dem Equipment einer Siedlerfamilie in Sioux City auszurüsten. Die Händler werden Ihnen hervorragendes Material geben und Sie mit einem Siedlerwagen ausstatten, dem man die lange Reise von der Ostküste ansieht.« Er lächelte schmal. »Sie müssen sich nur mit Miss Sparrow ins Benehmen setzen.«
✰
Der pechschwarze Qualm, der aus den Schloten der Tidrick stieg, hatte auf den Decks des Schaufelraddampfers eine dünne Rußschicht hinterlassen. Die meisten Passagiere schritten über den Schmutz hinweg, ohne ihm die geringste Beachtung zu schenken, und eben diese Missachtung kam Thomas Sparrow wie ein Frevel vor. Der achtjährige Junge hockte auf dem Vorderdeck und zeichnete mit einem Stock ein Koordinatennetz in den Ruß. Er trug Sioux City ein, das im unteren Teil des Netzes lag, und das gewaltige Reservat des Sioux-Stammes, das sich darüber erstreckte. Nach einer Weile hatte er auch die Forts der US-Army eingetragen, die er mit einem kleinen Sternwimpel kennzeichnete.
»An Ihrem Sohn ist ein Künstler verloren gegangen.« Kapitän Arthur Ross lachte dröhnend und trat mit Thomas' Mutter Carolyn an die Reling. Sie blickten zu den Häusern von Sioux City hinüber, deren Zahl sich nach der letzten Biegung des Missouri River vergrößert hatte. »An Ihrer Stelle würde ich ihn auf eine vernünftige Schule schicken.«
Als er diese Worte hörte, warf Thomas das Stöckchen aus der Hand, lief zu seiner Mutter und umschloss sie mit beiden Armen. Er vergrub das Gesicht in dem fliederfarbenen Seidenstoff, aus dem ihr Kleid genäht war. »Hör nicht auf den Käpt'n, Mutter! Ich will in keine Schule! Schon in gar kein Internat!«
Vor zwei Tagen hatte seine Mutter von einem Internat in St. Louis gesprochen, einer vornehmen und gut ausgestatteten Einrichtung, die Ziehkinder wie ihn mit Vorliebe aufnahm. Thomas' Mutter hatte über die Lehrer und die Schule geredet, als wäre Thomas' Aufnahme schon beschlossene Sache.
»Keine Sorge.« Seine Mutter schaute Thomas an. Sie hatte ein fein geschnittenes, von dunkelbraunem Haar umrahmtes Gesicht, dem man das Alter kaum ansah. Thomas war gewöhnt daran, dass seine Mutter von allerlei Verehrer umworben wurde. »Noch lasse ich dich nicht gehen, Thomas. Aber wir müssen über deine Zukunft nachdenken.«
Nachdem der Kapitän auf die Brücken zurückgekehrt war, schlenderte Thomas mit seiner Mutter an die Bugspitze. Sie sahen nach den mächtigen, stählernen Ankern, deren Spitzen im Wasser schleiften, und winkten den Fuhrwerken am Ufer zu. Thomas war bedrückt und hatte keine rechte Freude daran. »Wen treffen wir in Sioux City? Warum mussten wir so rasch aufbrechen?«
Der Junge kannte die geheime Organisation, für die seine Mutter arbeitete und derentwegen er zu fortwährendem Schweigen verpflichtet war. Er durfte keinem Freund gegenüber prahlen, dass seine Mutter eine Agentin im Auftrag der Regierung war, geschweige denn von ihrer letzten Mission berichten. Oft traf sich seine Mutter mit zwielichtigen Persönlichkeiten, Männern in grauen Anzügen, die Revolver unter den Jacketts trugen, oder Kerle mit hängenden Augenlidern, denen man die Verschlagenheit auf den ersten Blick ansah.
Nie hatte Thomas einen Gedanken daran verschwendet, dass seine Mutter nicht die Frau war, aus deren Schoß er gekommen war. Er hatte Carolyn im Alter von drei oder vier Jahren kennengelernt, hatte von seiner wahren Mutter allenfalls noch eine vage Vorstellung, die von Jahr zu Jahr stärker verblasste. Seine Ziehmutter hatte ihn im Gegenzug nie spüren lassen, dass sie ihn nur bei sich aufgenommen hatte.
»Einen wichtigen Mann«, sagte seine Mutter und war ins Grübeln versunken, wie Thomas es von ihr kannte. Sie dachte den lieben langen Tag nach. »Ein Mann, der deinen wahren Vater kannte.«
Von seinem Vater kannte Thomas nur den Namen, der seltsam ausländisch klang, fast wie ein Schiff aus Übersee. Der Junge hatte ihn einmal auf einem Briefkuvert gesehen, das seine Mutter aus Boston erhalten hatte, und sich die Schreibweise eingeprägt. Eine Woche zuvor hatte seine Mutter ihm mitgeteilt, dass jener Mann, der sein Vater sein sollte, ermordet worden wäre.
Charles Gulbranson.
»Meinen Vater?«, wiederholte Thomas und zog die Stirn in Falten. »Mr. Gulbranson? Den toten Mr. Gulbranson?«
Die Tidrick glitt auf die Docks von Sioux City zu und gab ein Signal mit dem Nebelhorn aus. Der tiefe, brummende Ton schallte von den Häusern am Ufer zurück. Carolyn machte ein gequältes Gesicht und beugte sich zu Thomas herunter. »Genau dieser Mr. Gulbranson, mein Kleiner. Ich muss mich mit diesem Mann treffen, um den Mord aufzuklären.«
Allzu viel verstand Thomas von den Geschäften nichts, die seiner Mutter nachging, und daher erlahmte sein Interesse meist nach den ersten beschwichtigenden Worten. An diesem Morgen jedoch lauschte er so aufmerksam, dass seine Mutter den Blick nicht von ihm abwandte. Er spürte tief im Herzen, dass etwas von Bedeutung vor sich ging. »Wirst du mich verlassen? Wirst du mich alleinlassen müssen, Mutter?«