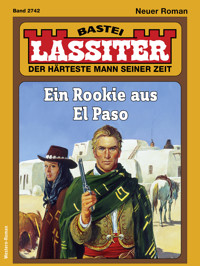1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ihre Augen, groß und rund, wollten dem gerade noch so zierlichen Köpfchen entfliehen, während ihre Hautfarbe von Porzellan zu reifem Mohn und am Ende zum Grau von Pottasche wechselte. Es dauerte länger, als er erwartet hätte, bis die widerspenstige junge Seele sich endlich ihrem Schicksal ergab und Ruhe einkehrte unter dem stählernen Griff seiner Hände, die sich um ihren Hals geschlossen hatten. Erst als er losließ, hörte er sein eigenes Keuchen, spürte sein rasendes Herz. Doch der leise Applaus, den er darüber hinaus zu vernehmen glaubte, konnte nur ein Streich sein, den ihm ein vorwitziger Teil seines verwinkelten Geistes spielte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Der Totengräber von Baton Rouge
Vorschau
Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen?
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsbeginn
Impressum
DerTotengräber von Baton Rouge
von Kolja van Horn
Ihre Augen, groß und rund, wollten dem gerade noch so zierlichen Köpfchen entfliehen, während ihre Hautfarbe von Porzellan zu reifem Mohn und am Ende zum Grau von Pottasche wechselte. Es dauerte länger, als er erwartet hätte, bis die widerspenstige junge Seele sich endlich ihrem Schicksal ergab und Ruhe einkehrte unter dem stählernen Griff seiner Hände, die sich um ihren Hals geschlossen hatten.
Erst als er losließ, hörte er sein eigenes Keuchen, spürte sein rasendes Herz. Doch der leise Applaus, den er darüber hinaus zu vernehmen glaubte, konnte nur ein Streich sein, den ihm ein vorwitziger Teil seines verwinkelten Geistes spielte.
»Was für ein Armutszeugnis stellen sich unsere Truppen nun wieder aus?« Der Mann mit der Stirnglatze und einem Schnauzbart, der wie ein Vorhang aus Haar fast den ganzen Mund verbarg, senkte die Zeitung und starrte Lassiter so missbilligend an wie ein Schulmeister gelangweilte Pennäler. Aber auffordernd genug, damit der Mann der Brigade Sieben sich bemüßigt fühlte, wenigstens fragend die Brauen zu heben.
»Dieser Howard bekommt die Nez Percé einfach nicht in den Griff. Lässt sich regelrecht vorführen von den Rothäuten«, informierte ihn sein Gegenüber in resigniertem Tonfall. »Mir war von vornherein klar, dass man sich keinen Gefallen tat, als man ihm die Verantwortung für den Militärdistrikt Columbia übertrug. Ein halber Pfaffe als General? Da halte ich es mit seinem Vorgesetzten McDowell – Soldatisches und Philanthropisches muss man strikt auseinanderhalten. Der wollte die Wilden umarmen, da darf man sich nicht wundern, wenn sie einem das Ohr abbeißen. Nun gab's die dritte Niederlage auf dem Schlachtfeld in Folge. Ist das denn die Möglichkeit?«
»Wenn es im Herald steht, würde ich nicht unbedingt darauf wetten«, erwiderte Lassiter wenig interessiert, nachdem er den oben auf der Titelseite prangenden Namen der Zeitung zur Kenntnis genommen hatte.
»Und doch steht zu befürchten, dass es der Wahrheit entspricht. Die Wahl fiel auf Howard, weil er mit Cochise Frieden schloss. Nur um welchen Preis, frage ich Sie?« Der Mann mit dem kahlen Schädeldach fuhr sich über eben jenes und schien mit keiner Antwort zu rechnen, denn er schüttelte leicht den Kopf und redete weiter. »Warum überhaupt verhandeln? Die Indsmen haben sich an Gesetze zu halten und zu nehmen, was man ihnen zuteilt.«
Erleichtert registrierte Lassiter den Pfiff der Lokomotive, der die baldige Ankunft des Zuges im Bahnhof von Baton Rouge ankündigte. Politische Diskussionen mit Rassisten, deren einzige Begegnung mit Indianern vermutlich im Rahmen einer Show von Bill Cody stattgefunden hatte, waren ermüdend und sinnlos.
Er erhob sich und langte nach seiner Reisetasche. Dabei stand er kurzzeitig dicht vor seinem Mitreisenden, mit gespreizten Beinen, und der Blick hinab ließ ihn direkt in dessen vorwurfsvoll geweitete Augen schauen.
»Haben Sie dazu denn so gar keine Ansicht, Sir?«
Lassiter schnappte sich die Tasche und danach sein Scabbard mit der Winchester, ehe er dem Gent zunickte und antwortete: »Selbst wenn, zwingt mich nichts, diese mit Ihnen zu teilen. Leben Sie wohl.«
Sekunden später befand er sich bereits auf dem Gang, versuchte, dem unweigerlich entstehenden Gedränge dort zuvorzukommen, sobald der überfüllte Zug vor dem Bahnsteig von Baton Rouge zum Stehen kommen würde. Als Vielreisender wusste er um das immer gleiche Verhalten der anderen Passagiere. Also stand er bereits vor der Tür des Wagens, als die Lokomotive Halt machte und das Tohuwabohu begann. Abteiltüren wurden aufgerissen, man rempelte, drängelte und fluchte in der Enge des Ganges, während Lassiter dies alles mit einem beherzten Sprung hinaus auf den Bahnsteig hinter sich ließ. Allerdings war auch hier viel los; schließlich würde der Zug in Bälde weiterfahren nach New Orleans. Auch der Mann der Brigade Sieben wurde dort erwartet, um als Zeuge bei einem Prozess auszusagen. Allerdings erst in zehn Tagen, weshalb er die Wartezeit lieber hier nutzen wollte, um eine alte Freundin zu besuchen.
Er hatte Heather Grimes seit Jahren nicht mehr gesehen, aber kürzlich von ihrem Umzug nach Baton Rouge erfahren, als er in Memphis bei gemeinsamen Bekannten gewesen war. Heathers Abschied war überstürzt verlaufen, und niemand wusste so recht, was sie dazu bewogen hatte. Also hatte der Mann der Brigade Sieben beschlossen, seiner tief verwurzelten Neigung nachzugeben, ungelösten Rätseln auf den Grund zu gehen und Heather einfach selbst zu fragen.
Die Adresse befand sich nicht unbedingt in einer Nobelgegend, eher das Gegenteil war der Fall. In der Pine Street fand sich kein einziger Nadelbaum, dafür umso mehr Kneipen, Absteigen, Stundenhotels und nach altem Fett stinkende Imbisse, in denen lokale Spezialitäten feilgeboten wurden, für die es einen robusten Magen und möglichst verkümmerte Geschmacksnerven brauchte.
Lassiter überprüfte noch einmal die hastig hingeworfenen Daten auf dem Zettel in seiner Hand, als er vor einem windschiefen Bau stand, der eingezwängt zwischen einer chinesischen Wäscherei und einer Spelunke mit Namen Ruby Bat aussah, als könne er jeden Moment sang- und klanglos in sich zusammenfallen. Dennoch, die Nummer stimmte – Heather hatte sich mit dem Ortswechsel eindeutig nicht verbessert.
Das Treppenhaus hatte keine Tür und war so eng, dass Lassiters Schultern so gerade eben genug Platz fanden, zwischen ihnen und den feuchten Wänden, von denen der Putz großflächig herabgefallen war und sich auf den Stufen verteilte, jedoch kaum mehr als eine Handbreit frei blieb. Auf halber Treppe hockte ein hutzeliges Männchen in der Ecke, die klapperdürren Beine angezogen bis ans eingefallene Kinn, und sog an einer Pfeife. Das blumige Aroma von Opium stieg Lassiter in die Nase, und als er sich näherte, wirkte der Blick, mit dem der Raucher ihn begrüßte, als bestünden seine Augen aus farblosem Glas.
Trotzdem fragte er: »Heather Grimes. Wohnt die Lady hier?«
Der Alte sog die Lippen ein, worauf Lassiter unweigerlich an den Anus einer Katze denken musste. Wortlos nickte der Mann in Richtung der oberen Etagen, bevor er sich die Pfeife wieder in den zahnlosen Mund steckte und sein Gesicht hinter bläulichen Wolken aus Träumen verschwand.
Lassiter zwängte sich an ihm vorbei, und als er die erste Etage erreichte, stellte er fest, dass die Tür zur Wohnung ebenfalls fehlte; bis auf ein paar zersplitterte Überreste, die schief an den Scharnieren hängend zurückgeblieben waren. Deshalb konnte er ungehindert in eine von rußgeschwärzten Wänden und einer niedrigen Decke gefasste Küche blicken. Eine junge Schwarze saß dort in einem Lehnstuhl neben dem Ofen und stillte einen Säugling. Als sie ihn bemerkte, reagierte sie kaum.
»Miss, ich möchte zu Heather Grimes«, sagte Lassiter, ohne die Wohnung zu betreten. »Man hat mir diese Adresse gegeben ...«
Die Schwarze schürzte die Lippen. Lassiter war sich nicht sicher, wie er die Miene einschätzen sollte, von Trotz über Abscheu bis zu Anteilnahme konnte alles passen. »Sie wohnt unter dem Dach«, antwortete die Frau schließlich. »Habse aber schon'n paar Tage nich gesehn.«
Lassiter nickte und tippte sich dankend an die Krempe seines Stetsons, bevor er die nächsten Stufen in Angriff nahm.
Die Wohnung in der zweiten Etage verfügte immerhin über eine Tür, wenn auch ein schartiges Loch in ihr klaffte, deren Aussehen in Lassiter den Verdacht hervorrief, es sei durch ein Beil oder eine Axt entstanden. Das Innere der Wohnung lag aber im Dunkeln, und es war kein Laut daraus zu vernehmen.
Auf dem Weg zu Heathers Mansardenwohnung hinauf begegnete er zwei wohlgenährten Ratten, die ihm vom Treppenabsatz her angriffslustig entgegenstarrten. Eines der Nagetiere hielt eine himmelblaue Haarschleife zwischen den Krallen, was Lassiter die Stirn runzeln ließ.
Er musste bis zur obersten Stufe hinauf und drohend zu einem Tritt ausholen, bis die Ratten sich endlich trollten und in einem faustgroßen Loch in der Fußleiste der Seitenwand verschwanden.
Die Tür zu Heather Grimes Wohnung war nicht nur unbeschädigt, sondern schien auch vor nicht allzu langer Zeit gestrichen worden zu sein, denn das Holz leuchtete in frischem Meergrün und wirkte dadurch wie ein Fremdkörper inmitten dieses heruntergekommenen Gebäudes; fast, als könne man durch sie in eine andere Welt übertreten. Das kleine Holzschild neben dem Türknauf, auf dem der Name der Bewohnerin mit einem heißen Eisen durchaus kunstvoll eingebrannt worden war, beseitigte die letzten Zweifel darüber, ob Heather hier wohnte.
Nun, sie war erst vor drei Monaten weggegangen aus Memphis. Vielleicht stellte diese armselige Unterkunft ja nur eine Übergangslösung dar.
Lassiter klopfte an die Tür – und stellte dabei überrascht fest, dass sie keinen Widerstand bot, sondern unter seinen Fingerknöcheln um einen Zoll nach innen schwang. Die Falten auf seiner Stirn vertieften sich.
»Heather?«, rief er verhalten. »Jemand zuhause?«
Keine Antwort. Das gefiel ihm nicht. Heather war keine Frau, die leichtfertig die Wohnungstür offenstehen ließ, schon gar nicht in einer Gegend wie dieser.
Lassiter stellte seine Reisetasche auf dem Boden ab, lehnte das Scabbard gegen die Wand und zog den Remington aus dem Holster. Mit dem Lauf stieß er die Tür weiter auf und trat in die Wohnung.
Ein kurzer Flur verlief geradeaus unter dem Dachfirst entlang, gerade hoch genug, damit Lassiter nicht den Kopf einziehen musste. Die Tür fünf Schritte voraus war nur angelehnt, und ein schmaler Streifen Licht fiel aus dem Raum dahinter auf einen hübsch gemusterten Läufer zu seinen Füßen. Lassiter sah sein Ebenbild in einem schmalen Spiegel an der rechten Wand, links befand sich eine Garderobe, an der eine Strickjacke, ein leichter Mantel und eine Handtasche hingen.
Mit zwei raschen Schritten durchquerte er den Flur und hörte das Summen bereits, bevor er die Tür aufschob.
»Goddam!«, stieß er hervor, und nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass kein Gegner sich in der kleinen, nur aus einem Raum bestehenden Mansarde befand, rammte er den Remington zurück ins Holster und hielt sich stattdessen die Hand über Mund und Nase.
Denn der Geruch war atemberaubend.
Heather lag mit gespreizten Beinen auf dem Bett, das sich an der Stirnseite des etwa acht mal sechs Yards großen Raums unter einem zweiflügeligen Fenster befand, durch das die Mittagssonne den Raum in ein unbarmherzig helles Licht tauchte. Sie war völlig nackt, und die über der Leiche kreisenden Fliegen deuteten wie die graue, geblähte Haut und der intensive Verwesungsgestank darauf hin, dass sie schon vor Tagen ihren letzten Atemzug getan haben musste.
Lange stand Lassiter mitten im Raum, während die Fliegen summten und er versuchte, den Schock zu verdauen. Erst nach einer Weile war er in der Lage, sich umzusehen und dabei wirklich wahrzunehmen, was seine Augen sahen.
Heathers Wohnung war schlicht möbliert, aber sah man von dem grauenhaften Desaster auf den Laken ab, sauber und ordentlich. Die kleine Küchenzeile rechts unter der Dachschräge war penibel geputzt, Geschirr, Töpfe und eine Pfanne ordentlich auf einem Regal aufgereiht oder an Wandhaken hängend. Nur eine Flasche Wein stand neben dem Waschbecken, außerdem zwei Gläser, das eine davon noch halb gefüllt.
Der Bettvorleger war verrutscht, lag aufgefaltet vorn an der Wand. Auf der anderen Seite des Bettes bemerkte Lassiter einen Kerzenhalter, der zerbrochen auf den Bodendielen neben dem Nachttisch lag. Und natürlich entgingen ihm die dunklen Würgemale nicht, die Heathers Hals verunzierten.
Dennoch war das Zimmer verstörend aufgeräumt angesichts der unverkennbaren Anzeichen dafür, dass hier ein Mord stattgefunden hatte.
Er würde den Marshal rufen müssen, so schnell wie möglich, sonst setzte er sich selbst einem Verdacht aus. Das war Lassiter klar, dennoch wollte er die Zeit nutzen, um selbst Hinweise zu finden, bevor die Behörden von Baton Rouge den Tatort in Besitz nahmen. Mindestens das war er Heather schuldig.
Also trat er näher an das Bett und betrachtete das Gesicht des Opfers, das der Tod auf groteske Weise verändert hatte. Heathers ehemals so schönen Züge waren nicht mehr wiederzuerkennen. Das aufgedunsene Gesicht sah aus wie auf ein Stück Leder aufgemalt und über einen mit Stroh gefüllten Sack gezogen; verzerrt und unförmig, die Augen eingefallene Höhlen, die Wangenknochen so spitz hervortretend, als würden sie durch die dünnen Reste der Haut ins Freie streben.
Doch was war das in ihrem Mund? Lassiter beugte sich vor, sah genauer hin. Streckte schließlich die Hand aus und tastete mit dem Finger die dunkle Substanz ab, bis ihm klar war, worum es sich handelte.
Schwarze Erde. Der Mörder schien Heathers Mund damit gefüllt zu haben, vielleicht bis hinab in den Schlund.
Ihm entgingen auch die Blumen nicht, die in Heathers Scham drapiert worden waren, obwohl sie in den Tagen, seitdem sie dort zurückgelassen worden waren, geschrumpft und vertrocknet waren. Es schien sich um die Überreste weißer Lilien zu handeln.
Als er den Vertigo öffnete und inspizierte, sowie danach auch die Lade des Nachtschränkchens, wurde Lassiter klar, dass Heather offenbar auch in Baton Rouge ihrer hergebrachten Tätigkeit als Prostituierte nachgegangen war. Er fand aufreizende Dessous und knappe Kleider, außerdem einen Vorrat an Kondomen aus Schafdarm in guter Qualität; entweder hatte Heather sie selbst genäht oder einige Dollars dafür ausgegeben, um nicht von einem Freier geschwängert oder mit der Syphilis beschenkt zu werden.
Was ihr der Beruf nun jedoch beschert hatte, war ungleich schlimmer gewesen.
Er fand keinerlei Hinweise auf den Mörder, außer dem makabren Bukett zwischen den Schenkeln und einem Stiefelabdruck auf dem Bettvorleger, den er erst entdeckte, als er den Läufer wieder auseinander- und vor das Bett legte. Auf dem Esstisch neben der Tür zum Flur lag eine Gazette vom vergangenen Freitag, in der auf ein Theaterstück mit dem Titel »Die Jungfrau und der Vampyr« hingewiesen wurde, das in einer Woche in einem Etablissement namens The Tombs Premiere feiern sollte. Heather – oder ihr Mörder – hatte mit einem Stift den Artikel umkreist, außerdem standen zwei hingekritzelte Worte daneben, die Lassiter aber nicht entziffern konnte.
Nach kurzer Überlegung rollte Lassiter die dünne Zeitung zusammen und steckte sie in die Innentasche seiner Langjacke, ehe er die Wohnung verließ und sich auf den Weg zum Marshal's Office begab.
✰
Orchid Mirabelle hatte Angst. Obwohl sie sich alle Mühe gab, dies nicht auf ihren schönen Zügen zutage treten zu lassen. Dabei gab es allen Grund für sie, um ihr Leben zu fürchten. Schließlich waren noch keine zwölf Stunden vergangen, seit es um ein Haar beendet worden wäre. Nicht einmal neunzehn Jahre, nachdem es begonnen hatte.
Ein Seidenschal, den Lizzy Maple ihr geliehen hatte, verbarg die Würgemale, die der Killer an ihrem Hals hinterlassen hatte, doch das Schlucken schmerzte immer noch, und ihre Stimme klang wie die von Norma Roubeaux, der Froschkönigin, die unten die Concierge machte und ihr Timbre seit Jahrzehnten mit unzähligen Zigaretten aus bestem Virginia Blend pflegte, selten weniger als drei Dutzend am Tag, wie sie stolz jedem gegenüber versicherte, der fragte – und auch vielen, die das gar nicht interessierte.
Griffin Boyd, ihr Boss, Eigentümer von The Tombs, hatte sie mit hochgezogenen Augenbrauen empfangen und gefragt, weshalb sie nicht daheimgeblieben sei, wie er es ihr nahegelegt hatte. Doch auf ihre Gegenfrage, ob er auch den üblichen Lohn zahlen würde, wenn sie mit Kamillentee im Bett geblieben wäre, hatte er mit seinem üblichen Lausbubenlächeln nur die Schultern gezuckt und sie für die Kartentische im ersten Stock eingeteilt, immerhin eine einfache Tätigkeit, bei der zudem an einem Mittwochnachmittag mit wenig Kundenverkehr zu rechnen war.
Ihr alptraumhaftes Erlebnis der vergangenen Nacht, ihre Nahtoderfahrung, wie sie es für sich bezeichnete, streifte er nicht einmal mehr mit einem Satz. Deshalb wusste Orchid – die eigentlich auf den weit unscheinbareren Namen Mildred Miller hörte, doch das passte nun einmal weder zu ihrem Äußeren noch in die Welt der Tombs – nicht einmal, ob Boyd den »Vorfall« beim Marshal angezeigt hatte, wie er es ihr, Dexter Heart und den anderen Mädchen, die Zeugen geworden waren, versprochen hatte. Am liebsten wäre sie selbst zu den Sternträgern gelaufen, aber das hatte Boyd ihr strengstens untersagt.
»Allez hopp!« Der aufmunternde Ruf wurde von einem beherzten Klaps auf Orchids Hintern begleitet und riss sie aus ihren Gedanken. Mit strengem Blick deutete Muriel Prentiss, die heute die Aufsicht über die Mädchen im Spielsalon hatte, in Richtung eines Tisches, an dem zwei Gentleman mit ihren Drinks Platz nahmen. Orchid verzog das Gesicht, als sie einen der beiden erkannte, nickte aber in Richtung von Muriel und eilte zwischen zwei anderen Tischen hindurch in die Mitte des Saales. Dort war es etwas heller, weil sich direkt über ihnen die gläserne Kuppel eines Oberlichts befand, welche trotz der Tönung eine Ahnung davon in den Raum dringen ließ, dass draußen heller Sonnenschein herrschte.
Dennoch brauchte man hier unten an den Tischen Kerzenständer und Fackeln, um wenigstens die Karten in den eigenen Händen erkennen zu können. Schwaden von Weihrauch durchzogen die Halle, und vor den schmalen Fenstern sperrten schwere Brokatvorhänge das Tageslicht aus. Man fühlte sich hier wie auch in den anderen Räumlichkeiten ganz so, wie es der Name des Etablissements versprach, nämlich wie in einer Gruft. Die Temperatur im Saal hätte nur wenig kühler sein müssen, um ihren Atem sichtbar werden zu lassen, und vervollständigte damit die Atmosphäre, während sie Orchid in ihrem knappen Kostüm, das ihre üppigen Kurven kaum zu bändigen vermochte, frösteln ließ.
»Bon soir, Messieurs«, hauchte sie die Begrüßung, die unabhängig von der Tageszeit zum Ritual gehörte. »Sie möchten Blackjack spielen?«
»Fürs erste«, bestätigte Harold Lauder mit einem schmierigen Grinsen, wobei er ihr nicht in die Augen sah, sondern völlig schamlos auf den Busen. »Aber danach können wir zwei gern nach oben in eines der Zimmer verschwinden, Schätzchen.«
»Lass den Scheiß, Harry«, brummte der Mann neben Lauder, der vom Alter her gut dessen Vater hätte sein können. »Du kennst die Regeln.«
Natürlich kannte Lauder die. Orchid gehörte wie die meisten anderen Mädchen in der ersten Etage und im Parterre zu den Unberührbaren. Man durfte sie anglotzen, aber Grabschen oder gar Verkehr kam nicht in Frage. Für diese Dienstleistungen waren die Dirnen im Obergeschoss zuständig. Sie arbeitete an den Kartentischen, assistierte bei den Seáncen, ließ sich an den beiden Bars zu Drinks einladen und pflegte Konversation oder trat in kleineren Rollen auf der Bühne des Vaudeville-Theaters auf. Manchmal servierte sie auch im Salon für ältere Herrschaften oder half hinter einem der Tresen aus. Mit Gästen ins Bett zu gehen war aber ihre Sache nicht – und irgendwann würde das vielleicht auch Harold Lauder einmal begreifen, obwohl sie nach all seinen vergeblichen Anzüglichkeiten die Hoffnung im Grunde schon aufgegeben hatte.