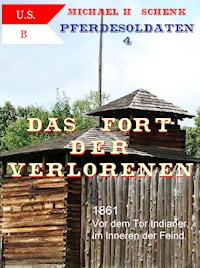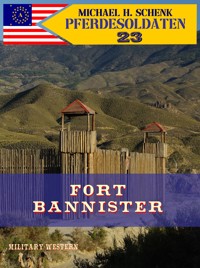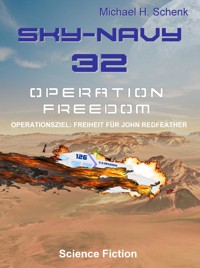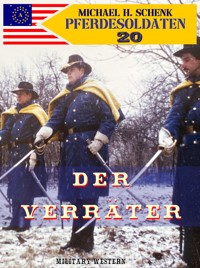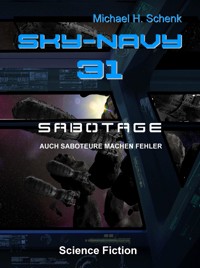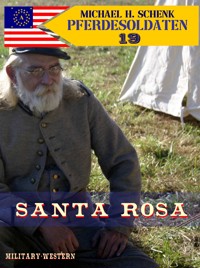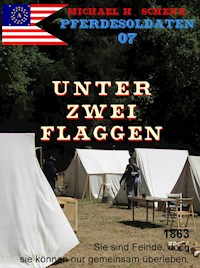
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Pferdesoldaten
- Sprache: Deutsch
"Die Pferdesoldaten" bietet spannende Western aus der Zeit der nordamerikanischen Indianerkriege. Die in sich abgeschlossenen Abenteuer stellen die U.S. Reitertruppen in den Jahren zwischen 1833 und 1893 vor. Entgegen der üblichen Western-Klischees bietet der Autor dabei tiefe Einblicke in Ausrüstung, Bewaffnung und Taktiken, die sich im Verlauf der Jahre immer wieder veränderten. Schicke gelbe Halstücher und Kavallerie mit Repetiergewehren wird der Leser hier nicht finden, wohl aber Action mit einem ungewohnten Maß an Authentizität.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Schenk
Pferdesoldaten 07 - Unter zwei Flaggen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1 Staub
Kapitel 2 Osagen
Kapitel 3 Kompanie H
Kapitel 4 Auf dem Marsch
Kapitel 5 Wild Bill Jonessy
Kapitel 6 Barstow
Kapitel 7 Die Truppe aus Fort Grattan
Kapitel 8 Zu gegenseitigem Vorteil
Kapitel 9 Taktische Überlegung
Kapitel 10Geheimnisvolle Fracht
Kapitel 11 Entdeckt
Kapitel 12 Erstes Treffen
Kapitel 13 Verfolgungsjagd
Kapitel 14 Auffanglinie
Kapitel 15 Zur Attacke
Kapitel 16 Tödliche Überraschung
Kapitel 17 Ehrenworte
Kapitel 18 Bedenken
Kapitel 19 Kriegsrat
Kapitel 20 Trennung
Kapitel 21 Verdächtige Spuren
Kapitel 22 Divide et impere
Kapitel 23 Die Erfahrung des Westmanns
Kapitel 24 An die Ehre gebunden
Kapitel 25 Vertrauenssache
Kapitel 26 Die Verfolger
Kapitel 27 Diplomatie
Kapitel 28 Die List
Kapitel 29 Rätselraten
Kapitel 30 Der Hügel
Kapitel 31 Eine Frage der Ehre
Kapitel 32 Die Wagenburg
Kapitel 33 Nächtliches Belauern
Kapitel 34 Unter zwei Flaggen
Kapitel 35 Von Mann zu Mann
Kapitel 36 Ankündigung
Kapitel 37 Historische Anmerkung
Kapitel 38 Hinweis: Für Freiheit, Lincoln und Lee
Impressum neobooks
Kapitel 1 Staub
Pferdesoldaten 07
Unter zwei Flaggen
Military Western
von
Michael H. Schenk
© M. Schenk 2018
Man sagte Thomas Gwendolyn Farling eine gewisse Ähnlichkeit mit Robert E. Lee nach. Zum Teil lag es sicher an seinem weißen Haupthaar und Vollbart, auch wenn das Gesicht ein wenig schmaler geschnitten war. Die Haut war tief gebräunt. Farling trug die Uniform eines konföderierten Generals und einen jener breitkrempigen und sehr flachen Hüte, wie sie in seinem Heimatstaat Louisiana modisch waren.
Farling war jetzt dreiundsechzig Jahre alt und befehligte ein Corps der Konföderierten. Ein Corps, welches nun die weiten Ebenen und Berge von Kansas verließ und über die Grenze nach Nebraska vordrang. Der General war erleichtert in diesem Staat auch wieder auf ausgedehnte Wälder zu stoßen. Wälder, die der Bewegung seiner Truppe etwas Deckung gaben. Er war mit einer Kavalleriekompanie vorausgeritten, um sich einen Eindruck von dem Land zu verschaffen, durch welches er seine Einheiten führen musste. Einheiten, die tief in die Gebiete der Indianer vorstoßen mussten, um den Yankees überraschend in die Flanke zu fallen.
Es war das Jahr 1863 und obwohl der Süden manche Schlacht für sich entschieden hatte, wurde die Summe der Kämpfe vom Norden gewonnen. Es zeichnete sich keine Entscheidung ab. Doch die Blockade der konföderierten Häfen durch die Unionsflotte zeigte Wirkung und die Kriegsmaschinerie der Yankees war auf vollen Touren angelaufen. Der Süden brauchte eine baldige Entscheidung. Einen Sieg, der ihm endgültig die Anerkennung und Unterstützung europäischer Staaten bringen sollte. Einen Sieg, der die kriegsmüde Stimmung in großen Teilen der Union in die Bereitschaft zum Frieden wandeln würde. Im Süden und Osten sammelten sich die Truppen. Bei vielen Regimentern war die Verpflichtungszeit abgelaufen. Überall im Norden und Süden warb man um Freiwillige. Der Norden verfügte über mehr Industrie und er verfügte über mehr Mensachen, dennoch glaubte die konföderierte Führung um Jefferson Davis, eine Schwachstelle entdeckt zu haben: Die Unruhe unter den zahlreichen Indianerstämmen, denen es nicht entgangen war, dass die Weißen untereinander Krieg führten.
Manche Indianer hofften darauf, dass die Weißen sich gegenseitig umbringen würden oder nutzten die unsichere Zeit, um sich in größeren oder kleineren Gruppen zu erheben. Das band viele Truppen der Union, welche die Grenzgebiete schützen mussten. Andere Stämme hingegen glaubten, durch eine Beteiligung am Krieg der Weißen ihre Freiheit erlangen zu können. Mancher glaubte den Versprechen der Union und griff für sie zu den Waffen, andere vertrauten wiederum den Worten der konföderierten Anwerber und darauf, dass in den grauen Uniformen eine andere Sorte von Weißen steckte, als in den blauen.
Farling gehörte zu jenen Generälen, denen es gelungen war eine indianische Truppe aufzustellen. Sein Corps bestand aus fast neuntausend Soldaten. Infanterie, Kavallerie und zwei Batterien leichter Sechspfünder-Geschütze. Viertausend seiner Kämpfer gehörten den Stämmen der Creeks, Choctaws und Cherokees an. Die Hälfte von ihnen kämpfte zu Fuß, ausgebildet und gekleidet als reguläre Linieninfanterie, die anderen waren beritten und, nach Farlings fester Überzeugung, die beste leichte Kavallerie, die man sich nur wünschen konnte. Vielleicht von J.E.B. Stuart´s Reitern abgesehen, doch der kämpfte in Virginia.
Die Cherokees verkörperten die Zerrissenheit der indianischen Völker. Die meisten ihrer Stämme hatten sich der Union angeschlossen, nur zwei von ihnen dienten nun in der konföderierten Armee. Doch diese indianischen Soldaten spielten eine bedeutende Rolle im Plan der Konföderation.
Farling´s Corps würde in Nebraska den Platte River überqueren, nach Osten einschwenken und die Grenzforts der Union überraschend angreifen. Farling beabsichtigte mit den ansässigen Stämmen zu verhandeln. Wenn diese sahen, dass die Yankees geschlagen wurden, würden sie sich sicher zu einem größeren Aufstand bewegen lassen. Das würde die Union zwingen erhebliche Kräfte einzusetzen, die ihr wiederum im Kampf gegen den Süden fehlten.
Der General war mit seiner Eskorte auf einen Hügel hinauf geritten und musterte das Land durch sein Fernglas. Trotz der Vergrößerung erschien ihm das Land unübersichtlich. Die Karten waren passabel, doch er war froh, unter den Cherokees ein paar Soldaten zu haben, die das Land von ihren Streifzügen gegen die ansässigen Stämme kannten. Vor allem die Sioux bereiteten Farling einige Sorgen, denn sie kämpften gegen jeden Eindringling und setzten ihr Leben ohne Rücksicht ein. Sie waren nicht umsonst gefürchtet und besaßen in den Cheyennes mächtige Verbündete.
In der Ebene im Süden stieg Staub auf. Er war auf viele Meilen nicht zu übersehen und wurde von den Hufen, Füßen und Rädern des Corps aufgewirbelt. Ein verräterisches Zeichen. Vor allem jetzt, wo man sich dem Gebiet feindlicher Indianer näherte.
Farling hörte das leise Schnauben eines Pferdes hinter sich. Die Kompanie der elften Louisiana-Kavallerie hielt Abstand, aber Roy Franks, ihr Captain, kam nun an die Seite seines Kommandeurs.
„Ein heißer Sommer, Sir“, meinte der blonde Offizier. „Da wird von dem trockenen Boden eine Menge Staub aufgewirbelt.“
Franks wusste, worauf es bei dieser Operation ankam und teilte die Sorgen des Generals. Eigentlich kein Wunder, denn sie beide kannten sich nun schon fast zwanzig Jahre. Farling gehörte eine der größten Tabakplantagen in Louisiana und Franks war einer seiner Vorarbeiter. Auf der Plantage waren hunderte von schwarzen Sklaven beschäftigt sowie fast hundert weiße Helfer und Aufseher. Ein Teil seiner weißen Mitarbeiter diente nun in Franks Kompanie.
„In Nebraska finden wir mehr und dichtere Wälder vor“, brummte Farling. „Ich hoffe, das bietet uns mehr Schutz vor Entdeckung.“
„Yankees werden wir wohl erst zu Gesicht bekommen, wenn wir den Platte River erreichen.“
„Mag so sein, Roy, aber wir erreichen jetzt das Gebiet der Osagen und Pawnees, und Colonel Cumber behauptet, dass sich hier gelegentlich sogar kleine Spähtrupps der Sioux herumtreiben können.“ Jackson Cumber war ein reinrassiger Cherokee. Er war getauft und zur Missionsschule gegangen und befehligte ein Batallion der indianischen Kavallerie. „Von den Pawnees hält der Colonel nicht viel“, fuhr Farling fort, „aber die Sioux bereiten ihm Sorgen. Natürlich würde er niemals zugeben, dass er sie fürchtet, doch die Eindringlichkeit, mit der er zur Vorsicht mahnt, sollte uns zu denken geben.“
„Yeah, die Sioux legen sich wohl mit Jedem an.“
„Und ziemlich erfolgreich. Bis jetzt jedenfalls.“ Farling schob das Fernglas ins Futteral zurück. „Wenn man die Burschen als Verbündete gewinnen oder wenigstens zum Aufstand verleiten könnte…“ Der General seufzte leise. „Leider sind sie nicht nur harte Kämpfer, sondern auch zu klug, um sich auf Versprechungen einzulassen.“
„Wir sind anders als die Yankees. Wir halten unser Wort.“
„Ich bin mir da nicht so sicher, Roy. Ich will es hoffen, aber seien wir doch ehrlich… Für die meisten von uns sind die Roten nichts anderes als angemalte Nigger.“
Franks lachte. „Wenn Jefferson Davies die Roten so gut behandelt, wie Sie unsere Nigger auf der Plantage, dann können die Indianer zufrieden sein.“
Farling hob eine Augenbraue. „Es braucht nicht viel, um die Schwarzen zufrieden zu stellen. Sie dürfen heiraten und Kinder bekommen, was unsere Arbeitskräfte auf natürliche Weise vermehrt, und wenn Sie sich besonders gut führen, dann schenke ich ihnen eine kleine Geburtstagsfeier. Sie wissen selbst, Roy, dass solche Dinge die Nigger besser motivieren, als die Peitsche des Aufsehers.“
„Nun, gelegentlich brauchen sie die Peitsche.“
„Mag so sein. Dennoch schätze ich die Peitsche nicht. Wer ausgepeitscht wird, der fällt für einige Zeit aus und muss versorgt werden. Das bringt Ausfall in der Ernte und kostet gute Dollars.“
„Ja, Sir, ohne Zweifel“, stimmte Franks zu. Er warf einen Blick zurück, zur Kompanie, die hinter ihnen in weiter Linie ausgeschwärmt war und die Gegend aufmerksam beobachtete. Die Männer sahen gut aus. Wie aus dem Ei gepellt. Kurz vor dem Einsatz waren sie aus dem Depot mit neuen Uniformen versehen worden. Himmelblaue Hosen, graue Jacken mit dem gelben Besatz der Kavallerie, breitkrempige Feldhüte mit dem gestanzten Staatswappen von Louisiana und schwarzes Lederzeug. Sie waren mit Nachbauten der Navy-Colts und der Sharps-Karabiner bewaffnet. Einheitliche Uniformen und Waffen, anders, als es bei vielen konföderierten Truppen der Fall war. Farling hatte einen nicht unbeträchtlichen Teil seines Vermögens in Anwerbung, Ausbildung und Ausrüstung seines Corps investiert.
„Zwei Reiter, General“, meldete ein Sergeant und wies in Richtung der Staubwolke. „Sieht nach dem General und Colonel Cumber aus.“
Der General. Der andere General. Randall, der einen Stern unter Farling stand und sich damit offensichtlich nicht anfreunden konnte. Farling befehligte nur ein kleines Corps und wusste, wie sehr Randall ihm das Kommando neidete. Er musste ein aufmerksames Auge auf den Untergebenen halten, mit einer sehr kurzen Leine, denn Randall neigte zu Eigenmächtigkeiten.
„Ich frage mich, was die beiden wollen“, murmelte Franks.
„Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, Roy“, lächelte der Befehlshaber. „Cumber wird zur Vorsicht mahnen und Randall zum schnelleren Vorrücken.“
Farling behielt recht.
Während die beiden so ungleichen Offiziere nacheinander auf den Kommandeur einsprachen und dieser geduldig zuhörte, betrachtete Franks sie forschend.
General Randall trug die Uniform eines texanischen Kavallerieregiments, dessen graue Jacken schwarz besetzt waren. Die Rangabzeichen waren beim Regiment im Gelb der Kavallerie gehalten. Randall trug allerdings die lange Jacke eines Generals, mit dem von Eichenlaub umkränzten Stern an den Kragenspiegeln und den verschlungenen goldenen Schlaufen, den „Chicken Gutts“ an den Unterarmen. Er war schlank, rothaarig, ein Yankeehasser und ausgesprochener Feuerkopf.
Colonel Cumber wirkte hingegen ruhig und gelassen. Sein Englisch war nahezu perfekt und ließ nur gelegentlich einen kehligen indianischen Unterton durchklingen. Er trug hohe Reitstiefel, zivile Hosen und einen breitkrempigen Hut, dazu eine graue Uniformjacke, an der die Rangabzeichen eines konföderierten Colonels zu sehen waren.
Schließlich hob Farling die Hand. „Gentlemen, ich habe mir Ihre Argumente angehört und sie haben sicherlich etwas für sich. Ich werde das Corps so schnell wie möglich, jedoch auch mit der gebotenen Vorsicht, nach Norden führen. Wir haben gerade die Grenze nach Nebraska überquert und stoßen in Richtung des Platte River vor. Wenn alles gut geht werden wir in Höhe der Gabelung des South Fork und des North Fork des Platte River auf den Fluss stoßen. Ein Stück weiter liegt das Unions-Fort Grattan, welches unser erstes Ziel sein wird. Der Marsch dorthin ist in mehrlei Hinsicht gefährlich. Gentlemen, wir bewegen uns durch das Territorium einiger Indianerstämme, die man nicht unbedingt als befriedet bezeichnen kann. Daher ist es wichtig, dass unsere Männer nicht feindselig reagieren, wenn ihnen Indianer begegnen. Im Gegenteil, unsere Absicht muss es sein, die Indianer davon zu überzeugen, dass wir Südstaatler anders als die Yankees sind. Wir müssen ihnen begreiflich machen, dass wir auf ihrer Seite stehen und die Yankees bekämpfen. Auf diese Weise gewinnen wir vielleicht weitere wertvolle Verbündete, wie es die Krieger unseres verehrten Colonel Cumber sind.“
Randall warf einen skeptischen Blick auf den indianischen Colonel. Als Texaner hatte er gegen Comanchen und Apachen gekämpft und sein Vertrauen zu den indianischen Verbündeten hielt sich in sehr überschaubaren Grenzen. Immerhin verhielten sich Cumbers Cherokees sehr diszipliniert. In ihren vorschriftsmäßigen konföderierten Uniformen waren sie kaum von den weißen Truppen zu unterscheiden. Bei den Choctaws, einem anderen indianischen Volk, welches im Corps zwei Regimenter Kavallerie und ein Regiment Infanterie stellte, verhielt es sich ähnlich, auch wenn diese nur Uniformteile trugen. Randall konnte die beiden Stämme hauptsächlich an ihrer unterschiedlichen Haartracht unterscheiden, sofern sie überhaupt noch die traditionelle trugen, denn viele der roten Soldaten bevorzugten den kurzen Haarschnitt der Weißen. Traditionell hatten die Cherokee ihre Schädel rasiert und trugen nur eine einzige Skalplocke im Nacken, die Chactow banden hingegen ihre langen Haare im Nacken zusammen. Als Angehörige der Armee hatten sie es sich angewöhnt, Hüte oder Kepis zu tragen.
„Wir sind hier im Gebiet der Pawnee“, führte Cumber aus. „Sie sind keine Freunde der Sioux, die das Gebiet um den Platte beherrschen. Die Pawnees und wir sind auch nicht gerade befreundet, aber vielleicht können wir ihre Kenntnis nutzen. Ich schlage vor, dass ein paar meiner Soldaten die Spitze und den Flankenschutz übernehmen. Uns Cherokee dürfte es leichter fallen, mit den Pawnees in Kontakt zu kommen.“
„Einverstanden“, stimmte Farling zu, bevor Randall Widerspruch äußern konnte. „Eine ausgezeichnete Idee. Schärfen Sie Ihren Männern ein, dass sie auch auf einen benutzbaren Weg für unsere Wagen und die Geschütze achten.“
„Selbstverständlich, General.“ Cumber salutierte vorschriftsmäßig und lächelte dann Randall zu. „Wenn Sie mich entschuldigen wollen, Gentlemen?“
Nachdem Farling mit einem freundlichen Lächeln den Gruß erwidert und genickt hatte, zog der Cherokee sein Pferd herum und galoppierte in Richtung des marschierenden Corps.
Randall stieß ein leises Schnauben aus. „Ich empfehle, zwei meiner Kavallerieregimenter nach vorne zu verlegen.“ Er vermied es nach Möglichkeit, Farling mit General oder Sir anzusprechen. „Falls es zu feindseligem Kontakt kommt, sind meine Texaner unschlagbar.“
„Das mag so sein“, antwortete Farling. „In diesem Fall werden wir jedoch unsere indianischen Truppen an der Spitze belassen. Begegnen wir Indianern, so wird das sicher einen anderen Eindruck auf sie machen, als wenn sie die unfreundlichen Gesichter unserer kampferprobten Texaner sehen, nicht wahr?“
Randall verstand die Spitze, salutierte nachlässig und kehrte dann ebenfalls zur Truppe zurück.
Captain Franks entrollte die Militärkarte und musterte sie aufmerksam. „Ich schätze, es sind gute fünfzig Meilen bis zur Gabelung des Platte River, Sir. Wir sollten unseren Weg in Richtung Nordosten suchen.“
„Richtig, Roy. Und wir sollten vorläufig sehr leise auftreten, wenn Sie verstehen, was ich meine. Später, wenn die Yankees wissen, dass wir sie besuchen, wird es hingegen auf Schnelligkeit und etwas Lärm ankommen.“
Die beiden Offiziere grinsten sich an. Dann gab Farling der Eskorte das Zeichen, ihm tiefer in das Indianergebiet zu folgen.
Kapitel 2 Osagen
Wide Eyes führte die Gruppe von elf Osagen an. Es war einer der fähigsten Späher und erfahrensten Krieger seines Stammes, und seine Gruppe befand sich schon ein Stück tief im Gebiet der Pawnees. Man war verfeindet und es war gefährlich, sich im Territorium des jeweils anderen aufzuhalten, doch Wide Eyes hatte seine Begleiter überzeugen können, das es wichtig war, die Absichten der Pawnees zu erkunden.
Die elf Osagen gehörten dem Erdvolk an, dem Clan der Hun-ka und damit einem halb sesshaften indianischen Volk. Sie ernährten sich von der Jagd und von Ackerbau. Im Frühjahr und Herbst jagten sie Büffel und Bär, im Winter Antilopen, Rehe und Kleinwild. Den Sommer verbrachten sie überwiegend mit ihren zahlreichen religiösen und traditionellen Ritualen, in den festen Dörfern, die sie dann bezogen und in denen sie in, aus Matten und Häuten errichteten, Langhäusern lebten. Ihre kurzfristigen Jagdlager bestanden hingegen aus Wickiups, den Gras- und Strauchhütten. Die weit verbreiteten Tipis aus Büffelhäuten benutzten sie lediglich, wenn sie in den Plains auf die Jagd nach dem Büffel gingen.
Jetzt war Spätsommer und Wide Eyes war mit seiner Gruppe von einem festen Dorf aufgebrochen, welches viele Meilen entfernt im Norden, in der Nähe des Wood River lag.
Es war die Neugierde, die Wide Eyes so tief in den Süden trieb. Der große Medizinmann der Sioux, Thundering Words, war zu Gast bei den Osagen und hatte vom großen Krieg der Weißen berichtet. Das es Gerüchte gäbe, dass sich viele indianische Kämpfer den blauen oder grauen Soldaten angeschlossen hätten. Wide Eyes bezweifelte das. Man konnte keinem Weißen vertrauen, gleichgültig, welche Uniform er auch trug. Der Späher hatte allerdings auch genug Vorstellungskraft, sich die Gefahr vorzustellen, die von einem Bündnis weißer Soldaten und indianischer Krieger ausging. Vor allem, wenn es sich um feindliche Indianer handelte. Es gab Beispiele bei denen Rot und Weiß ein vorübergehendes Zweckbündnis geschlossen hatten, um einen Indianerstamm anzugreifen. Black Bear, der weise Häuptling des Clans, hatte sicherlich recht, dass man ein Auge auf die Sache haben musste und so drang der Spähtrupp ungewöhnlich weit in das Gebiet des anderen Stammes vor.
Einzelnen Spähern und Trupps der Pawnees hatten sie bislang erfolgreich ausweichen können. Jetzt hatte Wide Eyes eine große Staubwolke entdeckt, die sich zwischen zwei fernen Hügeln bewegte und langsam näher kam. Die Gruppe hinter sich, verharrte der Späher am Waldrand eines hohen Hügels. Buschwerk und Bäume boten ihm und seinem kräftigen Mustang ausreichend Sichtschutz.
Bearclaw kam nun an seine Seite. Wide Eyes erkannte neidlos an, dass dieser ein noch besserer Krieger und Jäger war. Nur mit seinem Messer bewaffnet hatte dieser einen Bären erlegt, ohne selbst einen einzigen Kratzer zu erleiden. Die Krallen des Bären schmückten nun die Kette, die Bearclaw um seinen Hals trug.
„Das ist viel Staub“, meinte der Krieger. „So viel wird nur von einem Stamm auf dem Zug aufgewirbelt.“
„Um diese Zeit verlegt kein Stamm sein Lager ohne Not.“ Wide Eyes kaute nachdenklich auf dem Blatt, welches er sich in den Mund geschoben hatte. „Zudem ist es so viel Staub, dass er nicht alleine von den Bewohnern eines einzelnen Lagers stammen kann. Selbst wenn man alle Frauen, Kinder und Männer einrechnet, nebst Vieh oder Pferden, die sie vielleicht treiben. Nein, Bearclaw, entweder ist dort ein ganzes Volk auf dem Marsch oder es handelt sich um eine gewaltige Kriegshorde.“
„Pawnees werden es kaum sein. Jene, die wir zu Gesicht bekamen, verhielten sich ganz normal. Sie wären aufmerksamer gewesen, wenn ihr Volk bedroht wäre.“
„Ja“, stimmte Wide Eyes zu. „Daher befürchte ich, dass dort Weiße marschieren.“
„Sie führen Krieg untereinander“, wandte sein Freund ein. „Sie mögen zahlreich wie die Blätter der Bäume sein, doch selbst die Weißen werden nicht so dumm sein, gleichzeitig Krieg gegen uns zu führen.“ In diesem Fall bezog Bearclaw Ausnahmsweise alle indianischen Völker ein.
„Denk an das, was Thundering Words erzählte“, erinnerte Wide Eyes. „Manche Weiße wollen jetzt Unfrieden unter den indianischen Stämmen säen.“
„Das ist wahr. Der große Medizinmann sprach davon. Wir werden uns vergewissern müssen, wer dort den Staub aufwirbelt.“
„Wir müssen nicht nur sehen, wer dies tut, wir müssen auch in Erfahrung bringen, warum er das tut.“
„Sie werden Späher haben. Lass uns einen von ihnen fangen und ihn befragen.“
„Das ist auch meine Absicht. Lass uns keine Zeit verschwenden. Der Staub kommt in unsere Richtung. So haben wir Zeit und Gelegenheit, eine hübsche Falle aufzubauen.“
Die Osagen waren erfahren und rechneten sich aus, wie sich feindliche Späher verhalten und wo sie sich bewegen würden, um die vielen Marschierenden zu schützen. Der bewaldete Hügel, auf dem sie sich aufhielten, würde zwangsläufig das Interesse der Späher finden, sofern sich die Richtung der Staubwolke nicht änderte. So legten die Krieger ihren Hinterhalt entlang des Waldrandes, einige Meter tiefer in seiner Deckung. Zwei von ihnen führten die Pferde ein gutes Stück tiefer in den Wald. Es waren gute Kriegspferde, die sich nicht durch Schnauben oder Stampfen mit den Hufen verraten würden.
Sie brauchten Geduld und es dauerte viele Stunden, bis unter dem aufgewirbelten Staub undeutliche Schemen sichtbar wurden. Viel wichtiger waren jedoch die Reiter, die der Kolonne vorausritten und jene, die ihre Flanken schützten.
„Es sind Weiße“, sagte Wide Eyes zufrieden, da er seine Vermutung bestätigt sah. „Ich kann Fahnen erkennen, doch ich weiß sie nicht zu deuten.“
„Ich glaube, sie haben nicht die Streifen der blauen Soldaten“, meinte Bearclaw.
„Dann sind es vielleicht jene, die graue Uniformen tragen.“
„Blau oder Grau, es macht keinen Unterschied. Feinde sind sie alle.“
„Drei von ihnen kommen zu unserm Hügel. Sie wissen, dass er ein guter Aussichtspunkt ist.“ Wide Eyes wandte sich halb um und gab den anderen ein Zeichen. Dann zog er sich mit seinem Freund vom Waldrand zurück.
Sie lauerten dicht beieinander und lagen in einer so günstigen Position, dass sie die Annäherung der drei Reiter verfolgen konnten. Eine Weile glaubte Wide Eyes, es handele sich um weiße Soldaten, doch je näher die Männer kamen, desto größer wurden seine Zweifel. Obwohl die Unbekannten wie Weiße gekleidet waren, war ihre Haltung im Sattel eher ungewöhnlich für Pferdesoldaten. Schließlich zeigte der Teint ihrer Gesichter nicht die Bräune von Weißen, sondern den kupferbraunen Ton der indianischen Völker.
Wide Eyes Neugierde stieg ins Unermessliche. Dort kamen Indianer, die wie weiße Soldaten gekleidet waren und sogar deren Langmesser führten. Das war Außergewöhnlich. Es würde gut sein, wenigstens einen von ihnen befragen zu können.
Die drei Reiter trabten in lockerer Gruppe heran. Sie saßen auf großen braunen Pferden, wie sie auch die weißen Soldaten ritten. Diese Tiere besaßen nicht mehr die Instinkte indianischer Ponys oder Mustangs. Dennoch war der Osage froh, dass der Wind in Richtung des Waldes trieb und ihn und seine Begleiter nicht verraten konnte.
Drei Reiter. Ihre Überwältigung musste schnell geschehen. Ihre Kameraden waren sicher nicht dumm und wenn der Spähtrupp verschwand, würden sie darauf reagieren.
Wide Eyes setzte dabei auf eine Waffe, die bei den Indianern Nordamerikas eher unüblich war und welche er vor Jahren einem besiegten Cherokee abgenommen hatte. Dessen Volk verwendete sie für die Jagd auf Vögel und Kleintiere: Das Blasrohr. Man musste sehr gut sein, um damit Erfolg zu haben, doch der Späher wurde nicht umsonst Wide Eyes genannt. Kaum jemand im Volk der Osagen besaß ein schärferes Auge und eine höhere Zielsicherheit.
Bearclaw und die anderen vertrauten eher auf ihren Bogen und die Kriegskeulen.
Die Osagen hatten Glück. Wie sie gehofft hatten, lenkten zwei der indianischen Kavalleristen ihre Pferde etwas tiefer in den Wald, während der andere zwischen den vordersten Bäumen verharrte und in die Ebene zwischen den Hügeln hinunter blickte.
Wide Eyes blieb die Ehre des ersten Schusses. Der kurze gefiederte Pfeil aus seinem Blasrohr traf einen der Reiter direkt in die Kehle. Der Mann zuckte zusammen und sein Schrei erstickte in einem undeutlichen Gurgeln. Der Nebenmann reagierte und hob den Karabiner, doch zwei Pfeile beendeten die Bemühung im Ansatz.
Der Dritte, vorne unter den ersten Bäumen, hörte den dumpfen Aufprall der Körper auf dem Boden und das erschreckte Wiehern eines Pferdes. Er duckte sich instinktiv und drückte die Absätze seiner Stiefel in die Flanken seines Reittieres. Dieses machte einen mächtigen Satz nach vorne und trug den Reiter direkt in den wuchtigen Schlag der Kriegskeule von Bearclaw.
„Ich hoffe, du hast ihn nicht getötet“, knurrte Wide Eyes, während er sich über die reglose Gestalt in der grauen Uniform beugte.
„Ich habe ihm auf die graue Mütze geschlagen und außerdem haben Cherokees harte Schädel.“
Wide Eyes nickte. Die Feldmütze war heruntergefallen und man sah den rasierten Schädel und die Skalplocke. „Es ist wirklich ein Cherokee. Der Locke nach gehört er zum östlichen Stamm. Er ist weit im Norden und von seinem Volk entfernt.“ Er wandte sich zur Seite. „Seht nach, zu welchem Stamm die anderen gehören.“
Auch die Toten gehörten zu den östlichen Cherokees, die sich als Cherokee Nation bezeichneten.
„Fesselt und knebelt ihn und legt ihn über ein Pferd“, befahl Wide Eyes. Er spähte ins Tal hinunter. „Sie haben noch nichts bemerkt, aber es wird nicht mehr lange dauern und sie werden den Spähtrupp vermissen. Sehen wir zu, dass wir von hier verschwinden.“
Sie ließen die Toten zurück, nahmen aber deren wertvolle Pferde und Waffen mit sich. Selbst die Säbel waren von Wert, denn aus ihren Klingen ließen sich Messer und Lanzenspitzen anfertigen.
Stunde um Stunde ritten die elf Osagen nach Norden, wechselten mehrmals die Richtung und nahmen sich die Zeit, ihre Spuren, so gut es ging, zu verwischen. Nach einiger Zeit kam der Gefangene zu sich. Er hatte eine mächtige Beule am Schädel, doch er würde überleben. Zumindest eine Weile und bis er alles verraten hatte, was die Osagen von ihm wissen wollten.
Die Gruppe von Wide Eyes brauchte anderthalb Tage, bis sie ihr Lager erreichte, obwohl sie sich so schnell wie möglich bewegt hatte.
Das Lager lag in der Nähe jener Stelle, an welcher der Wood River in den Platte River mündete. Eine gute Gegend für ein Sommerlager, mit viel Wild und reichlich Fisch in den Flüssen. Fast drei Dutzend Langhäuser standen auf einer weiten Lichtung, dazwischen auch einige kleinere Wickiups, die von ledigen Kriegern und jungen Männern bewohnt wurden.
Eine große Pferdeherde graste vor dem Lager, an dessen Rand eine Reihe von Gestellen aufgebaut war, an denen Felle getrocknet wurden. Ein paar Frauen und Kinder spielten mit einem Lederball, den sie mit Stöcken über den Boden trieben.
Das Erscheinen der Gruppe rief sofort große Aufmerksamkeit hervor, denn der nun auf seinem Pferd sitzende Gefangene war nicht zu übersehen. Ebenso wenig, dass es sich um einen Cherokee handelte, der die graue Uniform eines Soldaten trug.
Krieger begannen sich zu versammeln. Im Grunde unterschieden sie sich kaum von denen der verschiedenen Sioux-Völker, mit der Ausnahme, dass sie strikt darauf achteten, die Federn, welche Rang oder Taten auswiesen, senkrecht im Haar zu befestigen.
Einige der jungen Männer riefen Wide Eyes ihre Fragen zu und wurden von den älteren Männern zur Ordnung gerufen. Wide Eyes würde erst dem Häuptling berichten und dann würde dieser das Wort an seinen Stamm richten. Vielleicht würde sogar Thundering Words sprechen, der noch immer zu Gast war.
Wide Eyes kannte den Weg, aber das Langhaus des Häuptlings wäre in diesen Tagen kaum zu verfehlen gewesen. Zu Ehren des Gastes waren dort einige der Alten versammelt, gemeinsam mit einigen Jugendlichen, denn Thundering Word sprach über die Vergangenheit des Volkes und gab sein Wissen bereitwillig an jene weiter, die vielleicht später an seine Stelle traten.
Chief Black Bear war ein Mann in den besten Jahren. Ein eindrucksvoller Krieger, dessen Federhaube zeigte, dass er manchen Kampf gewonnen hatte und zweimal verwundet worden war. Er scheute keine Auseinandersetzung, griff jedoch niemals leichtfertig zur Waffe. Trotz seiner relativ jungen Jahre sagte man ihm große Weisheit und kluge Führerschaft nach. Obwohl es eigentlich zu warm war, hatte er eine rote Wolldecke um seine Schultern gelegt, die von seiner Squaw liebevoll mit Glasperlen bestickt worden war. Nun erhob er sich, da sich Wide Eyes mit seiner Gruppe näherte und hob die Hand zum Gruß.
Neben ihm stand nun auch Thundering Words auf. Die Glöckchen an seinem Medizinstab klingelten leise. Sein Haar, welches er in den traditionellen zwei Zöpfen geflochten hatte, war weiß geworden, doch seine Haltung war aufrecht. Er galt als großer Schamane und Medizinmann, und als Vermittler und Bote zwischen den Völkern. Im Frühsommer war er bei seinem Stamm gewesen, hatte die Kämpfe gegen die Siedler und die Soldaten von Farrington erlebt und keine unwesentliche Rolle bei der Vermittlung des Friedens gespielt. Seit vielen Wochen reiste er nun von Stamm zu Stamm, von Lager zu Lager, um seine Stimme zu erheben.
„Ich grüße meinen Bruder Wide Eyes“, sagte Black Bear und deutete auf einen freien Platz in der Runde. „Wie ich sehe bringst du einen grauen Indianersoldaten und sicher viele Neuigkeiten. Sitz ab und erfrische dich, und berichte, was deine Augen gesehen und deine Ohren gehört haben.“
Wide Eyes warf die Zügel seines Mustangs seinem Freund Bearclaw zu, sprang mit einem eleganten Satz auf den Boden und erwies dann dem Gast, seinem Häuptling und den älteren Kriegern seinen Respekt, bevor er die Einladung Annahm.
Ein Wink eines der Älteren veranlasste die Jüngeren, sich zu erheben und rasch zu entfernen, während die Squaw des Häuptlings und eine seiner Töchter vor das Langhaus traten und frisches Wasser und kleine Knabbereien brachten.
Black Bear warf einen forschenden Blick auf den Gefangenen, während er die Pfeife neu stopfte. „Ein Cherokee des Südens und er ist gekleidet wie ein Soldat des Südens. Wenigstens sagt man, die Soldaten des Südens würden solche graue Jacken tragen.“
Thundering Words neigte das Haupt. „Es heißt, dass nicht alle graue Jacken tragen. Doch dieser hier ist zweifellos ein Soldat des Südens. Ein roter Mann, der für die weißen Männer kämpft und ihre Uniform und ihre Waffen trägt. Ich hörte in Farrington, dass dies geschehen könne und wollte es nicht glauben. Dann war ich beim großen Pow Wow, an dem der große Jäger Kit Carson teilnahm und das Gleiche berichtete. Er berichtete auch, dass sich viele indianische Brüder unter seinem Banner versammelt haben und für die Union der blauen Soldaten kämpfen. So, wie andere Brüder im Süden für die Grauen kämpfen.“ Der berühmte Medizinmann hob den Kopf. „Obwohl ich den Worten Kit Carsons vertraue, so hatte ich doch meine Zweifel. Nun sehe ich einen roten Mann, der in der Uniform des Südens kämpft. Wahrhaftig, meine Brüder, dies sind ungewöhnliche Zeiten.“