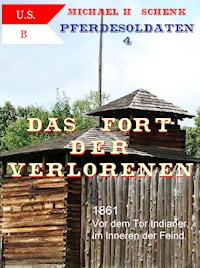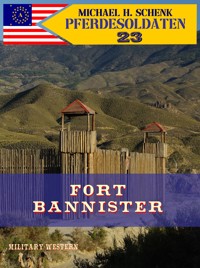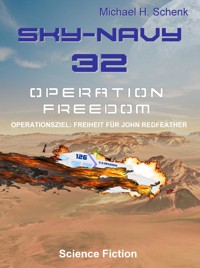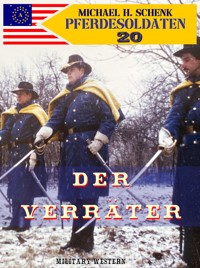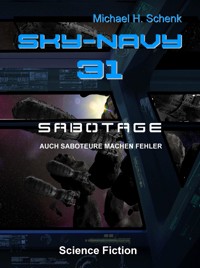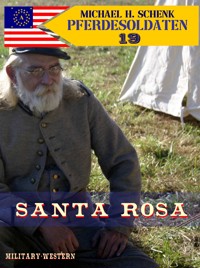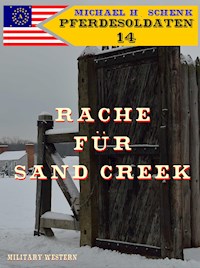
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pferdesoldaten
- Sprache: Deutsch
Während sein Vater Matt gegen die Konföderation kämpft, kommt auch sein Sohn, First-Lieutenant Mark Dunhill, nicht zur Ruhe. Im Frühjahr 1864 erheben sich die Stämme der Sioux und Cheyenne, um Rache für das Sand Creek Massaker zu üben. Als Mark nach Fort Sedgwick versetzt wird, muss er feststellen, dass der Stützpunkt überrannt wurde. Während man auf Verstärkung hofft und sich der Übermacht entgegen stemmt, wird Colorado zum Schauplatz blutiger Auseinandersetzungen zwischen Weißen und Roten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Schenk
Pferdesoldaten 14 - Rache für Sand Creek
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1. Hinweis
2. Kriegsrat am Cherry Creek
3. Neujahr auf dem Oregon Trail
4. Camp Elliot
5. Blutiger Schnee
6. Auf dem Kriegspfad
7. Postkutsche nach Stevensburg
8. Winterweide
9. Ein Ort des Todes
10. Stevensburg
11. Unerwartete Begegnung
12. Geteilte Meinung
13. Das Lager am Beaver Lake
14. Verteidigungsvorbereitungen
15. Schatten in der Nacht
16. Willkommene Verstärkung
17. Überwältigt
18. Von allen Seiten
19. Beratung
20. Tod den Weißaugen
21. Augen in der Nacht
22. Die Lockvögel
23. Ritt gegen den Tod
24. Hinterhalt
25. Feuer in der Nacht
26. Am singenden Draht
27. Angriff auf Camp Elliot
28. Auge in Auge
29. Wagen der Hoffnung
30. Camp Elliott soll fallen
31. Unerwartet
32. Bis aufs Blut
33. Marschbefehl für Kompanie „H“
34. Karte Colorado Territory 1864
35. Karte Stevensburg und Umgebung
36. Karte Camp Elliot
37. Ankündigung
38. Maße und Geschwindigkeiten
39. Leistung der hauptsächlichen Kavalleriewaffen
40. Persönliche Freiheiten in den Romanen
41. Historische Anmerkung
42. Bisher erschienen:
43. Hinweis: Für Freiheit, Lincoln und Lee
Impressum neobooks
1. Hinweis
Pferdesoldaten 14
Rache für Sand Creek
Military Western
von
Michael H. Schenk
© M. Schenk 2021
Die Handlung dieses Romans lehnt sich an die Geschichte des Rachefeldzuges von Cheyennes, Sioux und Arapahoe an, der eine Folge des unmenschlichen Sand-Creek-Massakers war und ganz Colorado und Teile der benachbarten Staaten betraf. Es handelte sich um eine ganze Kette von Einzelaktionen, bei denen oft kleinere Kriegstrupps aktiv waren. Im Falle der Stadt Julesburg und des dortigen Militärstützpunkten Rankin (später Sedgewick) vereinigten sich hingegen rund eintausend Krieger. Die damaligen Ereignisse sind nur sehr lückenhaft dokumentiert und teilweise auch sehr widersprüchlich. Ich habe daher für diesen Roman den fiktiven Ort Stevensburg und das ebenso fiktive Camp Elliot als Handlungsort verwendet, wobei mir die realen Ereignisse als Anhalt dienten, um eine eigene spannende Geschichte zu erzählen. Interessierte finden jedoch in der historischen Anmerkung Angaben zu den realen Ereignissen.
Die Karten im Roman zeigen das reale Territorium von Colorado im Jahr 1864, wobei ich hier die fiktiven Orte Stevensburg und Elliot eingebunden habe. Die Karten von Stevensburg und seiner Umgebung sind natürlich fiktiv, ebenso wie die des Camps Elliot. Sein Aufbau entspricht aber der zweiten Ausbauphase des realen Camp Rankin, welches später zu einem großen und offenen Fort ohne Befestigung ausgebaut wurde.
Michael H. Schenk
2. Kriegsrat am Cherry Creek
Der Cherry Creek war ein kleiner Nebenfluss des Cheyenne River und lag inmitten des Indianergebietes von Colorado. Hierher verirrte sich nur selten ein Weißer und seit einigen Wochen wagten sich selbst erfahrene Trapper nicht mehr in diese Gegend. Nur jene, die mit den Stämmen gut befreundet waren oder verwandtschaftliche Beziehungen pflegten, wurden noch geduldet und dies aus gutem Grund. Das Massaker der dritten Colorado-Freiwilligenkavallerie unter Colonel Chivington an einem friedlichen Winterlager der Cheyenne und Arapahoe an der Biegung des Sand Creek sorgte nicht nur für Unruhe unter den Stämmen, sondern auch für den Wunsch, Rache an den Weißen zu nehmen.
Seit Wochen waren Boten der verschiedenen indianischen Gruppen unterwegs. Der berühmte und wortgewaltige Medizinmann Thundering Words rief zur Zusammenkunft am Cherry Creek auf.
Es war mitten im Winter und der Neujahrstag des Jahres 1865 stand bevor. Es war die Zeit der Winterlager und wärmenden Feuer und doch folgten viele Krieger der Aufforderung. In kleinen und größeren Gruppen kamen sie zum Cherry Creek. Da waren die Kämpfer der südlichen und nördlichen Cheyenne, geführt von Roman Nose. Unter ihnen die Elite, die sogenannten Dog Soldiers, mit ihren Anführern Tall Bull und Wild Buffalo. Da sammelten sich zwei Gruppen der Lakota-Sioux, die Brule unter Chief Spotted Tail und die Oglala unter Pawnee Killer. Krieger der nördlichen Arapahoe schlossen sich an, bis ihre Zahl die Tausend weit überschritt.
Auf der großen Lichtung standen die Wigwams und Zweighütten dicht an dicht, jede Unterkunft von fünf oder sechs Männern belegt, denn im Kriegslager waren Frauen nicht geduldet. Waffen und Vorräte wurden vorbereitet, Pflanzenteile und besondere Erden zu Farben vermischt, welche später die Männer und ihre Pferde schmücken und schützen sollten, während man auf das Ergebnis jener Beratung wartete, in der die führenden und erfahrensten Anführer über den Pfad des Krieges entscheiden sollten.
Im Augenblick sprach Thundering Words. Als Brule gehörte er zum Volk der Lakota, doch vor vielen Jahren hatte er sich zur Wanderschaft zwischen den indianischen Völkern entschlossen und war unter den Stämmen wohl bekannt und geachtet. Er war gerühmt für seine Heilkunst, seinen tiefen Glauben und die Macht seiner Worte. Seine Erscheinung war beeindruckend. Der Medizinmann war hochgewachsen und schlank, fast hager. Der Blick seiner Augen dominierte sein dunkles kupferbraunes Gesicht. In den beiden Zöpfen und dem übrigen Haupthaar schimmerten silbrige Strähnen. Auf dem Kopf trug er eine Mütze aus Fell, an deren Seiten die gekrümmten Hörner eines Büffels herausragten. Seine Lederkleidung war mit mystischen Symbolen bestickt und wurde fast vollständig von einem wärmenden Mantel aus Büffelfell verdeckt. An seinem Gürtel hingen eine Reihe von kleinen Täschchen und Beuteln. In der Hand hielt er einen Medizinstab mit gebogenem Oberteil.
Thundering Words war ein Mann des Friedens und hatte manchen Konflikt beschwichtigt, darunter auch solche mit dem weißen Mann, doch an diesem Tag sprach er nicht von Verständnis und Versöhnung. Häuptlinge und Unterhäuptlinge saßen im Kreis um ein Feuer, welches kaum die Kraft hatte, die Männer zu wärmen. Während man den Worten des jeweiligen Redners lauschte, kreiste das Kalumet.
„Ihr wisst, dass ich ein Mann des Friedens bin“, fuhr der alte Medizinmann in seiner Rede fort. „Ihr wisst, dass ich immer sagte, wir müssen mit den Weißen in Frieden leben, denn ihre Zahl gleicht jener der Blätter, die im Herbst fallen. Ihr wisst, dass ich stets beschwor, von den Weißen zu lernen und Handel zu treiben, denn wer miteinander handelt, der bekämpft einander nicht. Ja, ihr alle wisst, was ich über so viele Jahre beschwor.“
„Und viele Jahre waren deine Worte gut und wahr“, stimmte einer der Häuptlinge zu. „Doch nun haben die Weißaugen den Frieden erneut gebrochen und sie taten es auf sinnlose und grausame Art.“
„Ja, auf sinnlose und grausame Art“, wiederholte Thundering Words bekräftigend, „und ihr alle wisst, dass ich dabei war. Ich selbst und viele andere überlebten nur, weil die Soldaten zu betrunken waren, um uns alle zu töten.“
Die Stimme von Broken Arrow, dem Kriegshäuptling der Arapahoe, klang bedrückt. „Ist es wahr, dass sie den Müttern die Kinder aus dem Leib schnitten und ihnen die Brüste abtrennten, um Trophäen daraus zu machen?“
„Ja, es ist wahr.“
Man hatte es ihnen bereits berichtet und doch war es etwas anderes, es nun nochmals aus dem Mund eines Augenzeugen zu hören. Grimmiges Schweigen herrschte im Kreis, während die Pfeife weitergereicht wurde.
Schließlich sprach Tall Bull, der Kriegshäuptling der Dog Soldiers der Cheyenne. „Eine solche Tat darf nicht ungesühnt bleiben. Sie schreit nach Rache.“
Left Hand, Chief der Arapahoe, nickte beifällig. „Wir alle sind hier versammelt, da wir bereit sind, den Speer der Rache und das Kriegsbeil zu erheben.“
Chief Lone Bear deutete um sich. „Seht euch um, meine Brüder und Vettern. Es ist Winter und nicht die Zeit des Krieges. Schnee bedeckt das Gras und die Ponys finden nur wenig Futter. Schnee verrät die Spuren der Krieger. Die Kälte macht die Glieder schwach. Es ist die Zeit der wärmenden Feuer und der sanften Arme unserer Weiber. Lasst uns auf das Frühjahr warten.“
„Lone Bear spricht wie ein altes und zahnloses Weib“, zischte Spotted Tail.
Der Chief der Brule-Sioux machte eine beschwichtigende Geste zu Lone Bear. „Nein, niemand bezweifelt den Mut unseres Bruders. Was Lone Bear sagt, das gilt es zu bedenken. Er hat recht, dass der Winter nicht die Zeit des Kriegers ist. Dennoch haben die Weißen das friedliche Lager von Black Kettle im Winter angegriffen. Weil sie genau wussten, dass es nicht die Zeit des Kriegers, sondern die der wärmenden Feuer und sanften Weiber ist.“
„So grausam die Tat der Langmesser auch war, so führte ihr Adlerhäuptling Chivington sie klug, denn er wusste, dass unsere Krieger nicht mit einem Überfall rechneten“, sagte Tall Bull bedächtig. „Selbst die meisten Weißen denken, dass man in der Zeit von Eis und Schnee keinen Krieg führt. Wir sollten uns das ebenso zunutze machen, wie Chivington und seine Soldaten dies taten.“
Pawnee Killer von den Oglala nahm die Pfeife an sich, nahm zwei Züge und gab sie an Lone Bear weiter. „Die Weißen werden mit unserer Rache rechnen, doch Tall Bull spricht klug. Sie werden erwarten, dass wir im Frühjahr reiten, und jetzt nicht vorbereitet sein.“
In der Runde erhob sich zustimmendes Gemurmel.
„Wir haben hier fast fünfzehnhundert Krieger versammelt“, stellte der alte Long Bow fest. „Wir werden den Schnee mit dem Blut der Weißen rot färben.“
Thundering Words räusperte sich und sah die Augen aller auf sich gerichtet. „Ja, ein guter Plan. Doch unterschätzen wir die Weißen nicht. Bedenkt ihre große Anzahl. Sie werden Soldaten schicken. Viele Soldaten. Langmesser, Marschiere-viel und ihre Wagenkanonen.“
„Doch das wird Zeit brauchen“, hielt Wild Buffalo, ein Unterhäuptling der Dog Soldiers dagegen. „Außerdem kämpfen die meisten ihrer Soldaten im großen Krieg der Weißen. Die Zeit ist günstig, sie anzugreifen und aus unserem Land zu vertreiben.“
Lone Bear wurmte es, dass man ihm die wärmenden Feuer und sanften Weiber vorhielt und wollte seinen Ruf als mutiger Kämpfer herausstellen. „Ja, die Zeit ist günstig und wir können siegen. Wenn wir klug vorgehen. Greifen wir nur an einem Ort an, so werden die Weißen ihre Soldaten zusammenrufen und sich uns dort entgegenstellen. Greifen wir jedoch an vielen Orten zugleich an, so wissen sie nicht, wohin sie sich wenden sollen.“
„Unsere Macht wäre geteilt“, gab Left Hand zu bedenken.
„Auch die Weißen müssten ihre Macht teilen, um ihre Siedlungen und Wege zu schützen.“ Tall Bull ließ ein bösartiges Lachen hören. „Wir hingegen können uns auswählen, wo wir angreifen, und unsere Krieger dort konzentrieren. Während die Weißen nicht wissen, wo sie uns mit Übermacht entgegentreten können, wird es uns möglich sein, ihnen an jedem Ort mit überwältigender Zahl zu begegnen.“
Erneut war zustimmendes Gemurmel zu vernehmen.
„Wir sollten viele kleine Kriegstrupps bilden und ein paar größere, und im ganzen Land angreifen“, meinte Tall Bull. „Das wird die Weißen verwirren.“
Eine bislang schweigsame Gestalt erhob ihre Stimme. Es war George Bent, halb Franzose und halb Cheyenne, der zur Händlerfamilie in Bent´s Fort, einem alten Handelsposten, gehörte. Er war ebenfalls ein Überlebender des Massakers am Sand Creek. „Greift Ranches, Kutschen und Trecks an und die Mörder werden sich in ihren Städten verkriechen und auf ihre Soldaten warten. Doch wenn wir ihre Städte selbst angreifen, so werden sie in Panik geraten, ihre Häuser verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen und so zu leichter Beute.“
George Bent trug eindeutig indianische Züge und zugleich einen schmalen Oberlippenbart, was ihn von den üblicherweise bartlosen Indianern abhob. Er war mit einer Cheyenne verheiratet und hatte als Zeuge vor dem Militärgericht gegen Colonel Chivington ausgesagt. Die Tatsache, dass Chivington und seine Mordsoldaten nicht bestraft worden waren, hatte in ihm die Gewissheit wachsen lassen, dass das indianische Volk keine Gerechtigkeit vor einem weißen Gericht erfahren würde, und so war er fest entschlossen, gemeinsam mit den Kriegern für Rache und Gerechtigkeit zu sorgen.
Tall Bull hatte noch nie Sympathien für die weißen Invasoren empfunden und es fiel ihm schwer, George Bent zu akzeptieren, doch in diesem Fall vereinte sie der Wunsch nach Vergeltung. „Unser Bruder spricht wahr. Wir müssen sie aus ihren Häusern vertreiben und sollten nicht nur die kleinen Ranches überfallen. Nein, wir müssen ihre Städte niederbrennen. Nur dann werden sie begreifen, dass kein Mord ungesühnt bleibt und sie nirgends Sicherheit finden.“
Thundering Words räusperte sich und die Blicke wandten sich ihm zu. „Ja, brennen wir ihre Häuser nieder. Töten wir ihre Männer und Soldaten. Doch wir sollten ihre Frauen und Kinder verschonen.“
„Höre ich da die Stimme des Mannes des Friedens?“, fragte Tall Bull mit leisem Spott in der Stimme.
Spotted Tail schüttelte den Kopf. „Mein Bruder hört die Stimme eines klugen Mannes. Frauen und Kinder sind wertvolle Geiseln. Kein Soldat wird ein Lager angreifen, in dem er gefangene Frauen und Kinder weiß. Mit Geiseln können wir die Soldaten zum Verhandeln zwingen.“
„Und wir können mit ihnen handeln“, fügte Left Hand hinzu. „Wir können sie gegen moderne Waffen tauschen oder gegen andere Dinge, die wir benötigen.“
„Ein Grund mehr, die Siedlungen anzugreifen“, ließ sich Bent erneut hören. „Dort gibt es Geschäfte und Lagerhäuser, die wir plündern können. Dort finden wir alles was nötig ist, damit unsere Krieger und die Winterlager mit unseren Weibern und Kindern keine Not leiden müssen.“
„Dann lasst uns beraten, wo wir zuschlagen.“ Tall Bull deutete um sich. „Wir sind viele Krieger und dies ist ein großes Land.“ Er sah Bent an. „Unser Bruder kennt die Weißen vom Handel und er hat sicherlich einen Ratschlag für uns.“
George Bent lächelte kalt. „Den habe ich in der Tat, meine Brüder und Vettern. Große Städte wie Denver sind zu stark für uns, gleichgültig, mit wie vielen Kriegern wir gegen sie vorgehen. Sie sind zu leicht zu verteidigen. Doch entlang des Oregon Trails gibt es kleinere Siedlungen und den Trail selbst. Wir haben so viele Krieger, dass wir an vielen Orten auf hunderte von Meilen angreifen können. Wenn wir die dortigen Siedlungen zerstören und den Trail sperren, so wird das den Feind hart treffen.“
„Jetzt, im Winter, macht es keinen Sinn den Oregon Trail zu sperren“, knurrte Wild Buffalo. „Die Siedlertrecks brechen erst im Frühjahr auf. In dieser Jahreszeit finden wir dort allenfalls eine armselige Kutsche.“
Das Lächeln von Bent vertiefte sich. „Ihr wisst, dass die grauen Soldaten und die blauen Soldaten ihren großen Krieg führen. Ein Krieg ist sehr teuer. In Kalifornien wird noch immer Gold gefunden und die Union lässt es zu jeder Jahreszeit über den Oregon Trail nach Osten transportieren.“
Thundering Words stieß ein leises Seufzen aus. „Gold verwirrt die Sinne der Weißen und lässt sie alles andere vergessen. In ihrer Gier kennen sie keine Grenzen.“
„Gerade deshalb wird es sie schwer treffen, wenn es uns gelänge, ein oder zwei Goldtransporte abzufangen oder zumindest zu verhindern, dass sie ihr Ziel erreichen“, stimmte Bent indirekt zu.
„Dann greifen wir entlang des Oregon Trails an“, schlug Spotted Tail vor. „Wir sind viele und so schlage ich vor, dass wir uns aufteilen. Entlang des Trails und des South Platte River. Die Krieger der Brule und Oglala wenden sich dem Ort Julesburg im Osten zu, die der Cheyenne dem Westen und unsere Vettern, die Arapahoe, greifen in der Mitte an.“
„In Richtung auf den Osten wird der Feind immer stärker. Ich schlage vor, dort die Hauptmacht unserer Krieger in den Kampf zu führen“, sagte Wild Buffalo prompt.
Spotted Tail nahm die Pfeife entgegen. Der Tabak in dem kleinen Kopf war aufgebraucht und er langte an einen Beutel an seinem Gürtel, um sie neu zu stopfen. „Lasst uns beraten. Danach schließen wir alle Vorbereitungen ab und brechen auf, um Rache für Sand Creek zu nehmen.“
Am folgenden Tag brachen fünfzehnhundert Krieger auf, teilten sich in verschiedene Gruppen und machten sich daran, Blut mit Blut zu vergelten.
3. Neujahr auf dem Oregon Trail
Die Abteilung bewegte sich gemächlich auf dem Oregon Trail entlang nach Westen. Der Weg führte durch mehrere Staaten und im Augenblick befand man sich jenseits der Grenze von Colorado in jenem Gebiet, welches als Territorium von Dakota bezeichnet wurde. Vor drei Wochen hatte man Julesburg verlassen und seitdem kein anderes menschliches Wesen zu Gesicht bekommen. Es handelte sich um die Kompanie „H“ des fünften Regiments der Freiwilligenkavallerie aus Wisconsin. Eine Truppe, die sich nun schon oft im Kampf gegen Indianer und Gesetzlose bewährt hatte und die sich trotz ihrer Verdienste eher als Strafkompanie ansah.
Der Befehl war eindeutig: „Kompanie ‚H‘ des fünften Regiments der Wisconsin Freiwilligenkavallerie hat sich nach Fort Bridger in Utah zu begeben und sich dort beim Kommandanten zum Dienst zu melden.“ Unterzeichnet war die Order von General Grant.
Diese Weisung verhinderte erneut, dass sich die Truppe endlich wieder mit ihrem Regiment zusammenschloss, welches gegen die Konföderation des Südens kämpfte. Mancher der Freiwilligen verfluchte inzwischen den Umstand, sich nicht, wie eigentlich bei Freiwilligen üblich, für zwei oder drei Jahre, sondern die gesamte Dauer des Krieges verpflichtet zu haben.
Dabei hatte die Kompanie, seit der Aufstellung des Regiments, erhebliche Verluste hinnehmen müssen. Es waren nur noch siebenundzwanzig Männer von jenen übrig, die sich in Wisconsin unter ihrem Wimpel gesammelt hatten. Die anderen waren gefallen oder durch Krankheit oder Verwundung ausgefallen. Die Kavalleristen waren stolz darüber, dass nicht ein Einziger desertiert war und empfanden sich inzwischen als verschworene Gemeinschaft, ja, fast schon als Familie.
Eine Familie, die in den vergangenen Wochen Zulauf erhalten hatte. Durch genesene Verwundete anderer Einheiten und einige wenige Freiwillige war sie wieder auf siebenundvierzig Reiter angewachsen, die dem kleinen schwalbenschwanzförmigen Wimpel folgten, der dem Sternenbanner der Union nachempfunden war, bei Ersterem waren die in Gold aufgemalten Sterne jedoch in zwei konzentrischen Kreisen angeordnet, mit vier Sternen in den Ecken des „Union“ genannten blauen Feldes. Ebenfalls in Gold schimmerte gelegentlich der Buchstabe „H“ im Zentrum des blauen Feldes.
Es war mitten im Winter und Colorado wurde von Schnee bedeckt. Der Oregon Trail schien sich endlos durch das Land zu erstrecken. Im Grunde war er kaum mehr als ein Pfad, den zahllose Räder, Hufe und Füße in den Boden gestampft hatten. Im freien Grasland zog er sich fast schnurgerade dahin, im Bereich der Wälder und der vielen Berge gab es Bogen und enge Serpentinen. Immer wieder fanden sich zurückgelassene Wagen, die der Belastung nicht standgehalten hatten. Möbel und Gepäck waren aufgegeben worden, um die Fahrzeuge zu erleichtern. Knochen von Tieren fanden sich am Trail und ebenso die Gräber von Siedlern, die es nicht geschafft hatten. Manchmal stieß man auf eine provisorische Holztafel oder einen sorgfältig aufgeschichteten Steinhaufen, die den weiteren Weg markierten, denn der Verlauf des Oregon Trails wurde immer wieder verändert, wenn ein Treck ein leichteres Wegstück entdeckte.
Auf der derzeitigen Etappe des Trails lag der Schnee nicht sehr hoch, denn er führte zwischen ausgedehnten Waldstücken entlang, die sich größtenteils aus Nadelbäumen zusammensetzten, die vor Wind und Schneeverwehungen schützten. Dennoch achtete Mark Dunhill strikt darauf, die Männer und die Pferde möglichst zu schonen. Verletzungen und Erfrierungen drohten bei Pferd und Reiter und so tat man in der Truppe alles, um diesen Gefahren zu begegnen.
Abgesehen von der kleinen Vorhut aus zwei Soldaten ritten die Männer in einer langen Reihe hintereinander. Das erlaubte es den Pferden, in den ausgetretenen Spuren der vorderen Reiter zu folgen. Der Schnee war an der Oberfläche verharscht und das Einsinken der Hufe konnte zu Verletzungen führen. So schnitten die Kavalleristen einige Decken in Streifen und umwickelten die Fesseln ihrer Reitpferde damit, was diese Gefahr erheblich reduzierte.
Für die Männer zu sorgen, war hingegen deutlich schwieriger. Im Gegensatz zu den weißen Stulpenhandschuhen der Offiziere, die in der Winterausführung warm gefüttert waren, konnten die Unteroffiziere und einfachen Reiter ihre Hände nur schützen, indem sie die langen Ärmelstulpen ihrer Mäntel nach unten schlugen. Die gelb gefütterten Capes der himmelblauen Feldmäntel waren geschlossen, um etwas mehr Wärme an den Körpern zu halten. In der Stadt hatten Mark und die anderen Männer ihre begrenzten Dollars zusammengelegt und Wollhandschuhe und dicke Schals erworben, was gegen die beißende Kälte half. Die Ersatzsocken steckten in den ungefütterten Stiefeln und sollten Erfrierungen der Zehen ebenso verhindern, wie das stündliche Führen der Pferde, was den Reitern zu etwas Bewegung verhalf.
Es war später Nachmittag und würde bald dunkeln. Mark Dunhill schärfte daher der Vorhut ein, nach einem geeigneten Lagerplatz für die Nacht Ausschau zu halten. Immerhin waren sie auf den Marsch im Winter vorbereitet, da ihnen die Quartiermeisterei Zelte und zusätzliche Handpferde zugestanden hatte. Wenn man den Boden der Zwei-Mann-Zelte mit Zweigen von Nadelbäumen auslegte und andere Zweige außen an die Seiten der A-förmigen Behausungen stellte, ließ sich die Kälte der Nacht auch ohne Feuer oder Ofen aushalten.
Mark war mit sechzehn Jahren als Hornist in das Regiment eingetreten und noch im gleichen Jahr, aufgrund besonderer Tapferkeit, zum Second-Lieutenant befördert worden. Inzwischen war er erfahren genug, um zu wissen, dass es nicht der Verdienst seines Mutes war, der den General zu dieser außergewöhnlichen Ernennung veranlasste, sondern dass es damals nicht gut um die Sache der Union stand und die Armee ihre Helden benötigte, um die Moral aufrecht zu erhalten. Inzwischen war er aufgestiegen und nach der Schlacht von Gettysburg, im Jahre des Herrn 1863, sah es endlich so aus, als werde die Union den Sieg davontragen. Nun brach das Jahr 1865 an und die Union drängte die Konföderierten überall zurück. Doch der Feind war zäh und erfinderisch und so konnte niemand mit Sicherheit sagen, wann das Gemetzel ein Ende finden werde.
Da Außenstehende gelegentlich befremdet auf die Jugend des Offiziers reagierten, ließ Mark sich nun einen Vollbart stehen, der jedoch zu wünschen übrig ließ. Seine jungenhaften Gesichtszüge waren einfach zu auffällig. Zwar dienten in beiden Armeen schon Zwölfjährige als Trommler und Musiker, aber ein Offizier war nun einmal etwas ganz anderes. Die Kompanie hatte ihren jungen Anführer allerdings schätzen gelernt, der sich um ihr Wohlbefinden kümmerte und etliches von seinem Sold in bessere Verpflegung und Ausrüstung seiner Männer investierte. Zudem war er klug genug, auf den Rat erfahrener Männer zu hören und hatte auch von seinem Vater viel gelernt.
Matt Dunhill war Berufsoffizier, Major der fünften U.S.-Kavallerie und Träger der Tapferkeitsmedaille. Sie beide sahen sich nur höchst selten und noch rarer war eine Zusammenkunft mit beiden Elternteilen. So beschränkte sich ihr Kontakt in den vergangenen zwei Jahren nahezu ausschließlich auf Briefe. Mark wusste, dass sein Vater das besondere Vertrauen von General Grant besaß, und vermutete inzwischen, dass Matt auf den General einwirkte, um den Sohn von den blutigen Gemetzeln des Bürgerkrieges fern zu halten.
Drei Männer waren in Julesburg zur Truppe gestoßen und bereiteten First-Lieutenant Mark Dunhill einige Bauchschmerzen, da er nicht richtig einschätzen konnte, wie zuverlässig diese Neulinge wohl sein mochten. Sie machten den Eindruck von Satteltramps und waren vielleicht sogar vor dem Gesetz auf der Flucht. Jim Heller, First-Sergeant und ehemaliger Trapper, hatte sich die drei „zur Brust“ genommen, und trabte nun zur Spitze der Kolonne, um Mark zu berichten.
Mark sah den Unteroffizier herankommen und winkte Ted Furbanks, ebenfalls zu ihm aufzuschließen. Der Second-Lieutenant war erst vor Kurzem zu ihnen gestoßen und hatte zuvor eine Fußtruppe der Miliz befehligt. Er war Mitte der Dreißig, ein nur leidlich guter Reiter und wirkte ein wenig steif. Er war eher ein Theoretiker, auch wenn es ihm nicht an Mut fehlte. Mark hatte das umfangreiche Wissen des einstigen Lehrers schätzen gelernt. Furbanks schien Mark als Vorgesetzten zu akzeptieren, hielt jedoch noch immer eine gewisse Distanz aufrecht. Im Gegensatz zu Mark und den meisten Kavalleristen verzichtete der Lieutenant auf einen Bart und die Haut seines glatt rasierten Gesichtes war gelegentlich gerötet, da die Voraussetzungen für eine Rasur nicht immer günstig waren.
Jim wartete ab, bis Furbanks ihn und Mark erreicht hatte. „Also, Sir, ich habe mit unseren drei Neuzugängen gesprochen und mir ihre Geschichte angehört. Sie sind Cowboys, die nicht zur Stammmannschaft einer Ranch gehören und die über den Winter entlassen werden, damit der Rancher sich den Lohn sparen kann. Bis zum Frühjahr müssen sie sich durchschlagen und das hat sie wohl zu uns getrieben.“
Ted Furbanks schüttelte missbilligend den Kopf. „Dann sind sie kaum zuverlässig, denn im Frühjahr werden sie wieder einen Job auf einer Ranch suchen.“
„Wahrscheinlich“, räumte der First-Sergeant ein, „trotzdem denke ich, dass man sich auf die Jungs verlassen kann. Zumindest bis zum Frühjahr“, schränkte er lächelnd ein. „Bis dahin haben wir immerhin drei Männer mehr, die mit ihren Waffen umgehen können und exzellente Reiter sind.“ Jim grinste breit. „Und mit den Ersatzuniformteilen von unseren Jungs sehen die Burschen so halbwegs wie Soldaten aus. Natürlich fehlt ihnen der Schliff, aber sie werden die Befehle befolgen.“
„Jeder kann behaupten, ein Winter-Cowboy zu sein“, wandte Furbanks ein. „Ich halte sie eher für Gesetzlose, die sich bei uns verstecken wollen.“
„Si, kanne sein Bandidos, die auf Flucht vor Carabinieri“, ließ sich zweiter Trompeter Luigi Carelani vernehmen, der sich mit Wimpelträger Cardigan hinter Mark hielt. „Oder auf Flucht vor Familie, eh? Machen zu viele Amore und Bambini, eh?“
Furbanks warf dem Italiener einen finsteren Blick zu. Bevor er diesen rügen konnte, fuhr jedoch schon Jim fort. „Ich glaube den Männern, dass sie Cowboys sind. Ich habe mir ihre Waffen und Hände angesehen, Lieutenant.“
„Ach, und was haben die Ihnen verraten, Sergeant?“, fragte Furbanks spöttisch. „Das mit ihnen viel geschossen wird?“
Jim Hellers Grinsen wurde noch eine Spur breiter. „Sie haben die Schwielen an den Händen, die vom häufigen Umgang mit dem Lasso zeugen. Zudem habe ich mir die Kolben der Revolver angesehen, Sir. Jede Menge Abdrücke und Schlagkerben. Typisch für Cowboys, die oft ihren Revolver an Stelle eines Hammers benutzen.“
„Selbst wenn die Männer nur bis zum Frühjahr bleiben, sind sie uns eine willkommene Verstärkung“, meinte Mark. „Wir haben noch eine Menge Meilen bis Bridger vor uns und wir befinden uns im Indianergebiet.“
Furbanks leckte sich über die Lippen. „Rechnen Sie jetzt, im Winter, mit Schwierigkeiten durch die Roten, Mister Dunhill?“
„Nach dem, was am Sand Creek geschehen ist, rechne ich lieber mit allem“, gestand Mark.
Er und Jim warfen sich einen vielsagenden Blick zu. Chivington hatte die Kompanie gezwungen, ihn zum Sand Creek zu begleiten. Doch die Männer von Mark hatten sich nicht an dem Massaker beteiligt und einigen Indianern das Entkommen ermöglicht. Dabei hatte Jim in seinem Zorn drei Soldaten Chivingtons erschossen. Später hatten die Angehörigen der Kompanie „H“ im Prozess gegen den Mörder ausgesagt und wurden, wie so viele andere, enttäuscht, da keiner der Täter bestraft wurde.
Der Blick von Ted Furbanks wurde nachdenklich. „Mag sein, dass Sie recht haben, Mister Dunhill. Wir halten wohl besser die Augen offen. Obwohl … jetzt im Winter … Da werden höchstens kleine Trupps von Jungkriegern unterwegs sein, die sich bewähren wollen. Die legen sich nicht mit einer Kompanie Kavallerie an.“
„Iste Caporal Geeker“, radebrechte Luigi und deutete nach vorne, wo in knapp dreihundert Yards Abstand die beiden Reiter der Vorhut verharrten. „Hat er sicher gefunden eine gute Platz fur die Lager, Teniente, si?“
Furbanks langte automatisch nach seiner Taschenuhr, während Jim Heller sich nach dem Stand der Sonne orientierte. „Noch rund anderthalb Stunden hell, Sir. Wäre ein guter Zeitpunkt, das Camp zu errichten. Dann bleibt uns auch genug Zeit für die, äh, besonderen Vorbereitungen.“
Die Bemerkung zauberte selbst auf Furbanks Gesicht ein Lächeln. Mark und die Kompanie beeilten sich nicht sonderlich, denn der Befehl schrieb ihnen keinen Zeitpunkt vor, an dem sie sich in Fort Bridger zu melden hatten. An diesem Tag war der Neujahrstag des Jahres 1865. Da seine Männer keine Gelegenheit gefunden hatten, in das neue Jahr hineinzufeiern, wollte er ihnen heute eine kleine Freude bereiten. Er selbst, Furbanks und Heller waren die Einzigen, die wussten, was sich in jenen drei Kisten befand, die Mark noch von seinen letzten Dollars in Julesburg erstanden hatte.
Mark gab den beiden Vorhutreitern ein Zeichen und diese bogen nach rechts ab und ritten in den dort liegenden Wald ein. Unter den Nadelbäumen herrschte Zwielicht und an einigen Stellen lag nicht einmal Schnee. Gute Voraussetzungen, um ein relativ gemütliches Nachtlager herzurichten.
Corporal Geeker ritt gemächlich eine knappe Meile in den Wald hinein, wo er auf eine kleine Lichtung stieß. Sichtlich zufrieden und auffordernd sah er Jim Heller an, der seinen Blick erwiderte und nickte. Für Mark war dies das Zeichen, dass man den richtigen Platz gefunden hatte. Er gab Befehl zum Absitzen und Herrichten des Camps.
Inzwischen besaßen die Männer viel Übung und der Aufbau ging reibungslos vonstatten, behütet von acht aufmerksamen Männern, die Wache hielten.
Selbstverständlich erhielten die Pferde Vorrang und wurden zuerst versorgt. Im Windschutz einiger Bäume wurden Leinen gespannt, an denen die Zügel fixiert wurden. Man lockerte die Sattelgurte und legte Wolldecken über die Rücken. Sorgfältig kontrollierte man Hufe und Beine der Reittiere und wo es erforderlich schien, wurden diese massiert. Nachdem die Pferde noch getränkt worden waren, hing man ihnen die aus Leinen bestehenden Falteimer um und gab ihnen eine gute Portion Hafer.
Jim Heller besaß viel Erfahrung aus seiner Tätigkeit als Trapper und wusste, wie man sich in Feindgebiet zu verhalten hatte. Nach der Versorgung der Pferde teilte Jim Heller mit leiser Stimme die jeweiligen Arbeitsgruppen ein.
Trockenes Holz wurde gesucht, dicht benadelte Zweige abgetrennt und zum Lagerplatz gebracht. Eine andere Gruppe stellte die Zelte in zwei Reihen auf, eine dritte bereitete die Feuerstellen vor. Schnee verschwand in Kannen und Töpfen, um darin geschmolzen zu werden.
„Haltet euch ran, Jungs“, mahnten Jim Heller und die anderen Sergeants die Truppe. „Sobald es dunkel wird, darf kein Feuer mehr brennen. Wer weiß, wer außer uns noch durch den Wald schleicht.“
Heller bezog sich keineswegs nur auf die Gefahr durch umherstreifende Indianer. Es gab Bären und Wölfe sowie kleine Gruppen von Büffeln, die ebenfalls den Schutz der Bäume nutzten. In der Nähe der Berge würden Pumas hinzukommen. Daneben suchte auch anderes Wild in den Wäldern nach Nahrung. Antilopen und Rehe verlockten dazu, sich mit Frischfleisch einzudecken, doch wer einen Schuss abgab, der riskierte seine Entdeckung.
Das kleine Camp stand in Windeseile und die Männer wussten, dass mit Einbruch der Dunkelheit Lichter und Feuer gelöscht sein mussten. So unbequem dies auch sein mochte, aber die Kavalleristen vertrauten der Erfahrung von Jim Heller.
Für den stämmigen Sergeant Willard bedeutete es an diesem Tag besonderen Zeitdruck. Seine Talente als Hobbykoch waren allgemein anerkannt und heute würde er keine Pfannen schwenken und in keinem Kessel rühren, sondern sich dem Inhalt der ominösen drei Kisten widmen, die Mark nun von den Packlasten holen und zu Willard bringen ließ. Der machte große Augen. „Verdammt will ich sein … Gewürze, Wurst und anderes Zeugs?“
„Ich wette, Willard, Sie können daraus etwas Leckeres zaubern. Für jeden von uns“, bestätigte Mark lächelnd. „Dazu Dosenpfirsiche zum Nachtisch.“
Jim Heller schlug dem Koch freundschaftlich auf die Schulter. „Und zum Nachspülen und Aufwärmen in der Nacht einen ausgezeichneten Whiskey. Nicht der billige Fusel, den man in den Saloons ausschenkt.“ Sein Blick wurde eindringlich. „Aber nur zwei Schlucke für jeden, dafür bist du mir verantwortlich. Wenn morgen auch nur einer der Jungs schief im Sattel hängt, dann führen wir zwei eine Unterredung unter vier Augen.“
„Grundgütiger, Jim, das brauchst du mir nicht zu sagen“, knurrte Willard und strich sich über das Kinn. „Nun, irgendwas werde ich schon hinbekommen und es wird die Jungs sicher freuen. Na, wenigstens die meisten von ihnen. Ich schätze, Sir, das ging auf Ihren Geldbeutel, wie?“
Mark zuckte mit den Schultern. „Ich denke, hier auf dem Trail kann ich meine Dollars ohnehin nicht ausgeben. Außerdem hat sich Mister Furbanks beteiligt.“
Das schien den Sergeant zu überraschen, der den Second-Lieutenant freundlich ansah. „Nun, Gentlemen, dann werde ich den Jungs heute wohl etwas besonders Feines vorsetzen können.“
„Achte auf Private Donelson“, schärfte Jim seinem Freund ein.
„Paddy?“
„Genau der. Ist ein gestandener Ire und der lässt den Inhalt einer ganzen Flasche ohne schlucken durch die Kehle laufen.“
Mark nickte bestätigend. Luigi Carelani, Patrick „Paddy“ Donelson und Hermann, ein Deutscher, hatten sich mit ihm gemeinsam anwerben lassen. Zu den Freunden hatte noch ein Junge aus der Bronx gehört, der im Kampf gefallen war.
Willard zauberte einen Eintopf nach eigenem Rezept und schmeckte ihn mit einem gehörigen Schuss Whiskey ab. Die Männer genossen ihn sichtlich und sie zeigten dies den Offizieren. Für Mark war dies eine wichtige Geste. Es knüpfte die Bande in der Kompanie wieder ein Stück enger.
Ted Furbanks wusste, was Mark bewegte. Während sie unter dem Wimpel saßen, dessen Lanze Cardigan bei ihnen in den Boden gerammt hatte, um die Position des Kommandierenden kenntlich zu machen, stopfte sich der ältere Lieutenant eine Pfeife und wandte sich dann zögernd an seinen jungen Vorgesetzten. „Ist nur ein Rat, Mister Dunhill, aber Sie sollten sich nicht zu eng mit den Männern verbrüdern. Ihre Befehle entscheiden vielleicht über Leben und Tod und je näher Sie den Männern stehen, desto schmerzhafter kann das für Sie werden.“
Mark nickte. „Dessen bin ich mir durchaus bewusst, Mister Furbanks. Aber es schweißt die Kompanie auch zusammen. Sie haben sicher schon gehört, wie hoch die Quote der Fahnenflüchtigen bei einigen Regimentern ist … Bei uns werden Sie so etwas nicht erleben.“
„Hm, mag sein. Wenn Sie gestatten, Sir, dann werde ich mich jetzt zurückziehen. Wann brechen wir auf? Wieder mit dem ersten Tageslicht?“
„Wie üblich. Jim, die Wachen sind eingeteilt?“
Der First-Sergeant, der sich zu den Offizieren gesellt hatte, bestätigte. „Ich lasse alle anderthalb Stunden ablösen. Länger hält man es bei dieser Kälte nicht aus, wenn man ständig auf derselben Stelle verharren muss und sich die Beine nicht vertreten kann.“
„Recht so, Jim. Begeben wir uns zur Ruhe. Morgen kommen wir unserem Ziel wieder ein Stück näher.“
Der First-Sergeant schnaubte leise. „Fort Bridger … Verdammt, Mark, man schickt uns quer durch die Staaten, als seien wir Heimatlose.“
„Ich weiß, Jim, und mir gefällt es ebenso wenig.“
Furbanks erhob sich und ging zu seinem Zelt. Jim senkte die Stimme. Für Mark war er inzwischen zu einer Art väterlichem Freund geworden und wenn sie unter sich waren, wurde ihr Ton vertraulich. „Etwas von Ihrer jungen Lady gehört?“
Bei ihrem letzten Einsatz hatte Mark die junge Samantha „Sam“ Barrows kennengelernt und zwischen ihnen beiden hatte es sofort „gefunkt“. Sam war die Tochter eines Ranchers in Tubac, im Territorium von Arizona, und war mit der Bahn gereist, um Zuchtbullen für die Ranch zu erwerben.
„Ich habe ihr geschrieben“, gestand Mark ein und errötete ein wenig. „Wenn alles glatt läuft, dann dürfte sie den Brief in einer Woche bekommen.“
„Nun, ich wette die junge Dame hat sich ebenfalls gleich an ein Schreiben gesetzt.“ Jim zeigte wieder einmal sein typisches Grinsen. „Würde mich und die Jungs mächtig freuen, wenn sie beide zueinander finden.“
„Ist wohl kein großes Geheimnis, wie?“
„In unserer Kompanie bleibt kaum etwas geheim.“ Jim reckte sich. „Ich kontrolliere die Wachen. Hauen Sie sich aufs Ohr, Sir, und träumen Sie von Ihrer Lady.“
Am kommenden Morgen
Mit dem ersten Licht der Morgendämmerung wurden die Pferde und die Männer versorgt. Während man das Lager abbaute, kontrollierten Ted Furbanks und Jim Heller, begleitet von einigen Kavalleristen, die Wachen und ließen diese ablösen, damit sie ebenfalls zu ihrem Frühstück kamen. Die Gruppe näherte sich gerade den Posten am Oregon Trail, als Heller bemerkte, wie dieser ihnen mit der Hand bedeutete, in Deckung zu gehen.
„Irgendetwas ist auf dem Trail los“, raunte der First-Sergeant. „Verhaltet euch leise und achtet auf Sichtschutz. Wir rücken zu Daniels und Carelani vor.“
Furbanks akzeptierte schweigend und die vier Männer huschten wie Schemen zu den beiden Kavalleristen, die vor ihnen im Schutz einiger Büsche kauerten.
„Indianer“, flüsterte Private Daniels. „Und eine ganze Menge davon. Kommen gerade auf der anderen Seite aus dem Wald und reiten jetzt auf dem Trail nach Westen.“
Keine zweihundert Yards entfernt waren berittene Indianer zu sehen. Immer mehr von ihnen kamen aus dem gegenüberliegenden Wald hervor, sammelten sich in kleinen Gruppen und wandten sich westwärts.
„Sinde mächtig viele Rote“, meinte Luigi mit einem Seitenblick auf Furbanks. „Madonna mia, von wegen kleine Kriegstrupp, wie Teniente sagte. Sinde ganze viele, eh?“
„Leise“, zischte Furbanks.
Jim Hellers Blick wurde düster. „Verdammt, Lieutenant, sehen Sie sich das an. Eine ganze Menge von denen tragen Uniformteile. Und da … Das sind Kavalleriepferde. Die haben wenigstens zwei Dutzend Gäule von uns erbeutet.“
„Und einen Kompaniewimpel“, fügte einer der Kavalleristen beklommen hinzu. „Es muss mächtig mies um eine Truppe stehen, wenn sie ihr Feldzeichen einbüßt.“
„Jim, Sie haben die meiste Erfahrung“, gestand Furbanks ein. „Sie bleiben hier und beobachten die Roten. Wir Übrigen gehen zurück zum Camp und warnen die anderen. Himmel, das sind wenigstens zweihundert Krieger. Wenn die uns entdecken, dann rennen die uns einfach über den Haufen.“
„Empfehlen Sie Mister Dunhill, er solle sich ruhig verhalten und auf einen Kampf vorbereiten“, sagte Heller, ohne den Blick vom Trail zu wenden. „Keiner von uns darf sich hier blicken lassen, bevor die Krieger nicht verschwunden sind.“
Furbanks und seine Begleiter eilten zum Camp zurück, wo ihre hastige Meldung zu einer raschen Reaktion von Mark Dunhill führte. Das Lager war fast abgebaut und die letzten Zelte wurden zusammengefaltet, gerollt und verschnürt. Nun stellten die Männer die Arbeiten ein und stellten routiniert und fast lautlos die Gefechtsbereitschaft her.
Zwei Drittel von ihnen bildeten eine dünne Linie zum Waldrand hin, hielten sich in Deckung und die Waffen bereit. Die anderen Kavalleristen machten die Pferde reitfertig und löschten die Feuer, auf denen der Kaffee gerade zu brodeln begann.
Mark prüfte instinktiv die Windrichtung. „Gut, er steht günstig für uns. Auf dem Trail kann man die Feuer nicht riechen. Glück für uns. Zweihundert Krieger sagen Sie, Mister Furbanks?“
„Wenn nicht mehr“, brummte der Angesprochene. „Und sie haben eine Menge Uniformen und Pferde von uns erbeutet. Inklusive einem Wimpel.“
„Die haben einen Wimpel erbeutet?“
„Ich konnte die Kennung nicht lesen, aber es war definitiv einer von unseren Kavalleriewimpeln.“
„Verdammt, das klingt nicht gut.“ Mark zog die Kartentasche an sich heran und öffnete sie. „Die kamen im Süden aus dem Wald?“
„Und reiten jetzt auf dem Trail nach Westen“, bestätigte Furbanks.
Mark entfaltete die Karte von Colorado und sie beide betrachteten die Eintragungen.
„Wir haben jetzt zwei Drittel des Weges zwischen Julesburg und der nächsten Siedlung am Trail zurückgelegt“, stellte Mark fest. „Scheinbar wenden sich die Krieger dieser Siedlung zu. Stevensburg. Scheint ein noch kleiner Ort zu sein.“
„Ein gefundenes Fressen für diese große Horde“, meinte Furbanks verdrießlich. „Wir müssen die Siedler warnen.“
„Die Krieger sind zwischen uns und diesem Stevensburg. Keine Chance, den Kriegstrupp zu überholen und den Ort vor ihnen zu warnen.“ Mark überlegte. „Hat Jim etwas gesagt, zu welchem Stamm die Gruppe gehört?“
„Nein.“
„Dann werden wir ihn gleich danach fragen.“ Mark schürzte die Lippen. „Wir müssen herausfinden, woher die Krieger gekommen sind und was passiert ist.“
„Nichts Erfreuliches.“
„Da stimme ich Ihnen zu“, seufzte Mark.
„Sollten wir nicht besser einen Meldereiter nach Julesburg senden?“
Der junge Lieutenant schüttelte den Kopf. „Das wird nicht erforderlich sein. Julesburg ist zu stark für zweihundert Krieger und außerdem ist in der Nähe Kavallerie stationiert.“
„Ein schwacher Trost“, hielt Furbanks dagegen. „Da die Roten einen Wimpel besitzen, haben sie sich offensichtlich schon mit unserer Kavallerie angelegt und ebenso offensichtlich haben sie dabei den Sieg davon getragen.“
„Kanne sein, dass Überlebende“, warf Luigi ein. „Vielleicht Rote machen Massaker an viele Soldaten, aber andere überleben und warte auf Hilfe, eh?“
„Wir müssen uns in jedem Fall vergewissern“, entschied Mark endgültig. „Sobald der Kriegstrupp weit genug entfernt ist, reiten wir auf seiner Fährte zurück und versuchen herauszufinden, was geschehen ist.“
4. Camp Elliot
Wenn man von Julesburg aus dem Oregon Trail weitere zweihundert Meilen nach Westen folgte, erreichte man die kleine Stadt Stevensburg. Hier trafen sich der Trail und die Straße nach dem nordöstlich gelegenen Laramie. Nach weiteren zehn Meilen auf dem Weg nach Westen erreichte man die Furt über den Cheyenne River. Hier lag Camp Elliot.
Im Frühjahr des vergangenen Jahres war dort die Kompanie „K“ der ersten Colorado-Freiwilligenkavallerie eingetroffen und hatte mit dem Bau der Militäranlage begonnen. Das Camp sollte den Trail und das Umland schützen und letztlich sowohl eine Kompanie Kavallerie als auch eine Kompanie Infanterie aufnehmen. Aufgrund der relativ schwachen Garnison und der Unruhe, die unter den Stämmen herrschte, plante man Elliot als befestigte Anlage mit einer umlaufenden Palisade zu errichten.
Im Verlauf des Jahres war es den Kavalleristen aus Colorado gelungen, einen guten Teil des Camps zu erbauen, dennoch war es weit davon entfernt, vollendet zu sein.
Im Gegensatz zu vielen anderen Forts wies Elliot einen exakt rechteckigen Grundriss auf. Das Haupttor lag nach Süden, in Richtung auf den rund eine Meile entfernten Oregon Trail. Der größte Teil der Palisaden war fertiggestellt. Hierzu hatte man einen anderthalb Yards hohen Erdwall aufgeschüttet, in den man die geschälten Pfosten der Palisade einließ. Hinter diesem hölzernen Schutz zog sich der beplankte Wehrgang entlang. Ungefähr in der Mitte der westlichen Seite und dem nördlichen Ende der östlichen Seite gab es noch Lücken. Die im Westen war behelfsmäßig mit Palisadenpfählen geschlossen worden. Dazu hatte man die Konstruktion mit Leinen und Nägeln verbunden, doch sie blieb ein schwaches Provisorium. Die im Osten war noch offen. Das erforderliche Holz war erst vor Kurzem gefällt worden und musste nun noch ins richtige Maß gebracht werden. Zwei Planwagen dienten dazu, den Zugang zu versperren.
Auch was die Gebäude betraf, war die Kompanie zwar gut vorangekommen, jedoch noch weit davon entfernt, sie zu vollenden. Captain Jacobs legte verständlicherweise die Priorität darauf, zunächst die winterfeste Unterbringung seiner Männer und Pferde zu gewährleisten.
So war eines der beiden Kompaniequartiere fertig, von dem anderen standen lediglich Boden und drei Seitenwände. Das Hospital in der nordöstlichen Ecke bestand aus Boden, ein paar Pfosten und dem Dach, darunter stand eines der großen Zelte, die der Versorgung Verwundeter dienten. Der Küchen- und Messebau am südöstlichen Ende bestand aus mit Planen aufgestellten Wänden und dem vollendeten soliden Dach, so dass die Mahlzeiten immerhin im Trockenen gefertigt und gegessen werden konnten. Im Süden und Südwesten entstanden die Kommandantur und die Offiziersquartiere. Erstere war bis auf ihr Dach vollendet. Hier war ebenfalls Leinwand über die Deckenbalken gelegt und mit Grassoden bedeckt worden, um etwas Schutz vor den Unbilden des Winters zu bieten. Eine Offiziersunterkunft stand, an Stelle der beiden anderen waren Zelte aufgestellt.