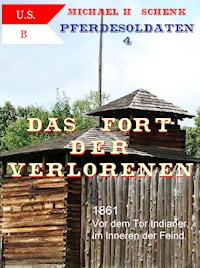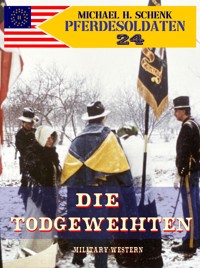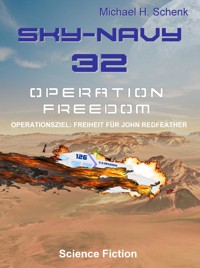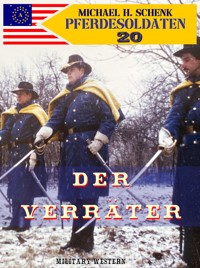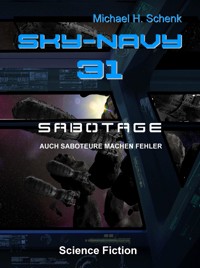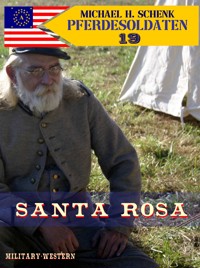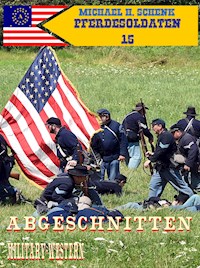
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Pferdesoldaten
- Sprache: Deutsch
Während des nordamerikanischen Bürgerkrieges will sich eine deutsche Division der Union bewähren und rückt auf eigene Verantwortung vor. Prompt wird sie von Konföderierten umzingelt und gerät in eine schier aussichtslose Situation. Major Mark Dunhill und die U.S.-Kavallerie starten ein gewagtes Manöver, um die Deutschen zu retten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Schenk
Pferdesoldaten 15 - Abgeschnitten!
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1 Vorweihnacht am Potomac River
Kapitel 2 Im deutschen Debattier-Club
Kapitel 3 Schnell und Hart
Kapitel 4 Ein ordentlicher Coup
Kapitel 5 Die „geheime“ Division
Kapitel 6 Über den Rappahanock
Kapitel 7 Täuschung
Kapitel 8 Die Furt am Robinson River
Kapitel 9 Digger´s Hole
Kapitel 10 Die Torfstecherin
Kapitel 11 Vorwärts, dann zurück!
Kapitel 12 Ein wachsamer Bursche
Kapitel 13 In feindlichem Feuer
Kapitel 14 Die Einsame
Kapitel 15 Gefechtspositionen
Kapitel 16 Von Erfolg und Misserfolg
Kapitel 17 In Shermans Hauptquartier
Kapitel 18 In die Enge getrieben
Kapitel 19 Hinter feindlichen Linien
Kapitel 20 Nächtlicher Grenzverkehr
Kapitel 21 Fort Kershaw
Kapitel 22 Die Gespenstertruppe
Kapitel 23 Die letzte Stellung
Kapitel 24 Der Pfad
Kapitel 25 Überraschungen
Kapitel 26 Gekreuzte Klingen
Kapitel 27 Eine Frage der Beweglichkeit
Kapitel 28 Freiheit oder Untergang
Kapitel 29 Im Gefecht
Kapitel 30 In Sicherheit
Kapitel 31 Karte Maryland / Virginia 1864 Übersicht
Kapitel 32 Karte Bartons Station und Umgebung
Kapitel 33 Schlacht um Bartons Station
Kapitel 34 Ankündigung
Kapitel 35 Maße und Geschwindigkeiten
Kapitel 36 Leistung der hauptsächlichen Kavalleriewaffen
Kapitel 37 Persönliche Freiheiten in den Romanen
Kapitel 38 Historische Anmerkung
Kapitel 39 Bisher erschienen:
Kapitel 40 Hinweis: Für Freiheit, Lincoln und Lee
Impressum neobooks
Kapitel 1 Vorweihnacht am Potomac River
Pferdesoldaten 15
Abgeschnitten
Military Western
von
Michael H. Schenk
© M. Schenk 2021
Lager des XI. Corps der Unions-Armee, Winter 1863, zwei Wochen vor Weihnachten
Sergeant Fürchtegott Rehfeld war mit sich und der Welt zufrieden.
Vor einer Woche war das 195ste Regiment of New York Volunteer Infantry in dem großen Tal am Potomac River angekommen. Nun war es Bestandteil des XI. Corps der Union und der zweiten deutschen Division, die sich fast ausschließlich aus Männern zusammensetzte, die aus den fernen deutschen Ländern in die U.S.A. eingewandert waren.
Dabei machte Fürchtegott durchaus Unterschiede zwischen den Deutschen.
Viele waren voller Hoffnung aus wirtschaftlicher Not und im Vertrauen auf die unbegrenzten Möglichkeiten des fernen Amerika aufgebrochen und im Hafen von New York prompt von den Anwerbern der Armee angelockt worden. Für die Einwanderer, die ohne Wohnung und Arbeit an Land gelangten, war das Angebot der Union verlockend. Ein gut bezahlter Job, bei freier Kost und Logis, und wenn man sich für drei Jahre zum Dienst verpflichtete, so erhielt man die amerikanische Staatsbürgerschaft. So vertrauten viele auf die Aussagen der Anwerber und trugen nun die blaue Uniform der Unionsarmee.
Für Sergeant Rehfeld waren dies Deutsche zweiter Wahl. Männer, die sich aus wirtschaftlichen Gründen und Unsicherheit zu einem lebensgefährlichen Dienst verpflichteten und im Grunde kaum eine Vorstellung davon hatten, um was es in diesem Krieg überhaupt ging. Er, Fürchtegott Rehfeld, und die Männer des 195sten New Yorker Infanterieregiments waren da ganz anders.
Sie waren Patrioten, die bereits in der deutschen Revolution mit der Waffe in der Hand für die Demokratie und die Rechte der Bürger eingetreten waren. Die mit Stolz in der Frankfurter Paulskirche den Grundstock einer Nationalversammlung und Verfassung gelegt hatten. Bis der preußische König und andere Fürsten die Demokratiebewegung mit Waffengewalt zerschlugen. So standen die meisten von ihnen, darunter auch Fürchtegott, im Jahre des Herrn 1848 vor der Wahl, im Gefängnis oder am Galgen zu enden oder ihr Heil im gelobten Land Amerika zu suchen. Ein Land, in dem das Volk durch das Volk und für das Volk von einem demokratisch gewählten Präsidenten und den Volksrepräsentanten regiert wurde. Die Entscheidung war nicht schwer gefallen.
Nun wurde diese Demokratie durch den Abfall der Südstaaten-Konföderation bedroht und ein rechter Demokrat und Patriot musste bereit sein, die Union mit der Waffe in der Hand zu verteidigen und wieder herzustellen.
Ja, es gab sie … Fürchtegott wusste, dass Deutsche auch auf Seiten der Rebellion kämpften. Doch das waren keine wahren Patrioten. Nicht im Sinne der Demokratie und Bürgerrechte. Das waren gemietete Söldner, die vor vielen Jahren den verlockenden Angeboten der Adelsvereine auf den Leim gekrochen waren. Damals stellten Adlige die Mittel für Reise und Ausrüstung, um mit einer Gemeinschaft, „ihrem“ Adelsverein, nach Amerika aufzubrechen und dort eine neue Heimat zu gründen. Etliche dieser Deutschen siedelten in Texas und natürlich waren sie an den Adligen gebunden. Nein, Fürchtegott war der festen Überzeugung, dass sich diese Deutschen einem System verpflichtet sahen, in dem Menschen als Sklaven gehalten wurden. Nicht wenige Deutsche begründeten ihren eigenen Wohlstand darauf, in dem sie selber Sklaven hielten. Sie unterstützten die Rebellion, da sie den eigenen Besitz gefährdet sahen.
Aber der Süden mit seinen Sklavenplantagen und Herrenhäusern würde bezwungen werden und reumütig in den Schoß der Union zurückkehren, davon waren Fürchtegott und seine Kameraden überzeugt, auch wenn es nicht sonderlich gut um die Sache der Union stand. Zwar hatte das nun scheidende Jahr 1863 den großartigen Sieg bei Gettysburg gebracht, doch die Rebellen kämpften unter ihrem General Lee mit einem Mut und einer Entschlossenheit, die einer besseren Sache würdig gewesen wäre. Ein Ende des Krieges war noch nicht abzusehen, aber im Frühjahr 1864 würde die Union vorrücken und endlich den Sieg erringen. Fürchtegott Rehfeld würde seinen Teil dazu beitragen. Er und seine Tausenden von deutschen Kameraden, die in diesem Tal am Potomac River versammelt waren.
Das Tal war weitläufig genug, um die vielen Regimenter aufzunehmen, und es wurde zwangsläufig größer, denn es war Winter, bitterkalt und die zahlreichen Öfen und Feuerstellen benötigten Holz, damit man heizen und warme Mahlzeiten zubereiten konnte. Die fortwährende Rodung dehnte sich immer weiter ins Land aus, denn Holz diente auch als Baumaterial, um die Seiten der kleinen A-Zelte, in denen die Mannschaften und Unteroffiziere vorwiegend untergebracht waren, mit ihm zu verkleiden und so besser gegen Wind und Kälte zu schützen. Da etliche Regimenter hier schon seit Kriegsbeginn stationiert waren und bei einigen bereits die Verpflichtungszeit endete, war inzwischen auch eine Reihe solider Holzbauten entstanden.
Medizinische Einrichtungen, Küchen, Messen, Händler und Depots für Versorgungsgüter jeglicher Art waren aus massiven Stämmen oder Bohlen errichtet worden. Die Quartiermeisterei herrschte über einen Tross aus über zweitausend Planwagen und eine große Remonte aus Gespann- und Kavalleriepferden. Das Corps umfasste Infanterie, Artillerie und Kavallerie nebst den unverzichtbaren Truppen und Einrichtungen für laufende Versorgung und Nachschub.
Die deutschen Divisionen gehörten zur Army of the Potomac, die bislang kaum in Erscheinung getreten war. Ihre bisherigen Kommandeure versammelten immer mehr Truppen unter sich und was an den eisigen Ufern des Flusses lagerte, wurde vom Rest der Armee und in der Bevölkerung schon spöttisch als „Lincolns Leibwache“ bezeichnet. Dies beruhte auf dem Umstand, dass die Army of the Potomac hauptsächlich rund um Washington eingesetzt wurde und für den Schutz der Hauptstadt der Union verantwortlich war. Doch selbst Abraham Lincoln, der Herr möge ihn schützen, drängte immer stärker darauf, dass sich die große Armee endlich in Bewegung setzen möge. Im Frühling, wenn der Boden wieder fest genug für die Bewegung der schweren Geschütze und Trosswagen war, würde das endlich geschehen, denn der neue Kommandeur machte einen entschlossenen und kämpferischen Eindruck. Im Juni, kurz vor der Schlacht von Gettysburg, hatte Major-General George S. Meade den Befehl übernommen. Inzwischen ging das Gerücht durch das riesige Lager, dass im kommenden Jahr Ulysses S. Grant zum Lieutenant-General und damit Oberbefehlshaber des Heeres ernannt werden sollte. Angeblich wollte er sein Hauptquartier dann bei der Army of the Potomac einrichten. Für Fürchtegott ein sicheres Zeichen dafür, dass es im Frühjahr tatsächlich losgehen würde.
Ja, für Sergeant Fürchtegott Rehfeld war die Welt in Ordnung. Bei Gettysburg hatte sich die Union gut geschlagen und nun, zwei Wochen vor Weihnachten, war Fürchtegott befördert worden. Nun trug er, neben der üblichen Ausrüstung eines Infanteristen, zusätzlich die rote wollene Schärpe eines Sergeants und führte, neben seinem Gewehr, einen Unteroffiziers-Degen und einen Revolver. Im Augenblick befehligte Fürchtegott die Fahnenwache des 195sten Regiments und so trug er die Schärpe quer vor der Brust, was ihn als Diensthabenden auswies.
Fürchtegott hatte einem menschlichen Bedürfnis nachgegeben und kehrte von den Latrinen, am großen Wall-Zelt des Colonels und den anderen Offizierszelten vorbei, zu seiner Position am Eingang des Regimentslagers zurück, wo die Hoheitsfahne der Union und die Fahne des Regiments aufgestellt waren. Derzeit wurden die bunt bemalten Seidentücher von Wachstuchhüllen gegen die Witterung geschützt.
Jetzt in der Nacht, bot das Lager einen besonders prächtigen Anblick. Jedes Regiment hatte seine Zelte streng nach dem Handbuch aufgebaut und den eigenen Lagerbereich mit Stangen oder Leinen gegen die benachbarten Einheiten abgegrenzt. Am Lagereingang standen Fahnen und Fahnenwache, die Color-Guard, dann folgten die zehn ordentlichen Reihen der kleinen A-Zelte der Kompanien. Am Ende dieser zehn parallel verlaufenden Reihen stand die Querreihe der Kompanieoffiziere. Dahinter die der Majore als Bataillonsführer und dann die Zelte des Colonels und des Lieutenant-Colonels. Aus verständlichen Gründen waren die Latrinen ein gutes Stück dahinter ausgehoben worden. Zwischen diesen und den Offizierszelten waren die zum Regiment gehörenden Trosswagen aufgefahren. Vor den Zelten leuchteten die kleinen hölzernen Laternen, hinter deren Glasscheiben Kerzen brannten. Viele Offiziere hatten diese allerdings durch Petroleumlampen ersetzen lassen. In der Nacht vermittelte das große Militärlager einen regelrecht romantischen Eindruck und sah so aus, als mache es dem klaren Sternenhimmel Konkurrenz.
Es ging auf 22:00 Uhr zu und bald würde das Signal „Lights off“ geblasen werden. Dank der Sterne und des Mondes würde das Lager aber nicht in Dunkelheit versinken, zumal an etlichen Stellen die Wärmefeuer der Wachen zu sehen waren, an denen sicher heißer Kaffee verfügbar war. Die „German Division“ litt keinerlei Not, wenn man davon absah, dass sich die Soldaten wärmende Handschuhe und Schals gewünscht hätten. Immerhin erhoben die Offiziere der Freiwilligenregimenter keine Einwände, wenn sich die Männer diese Utensilien von ihrem Sold bei einem der Händler erwarben.
Auch Fürchtegott war im Besitz dieser wärmenden Teile, dennoch hatte er das Cape seines himmelblauen Feldmantels geschlossen und spürte wie die Kälte in seine Glieder kroch. Es ging ein leichter, jedoch beißender Wind und der Sergeant sehnte das Ende seiner Wache und sein wärmendes Zelt herbei.
An einigen Stellen des Lagers waren Lieder zu hören. Oft die patriotischen der Union, aber auch viele Klänge, die an die frühere Heimat erinnerten. Fürchtegott war stolz auf das kleine Musikcorps des 195sten. Trommler und Pfeifer und dazu die Hornisten, die neuerdings die Befehlsübermittlung auf dem Gefechtsfeld mit ihren G-Hörnern übernahmen. Das Regiment hatte auch einen sehr passablen Chor, der den Kaplan beim nächsten Gottesdienst wieder mit kräftigen Lungen begleiten würde.
Schnee knirschte unter seinen Brogans, den genagelten Armeeschuhen. Der alte Schnee war verharscht und gefroren, aber seit zwei Stunden schneite es erneut. Nicht viel, doch am Morgen würden wieder nur die Spuren der Wachgänger zu sehen sein.
Fürchtegott näherte sich langsam dem Eingang zum Lager, wo seine acht Untergebenen ausharrten. Die Schlösser ihrer Springfield-Gewehre, Modell 1861, waren mit Tüchern umwickelt, in den Läufen steckten Mündungsschoner, die fatal an Wäscheklammern mit einem Griffstück aus Messing erinnerten. Sie verhinderten das Eindringen von Schnee oder Schmutz, die zu verhängnisvollen Hohlladungen führen konnten.
Halblaute Stimmen empfingen Fürchtegott und er nahm dankbar einen Becher mit heißem Kaffee entgegen.
„Irgendwas Neues, Fürchtegott?“, fragte der Corporal, der ihn in der Zwischenzeit vertreten hatte.
Er schüttelte den Kopf. „Was soll es schon Neues geben? Wieder einmal alles ruhig entlang dem Potomac in dieser Nacht.“
Fürchtegott blickte vom Lagereingang des 195sten Regiments das Tal entlang. Das 195ste war eine der zuletzt eingetroffenen Truppen und bildete derzeit den südlichsten Teil des Lagers. Hinter und neben ihm lagerte das XI. Corps, doch vor ihm erstreckte sich die schneebedeckte Ebene des Tals bis zum Ufer des Potomac River. Der Fluss war trotz seiner Strömung gefroren und jenseits des gegenüberliegenden Ufers waren in der Ferne die verwaschenen Leuchtflecken anderer Feuer zu sehen. Dort lagen die konföderierten Vorposten.
Der Feind sollte nicht mehr als zehn Meilen entfernt sein. Eine geringe Distanz, doch jetzt, im Winter, rechnete keine Seite mit einer größeren Aktion des Gegners. Ein paar Späher mochten neugierig durch die Gegend schleichen, vielleicht sogar ein paar Männer, die auf einen nächtlichen Handel zwischen den Linien hofften. Guter Yankee-Kaffee oder Dosenpfirsiche gegen guten Virginia-Tabak oder andere begehrte Dinge der Gegenseite. So war man also durchaus wachsam, jedoch nicht angespannt. Ein Späher mochte sich in Gefahr begeben, aber keine noch so starke Feindpatrouille würde sich mit dem Lager eines ganzen Unions-Corps anlegen. Dennoch gab es einige alarmbereite Kompanien und für den Fall der Fälle hielt sich auch eine stärkere Kavallerieabteilung bereit.
„Sind die Jungs vom 44sten schon zurück?“, erkundigte sich Fürchtegott. „Sie sind jetzt schon zwei Stunden drüben.“
Einer der Privates grinste breit. „Die haben Schinken, Zucker, Kaffee und Pfirsiche dabei. Da keine Schüsse zu hören waren, haben sie wohl einen Handelspartner getroffen. Bin gespannt, was sie mitbringen.“
„Was schon? Tabak und Whiskey“, knurrte ein anderer Infanterist. „Was anderes hat Virginia doch nicht zu bieten.“
Fürchtegott sah einen dunklen Schatten am Beginn des Tales, dort wo es wieder in dichten Wald überging. Der Schatten bewegte sich langsam und gemächlich am diesseitigen Ufer, was den Sergeant halbwegs beruhigte.
Der Corporal erhob sich und trat an seine Seite. „Sieht nach Kavallerie aus. Ist aber keine Patrouille von unseren Säbelschleppern draußen.“
„Sind auch zu viele für eine Patrouille“, erwiderte Fürchtegott. „Scheint mir ein Bataillon, wenn nicht gar ein Regiment zu sein.“
„Könnte hinkommen“, schätzte der Zwei-Winkel-Soldat. „In der Richtung liegen Centreville und Manassas Junction. Worauf setzt du, Fürchtegott? Ich auf Manassas und die dortige Bahnstation.“
„Du weißt, dass ich nichts vom Wetten halte, Georg. Das ist Sünde.“
„Schon gut, wollte dich nicht beleidigen“, versicherte der Corporal. Die Männer kannten die Gottesfürchtigkeit ihres Sergeants, der sich stets bereitwillig als Messdiener anbot, wenn der Regimentskaplan den Männern die heilige Gottesfurcht predigte.
Die meisten Männer waren sehr gläubig, was sie jedoch nur selten davon abhielt, Alkohol und Glücksspiele, wie Würfeln oder Karten, als Freizeitgestaltung zu nutzen. Für die Händler gab dies ein schönes Zubrot, denn vor jeder Schlacht wurden die Beweise sündigen Lebens fortgeworfen. Niemand wollte, dass sein Leichnam mit den Beweisen des Lotterlebens zur Familie oder in die Heimatgemeinde zurückgeschickt wurde. Nach der Schlacht waren neue Würfel und Karten dann heiß begehrt.
„Ich schätze, sie kommen von Manassas Junction“, sagte Fürchtegott schließlich. „Verstärkung für unser Corps.“
Erneut nickte einer der Privates. „Die Bahnstation ist nicht so weit entfernt. Zumindest dann nicht, wenn andere für einen selbst laufen. Die Säbelschlepper wollten sich den Aufbau des dortigen Nachtlagers sicher ersparen. Eine Stunde auf dem Gaul und sie können hier ihr richtiges Lager aufschlagen.“
„Bin gespannt, ob es welche von unseren Jungs sind“, gestand der Corporal. „Im Moment haben wir ja nur zwei deutsche Kavallerieregimenter hier, der Rest der beiden Brigaden sind waschechte Yanks oder Iren.“
„Ja, wäre schön, wenn noch ein paar Deutsche zu unserer 28sten New Yorker Freiwilligenkavallerie und den 4ten New Yorker Husaren stießen“, meldete sich der Private erneut zu Wort.
„Hm, das ist nicht nur Kavallerie.“ Fürchtegott leckte sich über die Lippen und nahm einen Schluck Kaffee. „Dahinter scheint mir auch Infanterie zu marschieren.“
„Ja, die Säbelschlepper sehen bei Paraden glänzend aus, aber die Königin des Schlachtfeldes ist und bleibt die Infanterie“, meinte der Corporal voller Stolz. „Was meinst du, Fürchtegott? Eine gemischte Brigade?“
„Möglich. Jedenfalls wird das nächtliche Unruhe ins Lager bringen“, seufzte der Sergeant. „Joachim, lauf zur Quartiermeisterei und sage dort Bescheid, dass weitere Verstärkung eintrifft.“
„Na, der Quartiermeister wird ganz schön fluchen“, lachte der Angesprochene auf. „Muss mitten in der Nacht aus seinem warmen Bettchen steigen, damit die Neuankömmlinge keine Unordnung ins Lagerleben bringen.“
Der Private legte sich das Gewehr in die Armbeuge und stapfte los. Er würde zwei Meilen zu gehen haben, bevor er auf die Quartiermeisterei stieß.
„Ich wette, der Quartiermeister weckt den Major-General Meade, um den über die Verstärkung zu informieren.“ Der Corporal grinste breit und schenkte Fürchtegott Kaffee nach. „Du kennst doch den Quartiermeister. Ein echt mieser und kleinkarierter Typ. Der wird den Meade wecken, obwohl das gar nicht erforderlich ist. Würde reichen, wenn der Befehlshaber beim Morgenrapport davon erfährt. Aber der Quartiermeister wird sich ärgern, mitten in der Nacht geweckt zu werden, und den Ärger wird er dann an Major-General Meade weitergeben.“
Fürchtegott Rehfeld hörte kaum auf den geschwätzigen Corporal. Irgendetwas störte ihn an der langsam herankommenden Verstärkung. „Sag mal, kannst du irgendwelche Fahnen oder Kompaniezeichen erkennen?“
Ein unbeschwertes Lachen. „Wo denkst du hin? Wir haben unsere Fahnen bei dem Dreckswetter doch auch schön in die Schutzhüllen gestopft.“
Die vordersten Reiter waren noch eine gute halbe Meile entfernt. Insgesamt mochten es an die vierhundert Kavalleristen sein, denen wenigstens die doppelte Zahl Infanteristen folgte. Die Formationen waren in sauberer Marschkolonne ausgerichtet. Die Soldaten hatten sich eng in ihre wärmenden Mäntel gehüllt und im Licht der Sterne und des Mondes versuchte Fürchtegott mit zunehmendem Zweifel die Farbe zu erkennen. Unions-Himmelblau oder Rebellengrau?
Die Spitze der Marschkolonne war nun kaum dreihundert Yards entfernt und es war an der Zeit, sie anzurufen. Trug sie Unions-Himmelblaue Feldmäntel oder Rebellen-Grau?
Dem gottesfürchtigen Sergeant entwich ein leiser Fluch, der auf die Heimat seiner Ahnen hinwies. „Kreizkruzefix, Himmiherrgott, Sakrament no a moi, warum sind in der Nacht bloß alle Katzen grau?“
Die Gesichtszüge des gutgelaunten Corporals gefroren. „Grau? Was redest du da von Grau?“
„Ich habe nichts von Grau …“, wollte Fürchtegott richtig stellen, als sich die ihm selbst gestellte Frage auch schon beantwortete.
Plötzlich war ein Hornsignal zu hören.
Die eben noch breite Marschkolonne schwärmte auseinander und verwandelte sich in unglaublicher Geschwindigkeit in eine doppelte Angriffslinie. Dann ertönte auch schon der durchdringende Rebellenschrei der Konföderierten. Die scheinbare Verstärkung ging zum Angriff über.
Es war eine Sache von Sekunden.
Fürchtegott Rehfeld blieb gerade noch die Zeit, den Kaffeebecher fallen zu lassen und das Gewehr hoch genug zu heben, um den Schlag mit dem schweren Kavalleriesäbel aufzuhalten. Die Wucht war so groß, dass die Klinge eine Kerbe in den Unterschaft schlug und Fürchtegott nach hinten geworfen wurde. Wahrscheinlich rettete ihm der Sturz in den Schnee das Leben, womit er mehr Glück hatte als seine Kameraden. Keiner der sechs Soldaten kam dazu die Waffe schussbereit zu machen und abzufeuern, sie wurden mit Säbeln niedergemacht.
Abermals tönte das Horn und das Angriffssignal der konföderierten Kavallerie wurde nun von anderen Hornisten aufgenommen. Über allem schien der Rebellenschrei die Luft zum Schwingen zu bringen.
Der Boden vibrierte unter dem Stampfen Hunderter von Hufen und viele der säbelschwingenden Reiter hielten in der anderen Hand ihre Faustfeuerwaffe, die Pferde mit den Schenkeln lenkend. Jetzt krachten die ersten Revolver und weckten das friedlich ruhende Lager des Unions-Corps endgültig auf.
Das 195ste New Yorker Infanterieregiment hatte als vorderste Einheit am schwersten zu leiden.
Die feindlichen Kavalleristen galoppierten die Zeltreihen entlang und schossen blindlings durch die Leinwände oder auf jeden Infanteristen, der sich im Eingang seines Zeltes zeigte. Die meisten der Soldaten wurden allerdings mit der blanken Klinge niedergestreckt, andere einfach über den Haufen geritten. Nur wenige Gewehre und Revolver erwiderten auf Unionsseite das Feuer.
Tiefer im Tal bliesen Hornisten das Alarmsignal. Halb bekleidete Infanteristen stürzten aus den Unterkünften und eilten zu den zwischen den Zeltreihen aufgestellten Gewehrpyramiden. Niemand wusste genau, was eigentlich vor sich ging, wo sich der Feind befand und wie stark er war, und wer es wusste, der konnte keine Meldung machen, da er vollauf damit beschäftigt war, irgendwie am Leben zu bleiben. Hektisch brüllende Unteroffiziere und Offiziere versuchten, so etwas wie Ordnung herzustellen und eine Verteidigung zu formieren.
Der Kommandeur des feindlichen Kavallerieregiments hielt sich nicht mit dem 195sten auf. Er trieb seine Truppe durch dessen Lager und schon dem nächsten entgegen. Die 195er warf er der nachfolgenden Infanterie zum Fraß vor. Die war hinter der Kavallerie zur Gefechtslinie ausgeschwärmt und rückte naturgemäß langsamer vor. Ihre Enfield-Gewehre krachten, dann war auch hier der Rebel-Yell zu hören und die Infanteristen stürmten mit gefälltem Bajonett in das Lager des Feindregimentes.
Bei den 195sten New Yorkern brach Panik aus.
Kaum jemand dachte noch an Gegenwehr, alles trachtete danach, sich in Sicherheit zu bringen. Fast die Hälfte der Überlebenden stürmte auf das Zelt des Colonels zu, denn hinter diesem standen die Wagen des Trosses und dahinter begann der nächtliche Wald, dessen Bäume Schutz verhießen.
Die scheinbare Sicherheit des Waldes war nur zu trügerisch.
Von der feindlichen Infanterie verfolgt, hetzten die Unionssoldaten auf den Schutz der Bäume zu, ohne sich dessen bewusst zu werden, dass dort Bewegung im Schatten war. Dann blitzte es entlang der Baumreihen auf, als ein dort in Stellung gegangenes Regiment das Feuer auf die entsetzten Yankees eröffnete.
Der Kommandeur dieses Infanterieregiments war ebenso fähig wie der Kavallerieführer. Kaum erkannte er, dass die Soldaten des 195sten zu keinem Widerstand mehr fähig oder willens waren, ließ er seine Truppe das Ziel wechseln und nahm nun das benachbarte Yankee-Regiment unter Beschuss.
Im Lager des XI. Unions-Corps ging es immer hektischer zu. Dennoch kam es nun allmählich zu einer geordneten Verteidigung. Truppen sammelten sich zum Gegenangriff. Noch immer saß der Schock tief, dass es die Konföderierten wagten, eine dermaßen überlegene Streitmacht der Union mit nur zwei Infanterieregimentern und einem schwachen Kavallerieregiment anzugreifen. Nicht wenige befürchteten, dass dies nur der Auftakt zu etwas Größerem sei, denn zehn Meilen jenseits des Potomac River mochten sich weitaus stärkere Feindkräfte bereithalten.
Entsprechend bereitete Major-General George S. Meade eine Bereitstellung am diesseitigen Ufer und eine starke Truppe für den Gegenangriff vor, während sich der Kampf im ersten Drittel des Lagers abspielte, wo die Union nun ihre Verteidigungslinien verstärkte und verdichtete. Eine volle Brigade aus drei Regimentern machte sich daran, die Rebellen im Wald in ihrer Flanke anzugreifen.
Der Befehlshaber der konföderierten Reiterei wusste, dass der nächtliche Angriff den maximalen Erfolg erbracht hatte und ein weiteres Gefecht mit dem Feind nur unnötige Verluste einbrachte. Wie mit den Kommandeuren der Infanterieregimenter abgesprochen, teilte er seine Truppe nun in ihre Kompanien auf, die jetzt dem Befehl folgten, die Yankees an ihren Flanken zu beunruhigen und deren Vorrücken so zu verlangsamen, dass sich die eigene Infanterie aus dem Kampf lösen konnte.
Die Absicht des Colonels gelang. Obgleich die eigene Infanterie doch einige schmerzliche Verluste erlitt, waren die der Yankees doch ungleich schwerwiegender.
Erleichtert ließ der Mann seine Hornisten zum Rückzug blasen, als sich die gegnerische Kavallerie endlich zur Gegenattacke formierte.
Eher zufällig kam der Offizier an jener Wache vorbei, die dem Angriff als Erstes zum Opfer gefallen war. Hier war es Sergeant Fürchtegott Rehfeld, der sich erneut jenem Mann gegenüber sah, der ihn beinahe getötet hätte. Jetzt sah derselbe Mann mit einem freundlichen Lächeln auf den verdutzten Unteroffizier hinunter, der mit erhobenen Händen vor ihm stand und scheinbar mit dem Leben abgeschlossen hatte.
„Nun, Sergeant, heute scheint ganz offensichtlich Ihr Glückstag zu sein“, hörte Fürchtegott zu seiner Überraschung in fast akzentfreiem Deutsch. „Sie leben noch und ich will mich nicht mit Gefangenen belasten. Übermitteln Sie Ihrem General Meade die besten Komplimente von Colonel Ronay und Ronny´s Raiders, und er solle nicht versuchen, unseren Besuch mit der gleichen Höflichkeit zu erwidern. Wir wären gut darauf vorbereitet.“
Der Colonel lüftete lächelnd seinen Hut, dann folgte er der Nachhut seiner Truppe in raschem Galopp, unbehelligt und unerreichbar für die Unionskavallerie, die nun vom gegenüberliegenden Talende heranpreschte.
Fürchtegott Rehfeld stand wie erstarrt, während die eigene Kavallerie an ihm vorbeijagte. Plötzlich war er von Unionsinfanterie umringt, in unterschiedlichsten Stadien der Bekleidung, doch allesamt bewaffnet und entschlossen zum Kampf. Viele hatten sich in der Eile lediglich Decke oder Feldmantel über das einteilige Unterzeug geworfen. Nun, da der Adrenalinspiegel wieder sank, machte sich für die Männer die Kälte bemerkbar.
Aufmerksame Blickte glitten über den Potomac zum gegenüberliegenden Ufer, wo nun eine kleine Gruppe von Soldaten sichtbar wurde. Es waren acht Soldaten der 44sten New Yorker Infanterie, die, mit getauschten Gütern der konföderierten Seite, unsicher herankamen und eine Menge böser Blicke ernteten.
Eher verlegen sah ihr Anführer einen wütenden Infanterie-Major an. „Wir, äh, haben getauscht. Wir haben erstklassigen Virginiatabak und …“
„Halten Sie Ihren verdammten Mund, Sergeant“, giftete der Major. „Während Sie daran dachten, sich die Wampe mit virginischen Spezialitäten vollzuschlagen, hat man uns hier den Hintern quer aufgerissen. Verschwinden Sie mir aus den Augen. Ihre Beute ist selbstverständlich beschlagnahmt. Für die Verwundeten. Dann haben Sie und Ihre Männer wenigstens einen kleinen positiven Beitrag zu dieser Unglücksnacht geleistet.“
Der Major hatte recht. Für das XI. Corps war es eine Unglücksnacht gewesen. Vier Regimenter hatten derartige Verluste an Toten, Verwundeten und Vermissten erlitten, dass sie insgesamt noch die Stärke eines einzigen Regiments aufbrachten.
Kapitel 2 Im deutschen Debattier-Club
Deutscher Debattier-Club, New York, im Mai des Jahres 1864
Ellis Island war eine kleine Insel, die zum Hafengebiet von New York gehörte. Hier trafen die Auswandererschiffe ein, vollgestopft mit Einzelgängern oder ganzen Familien, die ihr Glück im gelobten Land Amerika suchten, welches angeblich unbegrenzte Möglichkeiten bot. Amerika suchte nach neuen Bürgern und schickte seine Agenten in die verschiedensten Länder und die Menschen glaubten den Verlockungen und kamen. Iren, Italiener, Polen, Russen, Deutsche … Wer auf sein persönliches Wirtschaftswunder hoffte oder vor politischer Verfolgung floh, der suchte sein Glück in Amerika. Ellis Island und die Stadt New York waren der erste amerikanische Boden, den der Fuß des künftigen Neubürgers betrat.
Ein Teil der Stadt New York hatte inzwischen den Beinamen „Kleindeutschland“ erhalten, denn bereits im Jahr 1840 lebten dort über 50.000 deutsche Einwanderer. In den kommenden zehn Jahren landeten weitere 800.000 Deutsche in New York, wobei die meisten allerdings weiterreisten und in anderen Staaten, wie zum Beispiel Texas, siedelten.
Die Deutschen waren als neue New Yorker Bürger durchaus willkommen. Ihre Schulbildung und ihr handwerkliches Geschick lagen normalerweise weit über dem Durchschnitt der Einwanderer aus anderen Ländern. So würde im Jahr 1870 die Anzahl der deutschen Neubürger in New York auf über 170.000 steigen.
Nicht jeder Einwanderer fand sofort eine Wohnung oder einen Broterwerb. Die rührige deutsche Gemeinschaft hatte es sich früh zur Aufgabe gemacht, den Einwanderern zu helfen. Dies geschah auf praktische Weise, in der Vermittlung von Wohnraum oder Arbeit, aber auch auf der kulturellen Ebene. Deutschsprachige Bibliotheken, Schulen, Gesangsvereine, Kirchen, Sport- und Schützenvereine zählten ebenso dazu wie die heimatlichen Biergärten. Bäcker- und Bauhandwerk New Yorks waren in großen Teilen fest in deutscher Hand und viele der deutschen New Yorker engagierten sich politisch. Hier waren vor allem jene aktiv, die mit der Niederschlagung der demokratischen Revolution im Jahre 1848 zur Emigration gezwungen worden waren. Mancher deutsche Revolutionär und Demokrat hatte hier eine Zuflucht und neue Heimat gefunden, und setzte sich vehement für Demokratie und die Rechte der Bürgerschaft ein.
Es waren überwiegend Männer wie Carl Schurz, Franz Sigel, Gottfried Kinkel, Ludwig Blenker, Julius Stachel, Gustav Struve, Leopold von Gilsa, Frederick George D´Utassy, Friedrich Hecker und eine Vielzahl anderer Patrioten, die sich immer wieder in einem der deutschen „Debattier-Clubs“ trafen und sich politisch engagierten.
Die Clubräume strahlten das aus, was man als deutsche Gemütlichkeit bezeichnen konnte. Schwere Tapeten an den Wänden, diverse Ölgemälde, zu denen ein brünstiger und röhrender Hirsch ebenso gehörte wie ein Bild des Königs von Preußen. Nicht, weil er in diesen Räumen verehrt wurde, sondern weil er für einen echten Demokraten das Sinnbild eines verachtungswürdigen Despoten war, der die Revolution mit brutaler Waffengewalt im Jahr 1849 zerschlagen hatte.
Dicke Teppiche lagen auf dem Boden, auf denen gemütliche und gut gepolsterte Ohrensessel und Stühle standen. Auf Beistelltischen und Anrichten standen Karaffen mit verschiedenen alkoholischen Getränken. Diese wurden üblicherweise den amerikanischen „Ureinwohnern“ eingeschenkt, denn die Deutschen bevorzugten das hier selbst gebraute Bier.
Es ging auf den Abend zu. Kerzen und Lampen verbreiteten ein angenehmes Licht. Bedienstete kümmerten sich um das leibliche Wohl, denn Frauen waren in den Räumen des Debattier-Clubs nicht gerne gesehen. Noch immer haderten die Demokraten ein wenig mit Frauen, die sich gar in der Politik engagieren wollten.
An diesem Abend hatte Carl Schurz als Redner das Wort und er bezog sich auf einen Stapel in- und ausländischer Zeitungen, die den nordamerikanischen Bürgerkrieg thematisierten. Vor allem jene Passagen fanden das Interesse der Anwesenden, in denen die Leistungen der Deutschen, die in der Unions-Armee dienten, bezweifelt oder gar herabgesetzt wurden.
Für einen wahren deutschen Demokraten war es keine Frage, für welche Seite er sich in diesem Konflikt zu entscheiden hatte. Immerhin waren die U.S.A. die derzeit einzige funktionierende Demokratie in der Welt und diese Demokratie, diese Republik, war bedroht. Bedroht durch die Konföderation des Südens, in der Menschen als Sklaven gehalten wurden. Schön, es waren farbige Menschen, aber letztlich doch Menschen. Sklaverei war den Anwesenden ebenso ein Dorn im Auge wie die Feudalherrschaft des Südens mit ihren Plantagen und Herrenhäusern.
„Trotz des grandiosen Sieges über die Rebellion bei Gettysburg ist es noch immer nicht gelungen, den Süden endgültig in die Knie zu zwingen“, führte Carl Schurz aus. Er war ein schlanker Mann mit üppigem Vollbart und in einen tadellosen Anzug mit Gehrock gekleidet. Diesen hatte er wegen der Wärme im Raum geöffnet und die Daumen in die Taschen seiner Weste gehakt.
Der im Jahr 1829 geborene Schurz war in der preußischen Rheinprovinz geboren und hatte sich in den 1840er Jahren der demokratischen Bewegung angeschlossen. Er war an der bürgerlichen Märzrevolution 1848/1849 beteiligt gewesen und hatte von Mai bis Juli 1849 in der badischen Revolution gekämpft. Er war, nur zwei Tage vor der endgültigen Niederschlagung der Revolution, aus der Festung Rastatt entkommen und ins Exil gegangen. Über mehrere Zwischenstationen erreichte er 1852 mit seiner Frau Margarethe die U.S.A. Er war zunächst als Rechtsanwalt und Publizist tätig und schloss sich 1856 als entschiedener Gegner der Sklaverei der neu gegründeten Republikanischen Partei an. Hier kam er in engen Kontakt mit Abraham Lincoln, welcher ihn später während seiner Präsidentschaft für ein knappes Jahr als Botschafter nach Spanien entsandte. Bei Ausbruch des Bürgerkrieges war es für Carl Schurz jedoch unausweichlich, der amerikanischen Demokratie mit der Waffe in der Hand beizustehen. Er wurde zum Brigadier-General ernannt und befehligte eine deutsche Brigade aus New Yorker Bürgern. An diesem Tag tauschte er die Uniform gegen Zivil. So war es auch bei einigen anderen seiner Zuhörer.
„Erst Chancellorsville, dann Gettysburg und diesen Winter der Überfall auf unser XI. Corps. Und jedes Mal, wenn etwas schiefgeht, sind wir Deutschen daran Schuld“, beklagte Schurz mit einer Stimme, die verriet, wie sehr sein Stolz unter der allgemeinen Meinung in der Union litt.
Zustimmendes Gemurmel war zu den Worten des Sprechers zu hören.
„Eine Ungerechtigkeit sondergleichen“, stimmte Eberhardt Falkenberg zu. „Unsere Truppen wurden bei Chancellorsville von der Flankenbewegung der Rebellen unvorbereitet getroffen. Dabei wurde diese Truppenbewegung von unseren deutschen Regimentern beobachtet und an General Howard gemeldet. Mehrmals, wie ich betonen möchte, und Howard hat auf keine der Meldungen reagiert. Schließlich hat eine unserer Brigaden eigenverantwortlich umgruppiert, aber es war zu spät. Howard hat kläglich versagt und nicht unsere Truppen, doch uns gibt man die Schuld. Das ist empörend.“
Erneut gab es zustimmendes Gemurmel.
Fürchtegott Trautmayer, ein stämmiger Optiker, der aus Bayern stammte, stand neben der Anrichte, auf der die Zeitschriften lagen. Nun klopfte er auf den kleinen Stapel. „Die amerikanische Presse ist sich in unserer Verurteilung einig. Man bezichtigt uns Deutsche der Unfähigkeit, ja sogar der Feigheit und behauptet, es fehle uns an Patriotismus.“
Spöttisches Gelächter mischte sich mit wütenden Ausrufen.
Trautmayer war in ganz New York für die Qualität seiner Bifokal-Brillen bekannt, die er als Franklin-Gläser fertigte. Dabei wurde eine runde Metallfassung genommen, in deren obere Hälfte Gläser für die Fernsicht und in deren untere Hälfte jene für die Lesestärke eingearbeitet wurden. Eine diffizile Arbeit, die höchstes handwerkliches Geschick erforderte. Die Stimme des Optikers klang belegt, als er beschämt fortfuhr. „Diese Behauptungen sind so beschämend wie unwahr und selbst im königlichen Preußen widerspricht man der amerikanischen Presse mit äußerster Schärfe. Brüder im Geiste, ihr müsst euch das vor Augen führen: Ausgerechnet jene, gegen die wir einst in der Revolution kämpften, fühlen sich nun gemüßigt, uns zu verteidigen.“
„Schändlich und empörend!“, rief Franz Sigel, der ebenfalls als Brigadier-General der Sache der Union diente.
„Das ist es in der Tat.“ Carl Schurz hob die Hand, um die erregten Gemüter zu besänftigen. „Und ich habe eine Idee, wie wir allen das Gegenteil dieser schmählichen Behauptungen beweisen können. Doch bevor ich euch allen diese Gedanken antrage, will ich noch über die Sache der Union sprechen und wie sie im Ausland gesehen wird.“
„Die Engländer sind strikt neutral“, warf ein Bäckermeister ein, „wobei wohl jeder weiß, dass sie die Rebellen mit Waffen, Schiffen und sogar Matrosen für deren Navy unterstützen.“
„Viele der feudalistischen Monarchien in Europa sind durch die demokratische Republik der Union beunruhigt“, bestätigte Schurz. „Ich konnte das in Spanien immer wieder aus Begegnungen mit den Diplomaten anderer Länder heraushören. Man befürchtet, die Demokratie könne Schule machen und zur Abschaffung der Monarchien führen.“ Gelächter breitete sich aus und entspannte die herrschende Stimmung. „Andererseits gibt es auch Monarchen, welche die Sache der Union ausdrücklich unterstützen. So hat der König von Siam unserem Präsidenten Abraham Lincoln fünfundzwanzig seiner besten Kriegselefanten angeboten.“
Einer der Anwesenden hob die Hand und zog ein Papier aus seiner Gehrocktasche. „An dieser Stelle erlaube ich mir, aus einem außergewöhnlichen Brief zu zitieren, in dem sich dessen Verfasser ebenfalls entschieden für die Sache der Republik einsetzt.“
„Nun, lassen Sie hören, Herr Wankel“, antwortete Schurz und lächelte. „Wir alle wissen ja, dass Sie immer wieder auf interessante Begebenheiten stoßen.“
Wankel lächelte erfreut und las ab. „Die Arbeiter Europas fühlen sich dem starksinnigen, eisernen Sohn der Arbeiterklasse, Abraham Lincoln, verbunden und sind von der Überzeugung durchdrungen, dass, wie der amerikanische Unabhängigkeitskrieg eine neue Epoche der Machtentfaltung für die Mittelklasse einweihte, so der amerikanische Krieg gegen die Sklaverei eine neue Epoche der Machtentfaltung für die Arbeiterklasse einweihen wird. Der Krieg der demokratischen Republik gegen die sklavenhaltende Oligarchie ist eine weltverändernde revolutionäre Bewegung.“ Er ließ das Blatt sinken. „Veröffentlicht in ‚Die Presse‘ in Wien, Ausgabe Nummer 293 vom 25.10.1861 und der Verfasser ist der uns sicher bekannte Karl Marx.“
(Anmerkung: Viele Kommunisten und Sozialisten unterstützten die Sache der Nordstaaten-Union, da sie in der Republik die Stärkung der Bürgerschaft sahen und darauf hofften, das amerikanische Vorbild werde nach Europa übergreifen. Es gab allerdings auch anderslautende Stimmen. Dass Karl Marx seine Auffassung im Verlauf der Jahre nicht änderte, beweist die erneute Veröffentlichung des besagten Textes in „Der Sozialdemokrat“, Ausgabe 3, vom 30. 12.1864.)
„Jeder vernunftbegabte Bürger kann die Sache der Union nur unterstützen“, sagte Schurz im Brustton der Überzeugung.
„Leider werden Länder nicht von vernunftbegabten Bürgern, sondern von Monarchen oder Politikern geführt“, kam ein bissiger Kommentar.
Franz Sigel räusperte sich. „Meine Herren, so interessant der Blick ins Ausland auch sein mag … Mich interessiert doch sehr viel mehr, dass unser Bruder Schurz vorhin erwähnte, er habe eine Vorstellung davon, wie wir unseren deutschen Soldaten in der Union wieder zu einem gerechten Bild verhelfen können.“
Sofort kam die Empörung über die amerikanische Presse wieder hervor.
„Ja, das würde mich auch interessieren!“, rief Trautmayer. „Deutsche Männer bluten für die Republik und ihre Ehre muss wieder hergestellt werden!“
Sigel schlug die Beine übereinander und lehnte sich zurück. „Vielleicht lässt uns unser Bruder nun an seinen Gedanken teilhaben?“
Carl Schurz blieb keine Wahl und im Grunde waren seine Vorstellungen auch der eigentliche Grund, weswegen er an diesem Tag den Debattier-Club aufgesucht hatte. „Wohlan, an mir soll es nicht liegen. Man bezichtigt unsere deutschen Patrioten der Unfähigkeit und Feigheit. Diese schändlichen Stimmen werden erst verstummen, wenn wir den unwiderlegbaren Gegenbeweis antreten.“
„Und wie soll das geschehen?“
„Indem unsere deutschen Truppen einen Coup gegen die Rebellen landen, der ihren Mut, ihre Entschlossenheit und ihre Fähigkeiten als Soldaten beweist.“