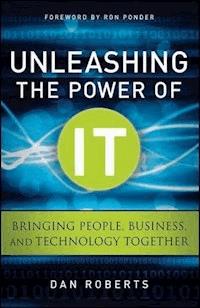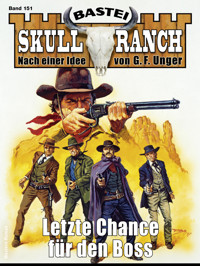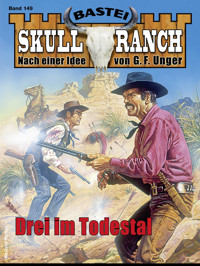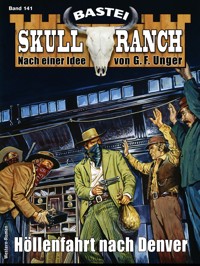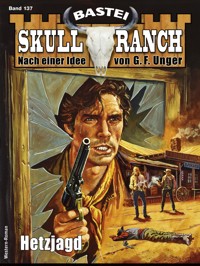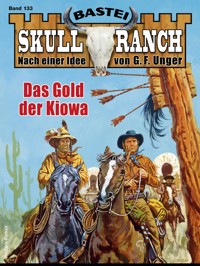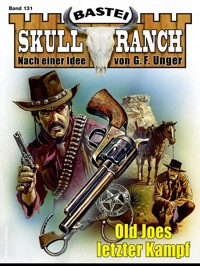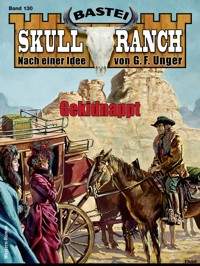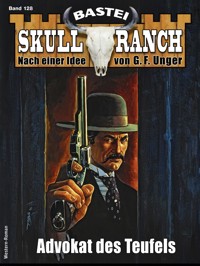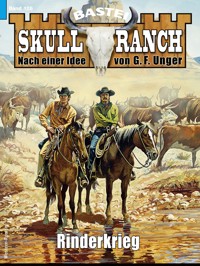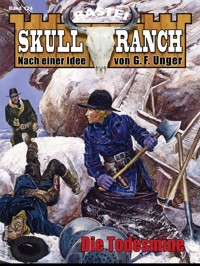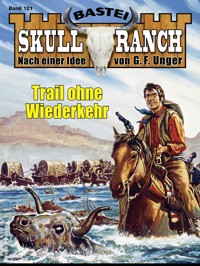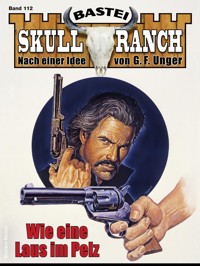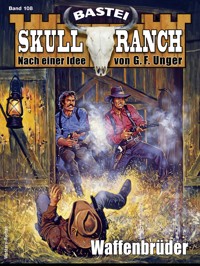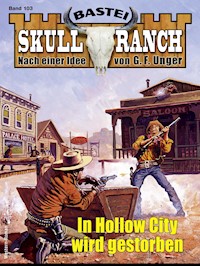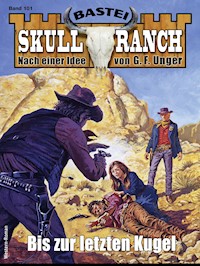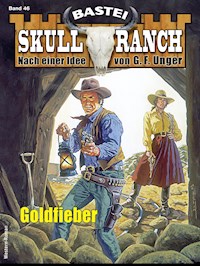
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Skull Ranch
- Sprache: Deutsch
Leroy Spade erstarrt, als die Schussdetonation die friedliche Stille zerreißt. Die Kugel trifft Jeff Gilmore, und der Junge bricht bewusstlos zusammen. Spade, der im Auftrag der Skull-Ranch nach Wyoming kam, entgeht nur knapp dem heißen Blei des Heckenschützen.
Aber der erfahrene Raubwildjäger zahlt es dem heimtückischen Gunslinger heim! Und damit beginnt das tödliche Spiel! Leroy Spade kennt den Einsatz noch nicht. Doch der ist hoch: Ein Leben für eine Handvoll Nuggets!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Goldfieber
Vorschau
BASTEI LÜBBE AG
Vollständige eBook-Ausgabeder beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
© 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Faba / Norma
eBook-Produktion:3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 9-783-7517-0850-0
www.bastei.de
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Goldfieber
von Dan Roberts
Leroy Spade erstarrt, als die Schussdetonation die friedliche Stille zerreißt. Die Kugel trifft Jeff Gilmore, und der Junge bricht bewusstlos zusammen.
Spade, der im Auftrag der Skull-Ranch nach Wyoming kam, entgeht nur knapp dem heißen Blei des Heckenschützen. Aber der erfahrene Raubwildjäger zahlt es dem heimtückischen Gunslinger heim!
Und damit beginnt das tödliche Spiel! Leroy Spade kennt den Einsatz noch nicht. Doch der ist hoch: Ein Leben für eine Handvoll Nuggets!
Es ist früh am Abend. Die Sonne taucht die grauen Felsspitzen der fernen Sawatch Mountains in goldenen Schein.
Ein leichter Wind bewegt die Zweige und Blätter der Ahornbäume, die sich vom Fuß der Berge die Steigung hinaufziehen.
Und die Blätter glänzen wie blankpoliertes Silber im letzten Schein der Abendsonne.
John Morgan, der Gründer und Boss der Skull-Ranch, lehnt an der Seitenwand der Scheune, in der seine Männer das Winterheu lagern.
John, der ehemalige Major der Rebellenarmee, ist sich nicht im Klaren darüber, ob er zufrieden sein kann. Er baute mit einer Handvoll Männer die Skull-Ranch auf. All diese Männer blieben ihm treu. Sie verzichteten manches Mal auf ihren Lohn, wenn die Dollars knapp waren, aber Doc Smokys Kochkünste entschädigten die Burschen wieder.
Aber Morgan, dessen Blick der pulvergrauen Augen sich in der Ferne verliert, spürt, dass die Ruhe im Tal, im Bluegrass Valley trügerisch ist.
Banditen, versprengte Deserteure der Kavallerie und halb verhungerte Goldsucher zwangen ihm und seinen Getreuen bereits harte Kämpfe auf.
»Das Tal ist zu groß«, murmelt John.
Und sein Gesicht nimmt einen entschlossenen Ausdruck an. Er, der früher den Kriegsnamen Stonewall Morgan trug, als er noch in der Konföderierten-Armee diente, wird sich wahrhaftig wie ein Felsen gegen alles stemmen, das der Ranch schaden kann.
Aber genauso gut ist seine Pflicht, dafür zu sorgen, dass er alles erfährt, was ihm, seiner Tochter Mary-Lou und den Männern nutzt.
Vor wenigen Tagen kam John aus Denver, der Hauptstadt des Territoriums zurück.
Und dort erfuhr er etwas, das ihn sehr nachdenklich macht.
Morgan war kein Rindermann. Er besaß vor dem Krieg, dem brutalen Kampf zwischen Norden und Süden, eine Baumwollplantage in Alabama.
Doch all dies wurde zerstört.
Leroy Spade, der Raubwildjäger aus Colorado, erzählte John von den herrlichen Blaugrastälern in Colorado.
Und John zog mit seinen Rindern, mit Brazos, Shorty und Doc Smoky den gefahrvollen Weg nach Westen und nahm eines der größten Täler, das Bluegrass Valley, in Besitz.
Sicher, inzwischen ist die Ranch gesund. Und inzwischen wurde aus dem Baumwollpflanzer ein genauso guter Rindermann, wie es die Rancher in Kansas, New Mexico und Texas sind.
Doch ohne Brazos, den hünenhaften Cowboy, seinen kurzbeinigen Freund Shorty und Doc Smoky, dem alten, erfahrenen Koch, hätte es John oft nicht geschafft.
Morgan bleibt an der Ecke des Küchenhauses stehen und beobachtet seine Tochter Mary-Lou, die auf der Veranda den Tisch deckt.
John Morgan hat seine Stamm-Mannschaft zum Essen eingeladen.
Er will mit den erfahrenen Männern besprechen, was er in Denver hörte, und anschließend seine Entscheidung treffen.
Kurze Zeit später schleppt Doc Smoky ein riesiges Tablett an John vorbei. Und wenige Minuten später schreit der alte Koch, dessen Gesicht einem rissigen, verwitterten Bild gleicht: »Kommt und holt es euch, oder ich werfe es weg!«
Es ist der traditionelle Ruf der Trailköche, und mancher wartete nicht lange auf die Treibherdenreiter, sondern feuerte das Essen in die Flammen, wenn die Kerle sich zu viel Zeit ließen.
Shorty, Brazos, Chet Quade und General Carrington setzen sich an den großen Tisch aus gehobelten Brettern und warten, bis Mary-Lou die Teller gefüllt hat.
Alle blicken den Rancher an, der die Stufen des Vorbaus hinaufsteigt.
John Morgan hält eine kurze, eine ganz kurze Rede.
»Freunde«, beginnt er, »ohne euch hätte ich es bis heute nicht geschafft. Die Ranch ist gesund, wir besitzen eine Menge Rinder, die einfach verrückt viel Mavericks hervorbrachten. Aber es geht weiter. Ich weiß nicht, ob wir in zehn Jahren mit Longhorns noch Geld verdienen können. Und diese Ranch ist mein Leben. Nach dem Essen erzähle ich euch, was ich in Denver vor ein paar Tagen hörte. Und dann möchte ich eure Meinung wissen, denn ihr seid erfahrene Rindermänner, und ich bin doch nur ein Baumwollpflanzer aus Alabama.«
»So ist es, Sklavenhalter«, sagte Leroy Spade spottend von der Hausecke her.
Der Raubwildjäger setzt sich an den Tisch. Und wie alle anderen isst er und lässt es sich gefallen, dass Mary-Lou nach mehr als einer halben Stunde Kaffee einschenkt.
Die ersten Zigaretten werden gerollt.
Die Glutpunkte des Tabaks leuchten wie Glühwürmchen in der beginnenden Dunkelheit.
»Also, John, was willst du uns erzählen?«, fragt Chet Quade neugierig.
»Ich hörte in Wyoming, dass ein Rancher namens Brennan versucht, die zähen, widerstandsfähigen Longhorns mit Englischen Bullshort-Rindern zu kreuzen«, sagt Morgan. »Die Bullshorts sind Fleischtiere, die auf dem Viehmarkt oder den Auktionen höchste Preise erzielen. Aber bisher hatten nur die kleinen Züchter im Osten, im geschützten Land, Erfolge. Ich möchte eure Meinung dazu wissen. Ist es möglich, hier Shorthorns zu halten?«
John Morgans letzter Satz liegt noch in der Luft, als der kleine Shorty spricht.
»Vergessen Sie das, Boss«, rät der Cowboy. »Diese Viecher sind gut, ja, aber sie werden die Winter hier nie überstehen. Vielleicht könnte es eine Kreuzung aus Longhorns und den Fleischrindern schaffen, aber ich bin nicht sicher. Wyoming ist noch härter im Winter, und vielleicht hat dieser Brennan dort oben schon einen Erfolg?«
»Wir sollten hinreiten und nachschauen«, grollt Brazos mächtige Stimme.
Länger als eine Stunde sprechen die Männer über das Gerücht, das der Boss in Denver aufschnappte.
Und sie kommen zu dem Schluss, dass wirklich nur eins übrig bleibt: nämlich hinzureiten und nachzusehen, was an der Sache dran ist.
»Wie ist es, Shorty, nimmst du mich mit?«, fragt Leroy Spade.
»Heee, lass mir den Zwerg hier«, grollt Brazos. »Wenn er reitet, reite ich auch.«
»Ich kenne Wyoming einigermaßen«, sagt der Raubwildjäger. »Manchmal hielt ich es früher nicht mehr aus, ich wollte einen langen Trail machen, etwas anderes sehen, und dann zog ich bis Montana. Aber ich brauche einen Rindermann bei mir, und ich denke, Shorty reitet mit.«
»Nun ja, ich kann mich ja ein wenig erholen, wenn der Giftzwerg weg ist«, sagt Brazos dunkel. »Ich bin nämlich richtig schwach geworden, weil ich den Kleinen immer aus den Maulwurfslöchern herausziehen muss, wenn er auf dem Boden läuft.«
Wie ein Korken aus der Flasche, so springt Shorty von seinem Stuhl hoch.
Aber John Morgan sagt: »Schon gut, Shorty, lass Brazos nur. Wir haben eine Menge Schmiedearbeit für ihn, und da wird ihm das Spotten vergehen.«
Der Rancher schaut Spade an und nickt ihm zu.
»Einverstanden, nimm den Kleinen mit«, sagt John. »Er kennt sich mit den gehörnten Biestern verdammt gut aus. Wann macht ihr euch auf den Weg?«
»Morgen früh«, ruft Shorty, »je eher ich diesen dicken Bullen Brazos nicht mehr sehe, umso schneller geht es mir besser!«
Und am anderen Morgen machen sich die beiden äußerlich so ungleichen Männer auf den langen Ritt nach Norden.
General Carrington winkt mit seinem alten Säbel, als die Männer den Ranchhof verlassen.
Morgan sieht ihnen nach, bis sie nur winzige Punkte auf dem weiten Blaugrasland sind.
Leroy reitet neben Shorty, dessen Lieblingspferd Rosinante eine Kolik hat. So muss sich der Cowboy mit einem Weidepferd begnügen.
»Brennan«, sagt der Kleine nach einer Weile, »den Namen habe ich noch nie gehört. Aber von Wyoming wissen wir überhaupt kaum was. Weißt du, wo du diese Ranch finden könntest?«
Und am späten Nachmittag klettern die Pferde einen Hang hinauf, der auf einem weiten Plateau endet. Heiß brennt die Sonne auf den Granit.
Shortys Pferd ist nicht so zäh wie Spades Grauer. Das Weidepferd rutscht mit der Hinterhand etwas ab, und auf einmal wiehert es grell.
Der kleine Shorty sitzt plötzlich auf einem Gaul, der verrückt geworden ist!
Das Tier stieg vorne hoch, wiehert vor Angst und Schmerz und schmettert die Hufe auf den Felsboden. Abermals rutscht es mit der Hinterhand eine kleine Schräge hinab und schreit wie ein Kind, das von Schmerzen gequält wird.
Auf einmal steht es still. Ein Zittern überläuft den Körper, und wie vom Blitz getroffen bricht es zusammen.
Shorty reißt die Beine aus den Steigbügeln und schnellt sich aus dem Sattel.
Aber der Kleine schafft es nicht ganz. Sein linker Unterschenkel steckt unter dem schweren Pferdeleib. Nur mühsam unterdrückt Shorty einen Schmerzensschrei.
Und dann hört er das Geräusch.
Ein scharfes Rasseln lässt dem Cowboy das Blut schier in den Adern gefrieren.
Klapperschlangen!
Leroy Spade galoppiert heran, reißt den Revolver aus dem Holster und schießt dreimal in schneller Folge.
»Sieht böse aus, Shorty«, sagt der Raubwildjäger.
Er scheidet mit seinem Beil eine junge Fichte ab und benutzt den Stamm als Hebel. Schwerfällig wälzt sich der Cowboy unter dem Pferdeleib hervor.
Und als er aufsteht, auftreten will, knickt das linke Bein einfach unter ihm weg.
Leroy untersucht es und sagte nach einer Weile: »Es ist ein glatter Bruch, Kleiner. Du musst zur Ranch zurück.«
Erbittert flucht der mutige kleine Mann wie ein Maultierkutscher.
»Mist«, sagt er endlich, »jetzt schleppst du mich zurück und machst dich erneut auf den Weg.«
Spade lächelt und fragt: »Macht es dir was aus, wenn dich Kiowa zurückbringen?«
»Natürlich nicht«, antwortet Shorty.
Spade legt den Kopf in den Nacken und stößt einen gellenden Schrei aus.
Nach langen Minuten kommt Antwort.
»Sie werden in einer halben Stunde hier sein«, sagt Leroy und schneidet kräftige Zweige zurecht, mit denen er Shortys Bein schient.
Und nach kaum dreißig Minuten tauchen acht rote Krieger zwischen den Felsen auf.
Shorty wird es doch ein wenig mulmig, aber Leroy spricht mit den Kiowa in ihrer Sprache. Und als der kleine Cowboy das freundliche Grinsen auf den rotbraunen Gesichtern sieht, ist er erleichtert.
Die Kiowa verschwinden zwischen den Bäumen. Kurze Zeit später bringen sie eine Menge geschmeidiger Äste heran, aus denen sie eine Trage bauen.
Und eine halbe Stunde später sagt Shorty schief lächelnd zu Leroy Spade: »Mach's gut, Jäger. Lass dir keinen Bären in Wyoming aufbinden, es geht um die Skull-Ranch.«
Der Mountainman sieht den Indianern und dem winkenden Shorty nach, bis sie verschwunden sind.
Spade geht zu dem toten Pferd hinüber, das die Krieger um den Sattel erleichterten, und schaut auf die drei toten Klapperschlangen. Es sind ausgewachsene Tiere, und ein einziger Biss hätte für das Pferd genügt. Die Schlangen sonnten sich auf dem heißen Felsboden, und Shortys Tier hatte ganz einfach Pech.
Leroy pfeift seinem Grauen und schwingt sich in den Sattel.
Tage später überschreitet Spade die Territoriumsgrenze nach Wyoming.
Er hat einen einsamen Ritt hinter sich. Nur manchmal traf er Indianer, die sich zumeist in der Fingersprache mit dem Weißen unterhielten.
Er hört von den roten Männern, dass endlose Siedlertrecks durch Wyoming ziehen. Die Weißen wollen weiter nach Westen, in das gelobte Land Oregon, in dem Milch und Honig fließen sollen.
Leroy verzieht das Gesicht, als er daran denkt.
All diese Siedler drängen Jahr für Jahr weiter nach Westen. Sie bebauen das Land, erstellen Kirchen, Schulen und Wohnhäuser. Und ein Mann, der das freie Leben liebt wie Spade, ist ständig auf dem Rückzug.
Aber noch ist der Westen weit, und in den Rockys gibt es noch genug Wild, um einen Trapper zu ernähren. Außerdem liebt Leroy die Skull-Ranch. Dort hat er eine Heimat gefunden.
Vielleicht liegt es auch daran, dass er sich mit John Morgan versteht, als seien sie Brüder.
Obwohl der Raubwildjäger über all diese Dinge nachdenkt, ist sein Instinkt doch hellwach.
Und so entgehen ihm auch nicht die Spuren.
Ein Weißer, ein leichter Mann, ging hier. Die Fußballen sind tiefer in den weichen Boden eingegraben als die Zehen. Und außerdem ist die Innenfläche des Fußes abgezeichnet, und kein Indianer läuft anders als auf den Außenseiten seiner Füße.
Und nach ein paar Minuten findet Leroy die erste Falle.
Er steigt nicht ab, o nein. Er sieht schon aus dem Sattel, dass ein blutiger Anfänger dieses Schlageisen aufstellte.
Leroy Spade schüttelt leicht den Kopf.
Kein Tier wird in diese Falle gehen.
Die Spuren des Jägers führen genau nach Norden. Leroy, ganz in Hirschleder gekleidet, zupft an den Zügeln.
Der Graue geht an.
Er folgt dem schmalen Weg, der sich zwischen jungen Hemlocktannen dahinschlängelt. Zwei kahle Felsausläufer, mehr als zwanzig Yards hoch, schieben sich wie die Buckel einer Schildkröte bis an den Weg.
Und als Leroys Grauer genau zwischen diesen Hindernissen ist, knallt ein Schuss.
Sofort zügelt Spade den Grauen.
Der Knall war dünn, aber die Felsen und die Bäume verfälschen das Geräusch. Es war ein Revolver, denkt Leroy, und er schnalzt mit der Zunge.
Der Graue fällt in Trab und bewältigt mühelos die Steigung.
Leroy blickt in eine weite Senke hinab, als er den höchsten Punkt erreicht.
Der Raubwildjäger kneift die Lider etwas zusammen und holt nach ein paar Sekunden sein Fernglas aus der Satteltasche.
Nachdem er den schwarzen Punkt, der in etwa vierhundert Yards liegt, in den Linsen des Glases stark vergrößert sieht, treibt Spade sein Pferd an.
Ein Mann, ein junger schmächtiger Mann liegt dort.
Und er liegt reglos, bewegt sich nicht.
Leroy verspürt eine Warnung in sich. Seine Rechte tastet nach dem Revolver, den er ziemlich tief an der Hüfte trägt.
Mit einer gewohnheitsmäßig wirkenden Bewegung zieht Spade die Winchester aus dem Scabbard und hebelt eine Patrone in die Kammer.
Das Gewehr liegt quer über den Knien, und im Bruchteil einer Sekunde kann er feuern.
Leroy blickt nach links.
Er ist ganz sicher, dass sich der Schütze dort, zwischen den halbhohen Douglasfichten verbirgt. Die dichten Äste der Bäume reichen bis auf den Boden, und sie bieten eine hervorragende Deckung.
Leroy leitet sein Pferd nach rechts. In der Deckung einiger Felsbrocken schwenkt er ab. Er muss eine Möglichkeit finden, hinter die Baumgruppe zu gelangen.
Und er muss dem reglosen Trapper dort unten helfen.
Denn ein ungeschriebenes Gesetz der Mountainmen verpflichtet sie, jedem Kameraden, der in Not ist, zu helfen.
Der schmächtige Bursche ist zwar ein mächtig schlechter Fallensteller, aber er gehört der Gesellschaft der Rockymen an.
Der Graue lässt die Ohren spielen.
Leroy schwingt sich aus dem Sattel und klopft dem Pferd den Hals. Zufrieden prustet das Tier und senkt den Kopf, um die spärlichen Bergkräuter abzurupfen, die hier wachsen.
Spade geht mit langen, gleitenden Schritten zu dem ausgetrockneten Bachbett, das er entdeckte.
Prüfend blickt er hinein.
Diese Rinne in den Felsen führt nur im Frühjahr Wasser, wenn der geschmolzene Schnee zu Tal rinnt.
Und jetzt dient sie Leroy als Deckung!
Denn das Bachbett verläuft so, dass es hinter der Baumgruppe vorbeiführt.
Spade kriecht nach Indianerart voran. Sorgsam achtet er darauf, dass sich keiner der herabgespülten Steine löst und davonpoltert.
Noch nicht einmal ein feiner Staubfaden steigt auf, während Spade vorwärtskriecht. Er bewegt sich wahrhaftig wie ein Indianer, und er hat auch die Geduld der roten Männer.
Vorsichtig hebt er nach fast zehn Minuten den Kopf.
Er kneift die Lider zusammen, denn er muss gegen die Sonne blicken.
Es ist nicht mehr weit. Nur noch wenige Yards, dann hat er die Fichten erreicht. Und wenn die Bäume dem unbekannten Gegner Deckung gewähren, so sind sie auch für Leroy gut genug.
Er kriecht weiter. Und als der Schatten der weit ausladenden Äste über die Rinne fällt, verharrt der Raubwildjäger.
Er lauscht beinahe zwei Minuten lang. Nichts rührt sich.
Spade wagt es.
Er schnellt sich hoch und rollt sich blitzschnell über die Uferböschung. Die Winchester hält er dicht an seinen Leib, während er sich dreimal um sich selbst dreht.
Und dann liegt er wieder reglos. Dichtes Gestrüpp, Beerenranken und kleine Laubbäume decken ihn.
Nach langem Verharren steht Leroy halb auf.
Er sieht sich um. Prüfend mustert er jede nur mögliche Deckung.
Und gleitet er in den Schlagschatten der mächtigen, alten Douglasfichten und bewegt sich wie ein Schemen weiter.
Der dichte Teppich aus Fichtennadeln macht seine Schritte unhörbar. Leroy trägt Ledermokassins. Er ist darauf angewiesen, sich lautlos zu bewegen, wenn er dem Wild nachstellt. Und Stiefel, Cowboystiefel sind für die Jagd vollkommen ungeeignet.
Nach längerer Zeit bleibt Spade stehen.
Zwischen den Stämmen der Bäume schimmert helles Sonnenlicht und gibt den Blick auf die freie Fläche vor der Waldung frei.
Hier, in unmittelbarer Nähe muss der Schütze lauern, der den schmächtigen Trapper erwischte.
Und dann sieht Leroy den Mann.
Er lehnt an einer dicken Fichte und hält seinen Revolver nachlässig in der Hand. Die Mündung zeigt nach unten, auf den Waldboden.
Und nachdem Spade die helle Fläche außerhalb des Waldes genau gemustert hat, erkennt er auch den reglosen Körper des Fallenstellers.
Spade wechselt seinen Standort.
Nach kaum einer Minute steht er seitlich des heimtückischen Schützen. Der Bursche hat ein scharf geschnittenes Gesicht. Er macht den Eindruck eines Lohnschießers, eines bezahlten Revolvermannes, der ganz kalt einen Auftrag ausführt.
Leroy atmet gleichmäßig durch und zieht seinen Colt.
Und dann bewegt sich der Trapper dort vorn!
Der Schießer hebt seinen Revolver, wartet eine Sekunde und zielt genau.
Sein Gesicht wirkt aus der kurzen Entfernung von zwölf Yards gleichmütig. Es ist ja nur ein Job für ihn!
Leroy spannt den Hahn seiner Waffe.
Überlaut klingt das metallische Knacken durch die Mittagsstille.
Der Lohnschießer wirbelt herum. Wie ein riesiger Zeigefinger deutet der Lauf seines Revolvers auf die Stämme.
»Sei froh, dass er noch lebt, Revolverheld«, sagt Leroy laut.
Und da kracht der erste Schuss!
Heiß fährt das Blei an Spades Kopf vorbei und fetzt die Rinde vom Stamm einer Fichte.
Leroy zielt kurz und drückt ab. Er will den Mann nur verwunden, denn er möchte herausfinden, aus welchem Grund der Falkengesichtige auf den Trapper schoss.
Aber der Lohnmörder erkannte wohl Leroys günstige Position und warf sich zur Seite, um in bessere Deckung zu gelangen.
Er musste das Blei voll nehmen.
Spade weiß, dass der Mann tot ist.
Mit einem Gefühl der Bitterkeit lädt er den Colt und steckt ihn ins Holster. Und zum ersten Mal wünscht sich Leroy, dass er seinem Wandertrieb nicht nachgegeben hätte.
Er läuft mit federnden Schritten voran.
Der Falkengesichtige ist tot. Seine Augen starren blicklos gegen die dichten, grünen Äste der Douglasfichten.
Leroy steigt mit einem großen Schritt über den Mann hinweg und geht zu dem schmächtigen Trapper, der sich gerade hochstemmt.
Verständnislos starrt dieser Bursche, der noch ein Junge ist, Leroy an.
»Warum, Mister?«, fragt er schwach, kaum hörbar, »warum haben Sie auf mich geschossen?«