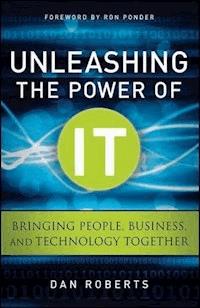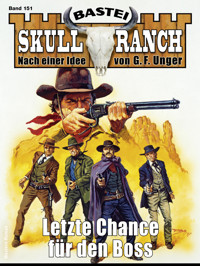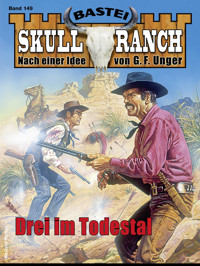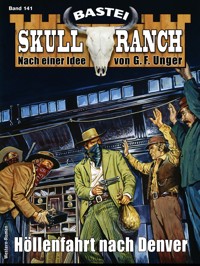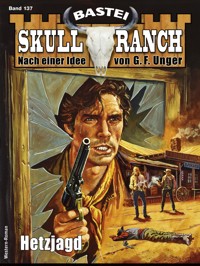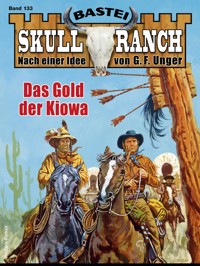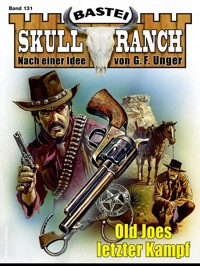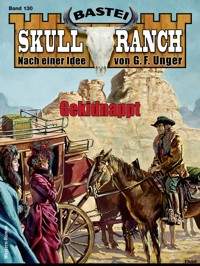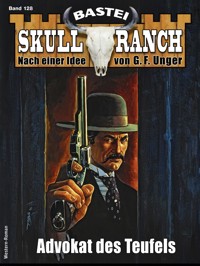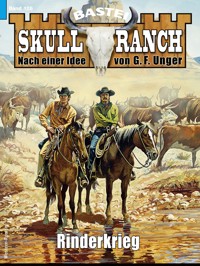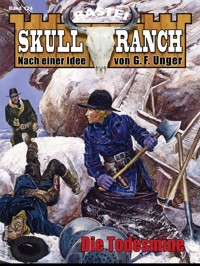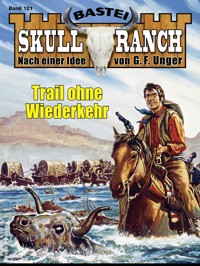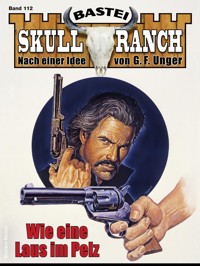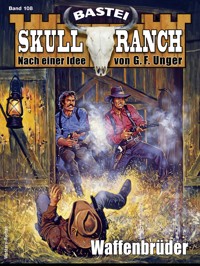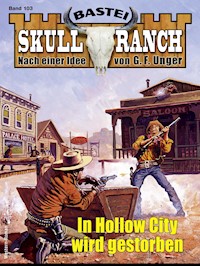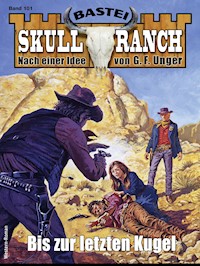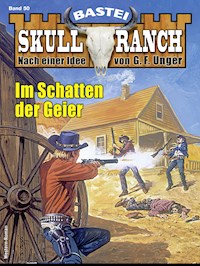
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Skull Ranch
- Sprache: Deutsch
Niemand weiß, woher der neue Cowboy von der Skull-Ranch kommt. Aber jeder spürt die Todesdrohung, die ihn wie ein Schatten begleitet. Er nennt sich Clay Rees, versteht etwas von Pferden und kann mit dem Revolver umgehen. Nach dem ungeschriebenen Gesetz des Westens fragt ihn niemand nach seiner Vergangenheit.
Eines Tages lauern Clay einige hartgesichtige Langreiter auf. Die Flucht vor seinen ehemaligen Kumpanen hat ihm nichts genützt. Wie die Geier stürzen sich die Banditen auf ihre Beute. Clay Rees soll sterben. Da tauchen die Männer von der Skull auf, und der Höllentanz beginnt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Im Schatten der Geier
Vorschau
Impressum
Im Schatten der Geier
von Dan Roberts
Niemand weiß, woher der neue Cowboy von der Skull-Ranch kommt. Aber jeder spürt die Todesdrohung, die ihn wie ein Schatten begleitet. Er nennt sich Clay Rees, versteht etwas von Pferden und kann mit dem Revolver umgehen. Nach dem ungeschriebenen Gesetz des Westens fragt ihn niemand nach seiner Vergangenheit. Eines Tages lauern Clay einige hartgesichtige Langreiter auf. Die Flucht vor seinen ehemaligen Kumpanen hat ihm nichts genützt. Wie die Geier stürzen sich die Banditen auf ihre Beute. Clay Rees soll sterben. Da tauchen die Männer von der Skull auf, und der Höllentanz beginnt ...
Clay Rees richtet sich etwas im Sattel auf, als er die Fährte sieht.
»Da sind ja die alten Tanten«, sagt der schlanke Mann zu seinem Pferd. »Lauf, mein Alter, wir werden die gehörnten Biester finden und zurücktreiben.«
Clay lebt seit zwei Wochen hier im Bluegrass Valley. Drei Tage lang ist er nach seiner Ankunft mit Chet Quade, dem Vormann, durch das weite Tal geritten, um das Land des John Morgan kennen zu lernen.
Und nach diesen drei Tagen schickte ihn der Rancher nach Südwesten.
Eine kleine Hütte, gerade ausreichend für zwei oder drei Männer, steht hier. Und dieses Vorwerk ist der südlichste Außenposten der Skull-Ranch.
Clay war es recht gewesen, hier zu leben.
Er meidet die Menschen, denn er denkt, dass sie ihm seine Vergangenheit ansehen.
Diese Aufgabe im Südwesten des weiten Valleys behagt ihm. Er ist so etwas wie ein Grenzreiter und sorgt dafür, dass die Longhorns sich nicht zu weit davonmachen.
Zahllose Wege und Pfade münden im Bluegrass Valley, das John Morgan in Besitz nahm.
Und zahllose Trails für die zähen Longhorns führen hinaus.
Aber Rinder sind das einzige Vermögen des Viehzüchters, und die Cowboys sorgen dafür, dass sich die Biester nicht auf den Weg irgendwohin machen.
Denn das Bluegrass Valley ist selbst für eine große Mannschaft kaum zu überwachen.
Clay bleibt auf der Fährte des kleinen Rudels. Er schätzt, dass es etwa dreißig Tiere sind, die hier ihren eigenen Trail suchten. Aber er wird sie zurücktreiben.
Die Spur führt auf die Cochetopa Hills zu, die als südlichste Grenze des Blaugrastals den Gipfeln der Sangre-de-Christo-Kette vorgelagert sind.
Und dort, in den bewaldeten Hügeln der Cochetopas, gibt es zahllose Verstecke für die Longhorns, die sicherlich von einem jungen Stier geführt werden. Und dieser junge Bulle ist bestimmt froh, einen Harem von etwa dreißig Rindern hinter sich zu haben, und will sie in Sicherheit bringen.
Clay Rees verspürt auf einmal Unbehagen in sich.
Er hebt den Kopf und schaut sich unauffällig um. Nichts ist zu entdecken, was dieses Unbehagen, dieses Gefühl einer drohenden Gefahr begründen könnte.
Doch seit er aus New Mexico nach Colorado kam, verfolgt ihn diese mahnende Warnung.
Clay kann sich nicht vorstellen, dass er verfolgt wird. Es gibt keinen Grund dafür. Er saß seine Strafe von drei Jahren im Staatsgefängnis ab und ist nun wieder ein freier Mann.
Und er bereut bitter, was er damals, vor drei Jahren tat. Und er weiß, dass ihn diese Vergangenheit irgendwann einmal einholen wird.
Entschlossen schiebt Rees diese Gedanken zur Seite und konzentriert sich auf die Fährte.
Der junge Bulle führte das kleine Rudel geschickt zwischen die hoch aufragenden Douglasien, aber die Fährte ist in den herabgefallenen Nadeln deutlich zu erkennen.
Clay zupft am Zügel, und der Wallach ändert seine Richtung.
Und das rettet Rees das Leben!
Irgendwo zwischen den Hügeln der Cochetopa Hills blitzt es auf.
Als Clay den peitschenden Schussknall hört, ist es auch schon zu spät.
Die Kugel reißt einen schmalen Streifen Haut mitsamt den Haaren von Rees Kopf.
Für einen Moment schwankt der Cowboy im Sattel. Aber dann reagiert er blitzschnell.
Mit der Rechten reißt er die Winchester aus dem Scabbard, löst die Stiefel aus den Steigbügeln und schnellt sich aus dem Sattel.
Zusammengerollt kugelt Clay über den Boden.
Und als er nur noch drei Yard von den schützenden Fichten entfernt ist, hämmert das Gewehr des heimtückischen Schützen in rasender Folge.
Die Kugeln liegen ziemlich genau, zu genau für Clays Geschmack.
Er zieht langsam die Beine an den Leib, denn der Schwung des Sprunges ist verbraucht.
Und dann stößt sich der mittelgroße Cowboy mit den hohen Absätzen ab, schnellt vor und kommt auf die Beine.
Mit zwei weiten Zickzacksätzen erreicht er die Stämme der Douglasien und wirft sich hinter ihnen in Deckung.
Das Gewehrfeuer verstummt.
Clay hebelt die erste Patrone in den Lauf und beobachtet wachsam die Umgebung.
Aber auch der Schütze ist durch den Wald gedeckt. Allenfalls steht die Partie jetzt unentschieden.
Rees seufzt, denn er weiß, dass er hier nicht fortkommen wird.
Sein Weidepferd steht reglos wie ein Denkmal; das Tier ist an Schüsse gewöhnt und wartet ab, bis es neue Befehle seines Reiters bekommt.
»Ich habe nur eine Chance«, murmelt Clay, »ich muss den Kerl finden, der auf mich schoss. Verdammt, wenn ich nur wüsste warum!«
Er richtet sich ganz auf und blickt abschätzend zu den anderen Stämmen. Sie sind dick genug, ihm Deckung zu geben, und Clay wagt es!
Er läuft los.
Der dichte Teppich aus Fichtennadeln macht seine Schritte unhörbar.
Aber Rees verzieht das Gesicht, als er daran denkt, denn auch sein Gegner hat diesen Vorteil.
Nach wenigen Minuten erreicht Clay eine Lichtung, die mit Blaugras bewachsen ist.
Und hinter dieser freien Fläche steigt der Boden steil an.
Aus zusammengekniffenen Lidern mustert der Cowboy den steilen Hang. Von dort aus hätte der heimtückische Schütze ihn sehen können.
Und ein Gefühl sagt Clay, dass der Kerl dort oben irgendwo hockt und nur darauf wartet, dass ihm sein Opfer vor die Mündung läuft.
Die Lichtung ist mehr als dreihundert Yard breit.
Rees zieht sich in gute Deckung zurück und geht in gleichmäßigem Tempo weiter.
Er muss versuchen, in guter Deckung auf den Steilhang zu gelangen, um den Halunken zu stellen.
Nach zweihundert Yard bleibt Clay stehen.
Grell leuchtet die Sonne auf eine Sandfläche, die inmitten des Waldes eine weitere kleine Lichtung bildet.
Entweder hat einer der gewaltigen Winterstürme hier gewütet oder eine Laune der Natur ließ den Pflanzenwuchs verkümmern.
Clay will weiter.
Abschätzend blickt er nach oben. Der Kerl mit dem Gewehr kann auch diese kleine Lichtung einsehen.
Rees hofft, dass der Bursche seine Aufmerksamkeit auf die große freie Fläche konzentriert und wagt es.
Er jagt mit gewaltigen Sprüngen zwischen den Stämmen der Fichten und Coloradozedern voran, erreicht die Lichtung und weiß plötzlich, dass er ein Narr war.
Aber er kann nicht mehr umkehren. Wollte er seinen Lauf stoppen, käme er mitten auf der freien Fläche zum Stehen.
Rees sinkt etwas im Sand ein, und seine Geschwindigkeit vermindert sich.
In zwei, höchstens drei Sekunden muss er die Deckung der Bäume auf der anderen Seite erreicht haben!
Aber diese winzige Zeitspanne genügt dem Banditen in den Felsen.
Seine Winchester spuckt Kugel um Kugel aus, und eines der Geschosse reißt Clay eine tiefe Schramme in den rechten Stiefel und nimmt auch noch etwas Haut mit.
Schmerzhaft zuckt der Cowboy zusammen, aber er läuft weiter. Er muss einfach weiter, wenn er nicht wie ein Bergmurmeltier abgeknallt werden will.
Und Clay schafft es!
Er lässt sich in der Deckung eines umgestürzten Baumes fallen und beobachtet die Umgebung.
Nichts ist von seinem Feind zu erkennen. Er hockt sicher noch immer oben zwischen den Felsen und lauert auf eine Bewegung seines Opfers.
Clay spürt irgendwie, dass er kaum eine Chance hat.
Aber wie diese aussehen wird, weiß er noch nicht.
Er zieht sich den Stiefel aus und verbindet die Schramme mit seinem Halstuch.
Und dann kann er nur noch warten.
Er muss die Geduld eines Indianers aufbringen, seinen Gegner nervös machen, aus der Reserve locken, um selbst eine Chance zu haben.
Aber nach einer Stunde hat sich noch immer nichts gerührt, und Clay ahnt, dass der Bandit selbst die Geduld eines roten Mannes besitzt.
Scheinbar endlos ziehen sich die Minuten dahin.
Nichts geschieht, kein Geräusch ist zu hören, und selbst die Tiere des Waldes, die Blauhäher, die Rotkopfspechte und die Murmeltiere, die in diesen Höhen ihre Reviere haben, geben keinen Laut von sich.
Clay liegt reglos.
Auf einmal fällt ihm ein, dass er nun bereits zehn Tage oder elf auf der Südwiese der Skull-Ranch den Grenzreiter spielt.
Und eigentlich müsste heute der Proviantwagen kommen!
Das ist Clays Chance!
Denn meistens wird der alte, faltengesichtige Koch, der nur Doc Smoky heißt, von einigen Reitern begleitet.
Rees rechnet nach, aber er kommt zu keinem Ergebnis, denn die letzten beiden Wochen verwischen sich in seinem Gedächtnis. Clay ist froh gewesen, endlich einen Job zu bekommen, ein paar Dollar zu verdienen, und er hatte Besseres zu tun, als nach dem Datum zu fragen.
Der Proviantwagen kann genauso gut am nächsten Tag kommen!
Und dann sieht es mächtig schlecht aus für den schlanken, dunkelhaarigen Mann, der nach drei Jahren Staatsgefängnis in New Mexico nun endlich wieder einen Job gefunden hat.
Clay presst die Lippen zusammen und hofft, dass Doc Smoky heute kommt. Der Alte ist ein erfahrener Mann und wird die Spuren sicher zu deuten wissen.
So wie Rees die Männer der Skull-Ranch einschätzt, wird sich jeder der Cowboys für einen Kameraden einsetzen und ihm helfen.
Aber Clay kann nur warten, mehr nicht. Er muss warten und darauf achten, dass ihn der heimtückische Gegner nicht überwältigt.
Es geht nur ihn, Clay Rees etwas an, was hier geschieht; das fühlt der Cowboy instinktiv.
Der Angriff auf ihn hat nichts mit der Skull-Ranch, ihrem Besitzer John Morgan oder einem der anderen Männer zu tun.
Aber vergeblich zermartert sich Clay das Gehirn nach dem Grund dieses Überfalles.
Die Sonne hat ihren höchsten Stand überschritten. Und noch immer rührte sich der Angreifer nicht aus seiner Deckung heraus.
»Wenn er nicht bald handelt, muss ich weg«, murmelt Clay.
Und mit weg meint er, dass er ein paar hundert Meilen zwischen sich und dieses herrliche Tal bringen wird, denn er kann es nicht verantworten, dass ein schießwütiger Kerl die ganze Mannschaft gefährdet.
Nach Clays Schätzung sind beinahe zwei Stunden vergangen. Noch immer hockt er hinter den mächtigen Stämmen der uralten Fichten. Und noch immer hat sein Gegner keinen Quadratinch von sich gezeigt.
»So kann es nicht weitergehen«, murmelt Rees.
Andererseits bringt ihm die Dunkelheit Vorteile!
Wenn sein Pferd noch immer am gleichen Platz steht, könnte Clay es schaffen.
Gelangt er ungesehen zu seinem Reittier, wird er entkommen, denn der heimtückische Gewehrschütze kann sicherlich nicht im Dunkeln sehen.
Aber wie geht es dann weiter?
Ich muss verschwinden, denkt Rees. Seit ich aus dem Staatsgefängnis entlassen bin, habe ich das Gefühl, verfolgt zu werden. Entweder traile ich nach Kalifornien oder nach Norden, nach Kanada. Dort werde ich wohl Ruhe finden.
Eine Sekunde überlegt der Cowboy, sich zu stellen. Aber er spürt, dass er gegen seinen erbarmungslosen Jäger keine Chance hat.
Und doch: Was will der Gegner?
Er kann ihn nicht sofort töten, denn dazu gibt es keinen Grund. Also will der Mann etwas von ihm, von Clay Rees, erfahren.
Und vielleicht liegt dort eine Chance?
Allmählich senkt sich die Sonne im Westen auf die steil aufragenden Gipfel der Elk Mountains herab.
Wie poliert schimmern die kahlen Granitflächen der Bergkette, und die Baumgrenze ist deutlich als grüner Strich zu erkennen.
Clay reckt sich, lockert seine steifen Knochen und spürt, dass ihm die Arme lahm wurden.
Vorsichtig legt er das Gewehr auf den Boden und schwingt beide Arme wie die Flügel einer Windmühle, während er mit den Schultern abwechselnd nach vorne stößt.
Auf einmal verliert er den Halt unter den Füßen, der Teppich aus Fichtennadeln rutscht zur Seite.
Clay taumelt, fängt sich und packt mit der Linken den Stamm des Baumes, der ihm bisher Deckung gewährte.
Und als sich der Cowboy wieder aufrichtet, bleibt er wie erstarrt stehen.
Keine zwanzig Yard entfernt steht ein Indianer!
Der Krieger lehnt mit dem Rücken an einem anderen Stamm und hält die Winchester in der Armbeuge.
Es ist die sogenannte Wagenbosshaltung, die ganz harmlos aussieht. Aber im Bruchteil einer Sekunde kann der rote Mann die Winchester schussbereit haben und durchziehen.
Und es ist das erste Mal, dass Clay diese Haltung bei einem Indianer sieht.
»Willst du fliegen?«, fragt der Krieger mit heiserer Stimme.
Rees Gedanken jagen sich.
Und dann sieht er die mächtige Nase im Gesicht des roten Mannes.
Es kann nur Big Nose sein, der dort steht. Big Nose ist der unbestrittene Herrscher des Kiowa-Stammes, der sein ständiges Lager nordöstlich des Bluegrass Valleys aufgeschlagen hat.
Und eigentlich waren diese Kiowa die Herren des Landes, als John Morgan das weite Tal mit seiner Rinderherde in Besitz nahm.
Aber Big Nose ist ein schlauer Bursche. Er will keinen Krieg in der Umgebung und hält Frieden mit den Weißen, denn er kennt ihre Macht.
Als Junge besuchte er eine Missionsschule der bleichhäutigen Menschen und lernte sie gut kennen.
Und wenn seine Krieger unter seiner Führung auf Raubzüge ausgehen, so bringen sie zahllose Meilen zwischen sich und ihre eigentliche Heimat.
Mit John Morgan steht sich der Häuptling gut.
Sie retteten sich gegenseitig mehr als einmal das Leben. Und sie spüren, wissen, dass sie aufeinander angewiesen sind.
»Hast du deine Zunge verloren, Rindermann?«, fragt Big Nose.
Clay lächelt schwach und antwortet: »O nein, Häuptling, aber ich bin überrascht. Ich habe dich nicht gesehen und nicht gehört.«
Der Kiowa lächelt selbstbewusst und zugleich etwas geschmeichelt.
»Du bist wie eine Klapperschlange, Mann«, sagte er, »du hast Ohren, aber du hörst nichts, du hast Augen, aber du siehst nichts. Nur dein Geschmack ist schlechter als der einer Schlange, denn wäre er gut, hättest du mich gewittert.«
»Kannst du mir helfen?«, fragt Clay Rees. »Dort oben hockt ein Kerl zwischen den Felsen, der mir das Lebenslicht ausblasen will. Ich komme einfach nicht an ihn heran. Und wenn ich zurückgehe, solange es hell ist, erwischt er mich ebenfalls.«
Big Nose grinst, und seine Nase scheint Eigenleben zu entwickeln, so kräuselt sie sich.
»Einige Krieger sind bereits dort oben«, sagt der Häuptling. »Chet Quade und John Morgan nahmen einen anderen Weg, um dem Kerl den Rückzug abzuschneiden. Und Doc Smoky lauert mit seinem alten Büffelgewehr darauf, diese mächtige Kanone abzufeuern. Warte also ab, Rindermann.«
Und das ist alles, was Clay tun kann: abwarten. Und jetzt, nachdem er Hilfe bekam, fällt ihm das Warten doppelt so schwer wie vorher.
Big Nose wendet den Kopf und späht zu den Felsen hinauf.
Und dann klingt der klagende Pfiff eines Murmeltieres auf, das in Not geraten ist. »Er hat meine Krieger gesehen«, sagt der Häuptling bedauernd. »Der Mann wird entkommen. Meine Männer haben keine Pferde bei sich.«
Kurz darauf klingt das schwache Klappern von Hufeisen von dem Bergzug herunter.
Einige kehlige Schreie klingen auf, und Big Nose verlässt seine Deckung.
»Komm mit, er ist fort«, sagt der Häuptling zu Clay Rees.
Der Cowboy geht hinter dem Indianer her, der sich auch jetzt noch lautlos bewegt.
Kurze Zeit später erreichen sie das freie Land.
Rees kneift die Lider zu schmalen Schlitzen zusammen und erkennt in einiger Entfernung den Wagen des Kochs.
Doc Smoky scheint scharfe Augen zu haben, denn er taucht auf einmal hinter dem Fahrzeug auf, legt etwas auf den Kutschersitz und schwingt sich hinauf.
»Er ist also weg, dieser verdammte Halunke«, sagt der Koch der Skull-Ranch, als er das Fahrzeug vor Big Nose und Rees zügelt.
Das ledrige Gesicht des alten Mannes auf dem Kutschersitz verzieht sich zu einem faltenreichen Grinsen.
»Hast du Glück gehabt, Jungwolf«, sagt der Koch zu Clay. »Das war kein Anfänger, o nein. Das war ein erfahrener Menschenjäger, der dort oben auf dich lauerte. Ich möchte nur wissen, warum er es gerade auf dich abgesehen hatte.«
Prüfend blickt der Alte aus eisblauen Augen zu dem jungen Weidereiter, der zu seinem Pferd geht.
Als Clay aufgesessen ist und zum Küchenwagen reitet, sagt Doc Smoky: »Aber das werde ich schon noch erfahren. Denn der Boss ist in der Nähe. Und John Morgan hat es nicht gerne, wenn man auf seine Männer schießt. Das gilt auch für Neulinge, die einen Unterschlupf suchen.«
Irgendetwas war in der Stimme des Alten mitgeschwungen, als er den letzten Satz sprach.
Clay grinst schwach und sagt: »Ich habe nichts zu verbergen.«
Big Nose läuft im Indianertrab zu einer Gruppe Wacholdersträucher und kommt nach kurzer Zeit im Sattel eines Pferdes zurück.
Minuten später laufen vier weitere Krieger heran.
Sie melden ihrem Häuptling, was sie erreichten, und gehen ebenfalls, um ihre Pferde zu holen.
John Morgan und Chet Quade reiten zum Ranchwagen.
Morgans Gesicht wirkt ernst und verschlossen. Dem Vormann Quade kann niemand ansehen, was er denkt. Seine Züge zeigen keine Bewegung, und auch die dunklen Augen scheinen nur in endlose Fernen zu blicken.
»Er hat Indianerblut in sich«, sagt Big Nose laut. »Aber gehört keinem Stamm an, denn er trägt die Kleidung eines weißen Mannes. Seine Wangenknochen sind breit, wie die eines Apachen, aber er muss helle Augen haben. Das ist alles, was meine Krieger von dem Schützen sagen können.«
John Morgan blickt seinen neuen Cowboy ein paar Sekunden lang an und schaut dann zu Big Nose, dem er dankt.
Der Häuptling grinst nur und hebt die Hand.
Seine Krieger lassen die Pferde angehen, und kurze Zeit später sind die Kiowa nur noch Punkte, die sich in der Nachmittagssonne nach Norden bewegen.
»Clay Rees«, sagt John Morgan ruhig, »ich denke, du wolltest uns etwas erzählen. Du ziehst eine heiße Fährte hinter dir her, warum? Ich weiß, es ist nicht höflich, nach solchen Dingen zu fragen, aber es geht hier um meine Ranch, Clay. Wir leben im Herzen von Colorado, und um uns herum wühlen zahllose Goldgräber die Berge nach dem gelben Dreck um. Im Gefolge dieser Digger finden sich eine Menge Schurken ein, die auf leichte Art und Weise zu Geld kommen wollen. Wir schlugen bereits mehrmals Angriffe der Banditen zurück. Du siehst also, dass es nicht mehr nur um deine Angelegenheit geht.«
Rees wendet unbehaglich den Kopf hin und her.