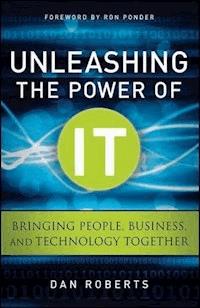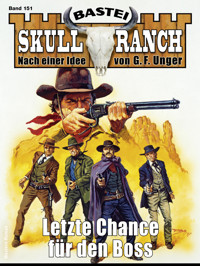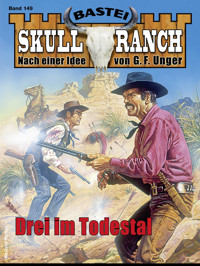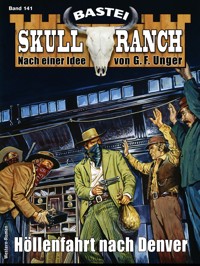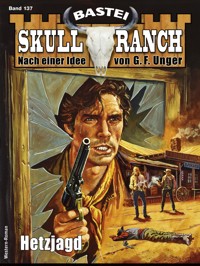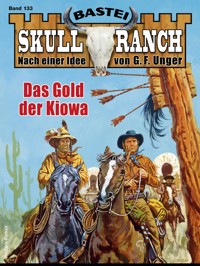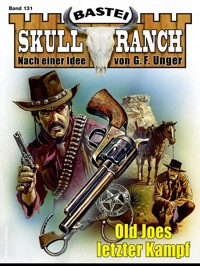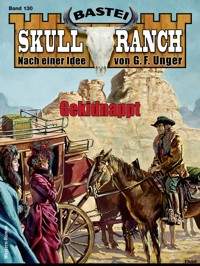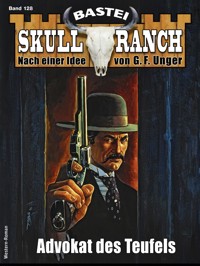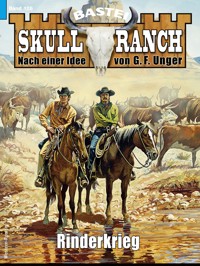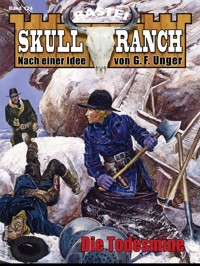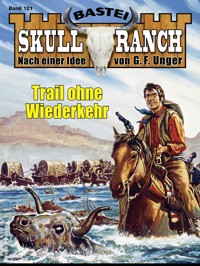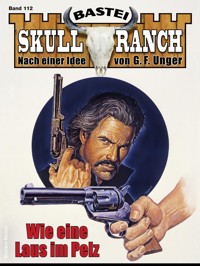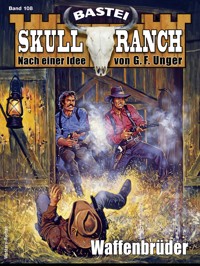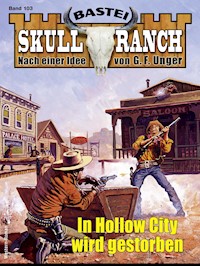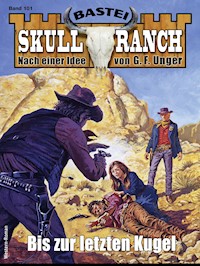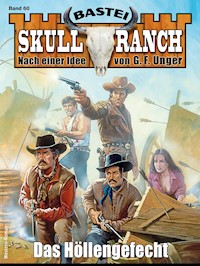
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Skull Ranch
- Sprache: Deutsch
Mit zusammengekniffenen Augen mustert der dunkelhaarige Mann mit dem indianerhaften Gesicht den Horizont. In der flirrenden Hitze, die schwer über der Arkansas-Prärie liegt, ist die gelbe Staubwolke in der Ferne kaum zu erkennen.
"Nun zeig mir mal, was dein Brauner kann, Mary-Lou", fordert Chet Quade seine Begleiterin auf und gibt seinem Pferd die Sporen. Die Tiere greifen weit aus, die Reiter treiben sie immer wieder an. Aber die Staubwolke kommt unerbittlich näher. Jetzt geht es um ihre Skalpe. - Die Indianer sind hinter ihnen her ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Das Höllengefecht
Vorschau
Impressum
Das Höllengefecht
von Dan Roberts
Mit zusammengekniffenen Augen mustert der dunkelhaarige Mann mit dem indianerhaften Gesicht den Horizont. In der flirrenden Hitze, die schwer über der Arkansas-Prärie liegt, ist die gelbe Staubwolke in der Ferne kaum zu erkennen.
»Nun zeig mir mal, was dein Brauner kann, Mary-Lou«, fordert Chet Quade seine Begleiterin auf und gibt seinem Pferd die Sporen. Die Tiere greifen weit aus, die Reiter treiben sie immer wieder an. Aber die Staubwolke kommt unerbittlich näher. Jetzt geht es um ihre Skalpe. – Die Indianer sind hinter ihnen her ...
Chet verbirgt seine Unruhe geschickt. Scheinbar gleichmütig schaut er über die Schulter zurück und mustert das weite, flache Land.
Leroy Spade ist schon seit mehr als zwei Stunden unterwegs. Und dabei wollte der Raubwildjäger doch nur einen weiten Bogen schlagen, wollte nur überprüfen, ob sie sicher waren. Bislang ist ihr langer Trail von Colorado bis Arkansas ohne Zwischenfälle verlaufen.
»Was ist, Chet?«, fragte Mary-Lou halblaut und sieht den indianerhaften Quade an.
Seit sie von der Skull-Ranch aufgebrochen sind, ist Chet zum ersten Mal nervös.
Mary-Lou muss an den Abschied von ihrem Vater denken. Auch ihre neue Freundin Isabella schien sehr besorgt zu sein, als sie aufbrachen, um die Schwester ihres Vaters in Alabama zu besuchen. Und jetzt spürt auch sie so etwas wie Angst.
Quade lächelt schwach und meint! »Nichts ist, Girly, ich sehe mich nur nach Leroy um.«
»Er bleibt lange weg«, stellte Mary-Lou fest.
Quade nickt nur. Seine in zahllosen Abenteuern geschärften Sinne sagen ihm, dass Gefahr droht. Er spürt diese Drohung beinahe körperlich. Und er achtet nicht mehr auf den stahlblauen Himmel, das weite, wogende Gras der endlos scheinenden Oklahoma-Prärie. Er sucht nach Anhaltspunkten für dieses Gefühl, aber noch kann er nichts entdecken.
Die Ebene ist wellig. Immer wieder steigt der Boden zu sanften Hügeln an, die mit mächtigen Kanada-Pappeln, Burr-Eichen und Hickory-Stämmen bewachsen sind. Zwischen diesen Baumriesen wuchern Sträucher und Gräser.
Der Pferde traben die nächste sanfte Steigung hinauf. Chet zügelt seinen Grauschimmel und wendet sich im Sattel um.
Und auf einmal ruckt der Kopf des ehemaligen Revolvermannes nach rechts.
»Da, sieh nach Süden«, sagt Quade scharf.
Mary-Lou blickt in diese Richtung und hält unwillkürlich den Atem an.
Ein Conestoga, ein richtiger Prärieschoner, tanzt und hüpft über den unebenen Boden, über die Löcher der Erdhörnchen und wird von einem Maultiergespann vorangerissen.
Und hinter diesem Wagen jagen Indianer heran.
Es sind mindestens zwanzig Krieger. Sie holen ständig auf. Die Entfernung verringert sich, und die Indianer holen die Gewehre aus den Scabbards. Hell blitzt das Sonnenlicht auf den Metallteilen der Waffen.
Und dann peitschen die ersten Schüsse! Dumpf wummert eine Schrotflinte auf, und die ersten beiden Pferde der Verfolger bleiben stehen als seien sie gegen eine Mauer gerannt. In hohem Bogen fliegen die beiden Krieger aus den Sätteln und bleiben liegen, als sie auf dem Boden aufschlagen.
Wie die wilde Jagd setzen die anderen Indianer über ihre Gefährten hinweg.
Die Krieger wollen diesen Wagen haben. Und sie werden es schaffen.
»Chet, wir müssen ihnen helfen«, sagte Mary-Lou drängend.
Aber der schlanke Vormann der Skull-Ranch schüttelt nur den Kopf. Er weiß, dass es sinnlos ist, eingreifen zu wollen. Sie sind viel zu weit von dem Wagen entfernt.
Doch dann horcht er auf.
Das regelmäßige Hämmern einer Winchester klingt zwischen den vereinzelten Schüssen der Roten auf.
Krieger um Krieger kippt aus dem Sattel, und die herrenlosen Pferde brechen zu den Seiten hin aus.
Abermals donnert die mächtige Schrotflinte aus dem Conestoga. Weitere zwei Pferde brachen in die Knie und liegen still.
Das Blatt hat sich gewendet. Und der Mann, der von der Seite her die Angreifer unter Feuer nimmt, kann nur Leroy Spade sein. Irgendwie gelang es dem erfahrenen Trapper, die Horde zu umreiten. Er fällt ihnen jetzt in die Flanke. Und sein Gewehr wütet fürchterlich unter den Kriegern. Sie müssen aufgeben, denn sie haben diesem einen Mann nichts entgegenzusetzen.
Der Anführer der Rotte hebt die Rechte, schwenkt das Gewehr kreisförmig über seinem Kopf, und die restlichen Krieger folgen ihm, als er sein Pferd zur Seite leitet.
Chet ruft scharf: »Los, es gilt!« und schlägt dem Grauen die Absätze in die Flanken.
Mary-Lou reitet einen Sekundenbruchteil später an. Sie weiß, was Quade will. Er muss die Indianer ablenken, um Leroy Spade seine Chance zu geben. Denn der Raubwildjäger hockt in der Falle, wenn die Roten ausschwärmen. Gegen ein Dutzend Krieger, die wahrscheinlich verrückt nach Beute sind, kann Spade nicht bestehen.
Chet und Mary-Lou jagen schräg auf die Indianer zu. Einer der letzten Krieger wendet sich im Sattel um. Der rote Kämpfer erahnt die Gefahr. Und er stößt einen gellenden Schrei aus, der das Trommeln der Pferdehufe übertönt.
Sofort reißen fünf Reiter ihre Tiere zur Seite, verteilen sich zu einem Halbkreis und versuchen, die beiden neuen Angreifer unter Feuer zu nehmen.
»Bleib zurück!«, ruft Chet, und Mary-Lou zügelt ihren Braunen etwas.
Aber Quade gleitet wie ein Comanche an die Seite seines Pferdes. Und es sieht so aus, als strecke sich der Graue noch einmal, als schöpfe er neue Kraft, und er wird wahrhaftig schneller.
Mary-Lou zieht an den Zügeln. Sie ist jetzt in Gewehrschussweite. Entschlossen zieht sie die Winchester aus dem Scabbard, reißt die Waffe an die Schulter und feuert.
Hell peitscht der Schuss. Einer der fünf Indianer wirft die Arme hoch, wird nach hinten gestoßen, aber er hält sich im Sattel. Kämpfen kann der Krieger nicht mehr. Er leitet seinen Falben zur Seite und lässt ihn im Schritt auf ein paar Büsche zugehen.
Mary-Lou hebelt die nächste Patrone ins Lager. Das Mädchen zielt auf die Pferde und bringt zwei Tieren Streifschüsse bei. Die Indianerponys wiehern grell auf, brechen aus und jagen in wilder Karriere davon.
Chets Grauer galoppiert zwischen den letzten beiden Kriegern hindurch.
Einer der Indianer reißt das Gewehr hoch, feuert, aber er zielte nicht richtig, und das Geschoss pfeift an Quades Kopf vorbei und gräbt sich in den Boden.
Mit einem gewaltigen Schwung hebt sich der Vormann der Skull-Ranch in den Sattel.
Und dann hat er es geschafft.
Mary-Lou schießt in gleichmäßigen Abständen und zwingt mit ihrem Feuer die Krieger zurück.
Chet greift den Haupttrupp der Krieger von hinten an. Leroy Spades Winchester hämmert Schuss auf Schuss aus dem Lauf.
Die Indianer haben keine Chance mehr. Bösartig umsirren die Kugeln die Köpfe der roten Krieger. Und sie wissen, dass sie sterben werden, wenn die weißen es so wollen.
Die Indianer stoßen schrille, trillernde Schreie aus. Wie auf Kommando reißen sie an den Zügeln. Die Rotte verteilt sich, bildet eine lange Reihe und jagt davon.
Sekunden später erinnern nur noch der Staub des zerpulverten Grases und der Geruch nach Schießpulver an den Kampf.
Leroy Spade reitet im Kantergalopp heran. Der Raubwildjäger hatte sich zwischen den Stämmen einer Bauminsel verborgen gehalten und dort ausgezeichnete Deckung besessen.
»Zum Wagen!«, ruft Chet und deutet mit der Rechten auf den Conestoga, der nun nicht mehr fährt.
Leroy hebt kurz die Hand, und Mary-Lou lenkt ihren Wallach bereits in Richtung des Prärieschoners.
Die beiden Männer und das Mädchen sind noch knapp zehn Pferdelängen von dem Wagen entfernt, als Leroy sein Tier zügelt und horcht. Auch Chet hört die Trompete, und es scheint, als sei sie gar nicht weit entfernt.
Und dann erkennt er das Signal.
Der Hornist bläst zum Angriff.
»Zum Wagen, schnell!«, brüllt Quade und schlägt seinem Grauschimmel die Hacken in die Flanken.
Das Tier schnaubt wild, tänzelt eine Sekunde nervös und streckt sich dann. Innerhalb weniger Sekunden fällt es in Galopp und jagt auf den Prärieschoner zu.
Mary-Lous Brauner stampft schwer den Boden, und Spades Fuchsstute scheint die Gefahr förmlich zu wittern. Sie jagt davon, als sei der Satan persönlich hinter ihr her. Und das Pferd geht sogar noch an Chets Grauem vorbei. Es schrammt mit der Hinterhand eine Narbe in den Boden, als Leroy das Tier dicht neben dem Conestoga zügelt.
Die Plane ist zurückgeschlagen.
Ein noch junger Mann mit sandfarbenem Haar blickt lächelnd auf den Raubwildjäger. Leroys fransenbesetzte Lederjacke, die Hosen aus Hirschleder und die Ausrüstung eines Bergläufers sind hier in Oklahoma selten zu sehen.
»Alle Waffen laden!«, ruft Leroy scharf. »Die Kavallerie greift an. Sie werden die Indianer hierher zurücktreiben, diese Narren. Wir sitzen in der Klemme, Mister.«
»Ha, und ich wollte mich schon für die Hilfe bedanken!«, ruft der junge Mann etwas zornig. »Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft. Und jetzt hetzt uns die Army die roten Burschen erneut auf den Hals.«
Mary-Lou kommt gleichzeitig mit Chet am Conestoga an.
»Los, auf den Wagen, Girly«, sagt Quade.
»Ich fühle mich im Sattel sicherer«, protestiert das Mädchen, aber Chet winkt ab.
»Wir brauchen drei Gewehre auf dem Wagen«, sagt er und blickt den Mann mit dem sandfarbenen Haar an. »Mister, haben Sie außer der Schrotflinte auch noch eine Winchester?«
»Sicher«, antwortet der Auswanderer, »aber eben musste ich fahren, und meine Frau erreichte mit der Parker Gun mehr als mit der Winchester.«
»Wir bleiben hier stehen«, sagte Chet gelassen. »Ihre Frau soll die Flinte nehmen und eine Seite decken. Die Indianer kommen von Westen zurück. Sie haben es nicht bis zum Arkansas River geschafft. Sicher lag dort die Patrouille auf der Lauer. Wir sind mitten in eine Auseinandersetzung der Kavallerie geraten, schätze ich.«
»Und ich?«, fragten Mary-Lou und der junge Mann gleichzeitig.
»Ihr beide deckt nach vorne«, antwortet Chet. »Leroy und ich reiten zu den Seiten und greifen von den Flanken her an. Also los, du Biberjäger!«
Spade grinst wild und verwegen und lässt seine Fuchsstute angehen.
Quades Pferd sprengt zur anderen Seite davon. Nur einige dürftige Sträucher bieten so etwas wie Deckung.
Aber Chet bringt sein Pferd dazu, sich hinzulegen, und jetzt ist der Vormann der Skull-Ranch nicht mehr zu erkennen.
Und dann kommen die Krieger zurück. Sie feuern aus den Sätteln hinter sich, aber ihre Kugeln treffen niemanden.
Eine halbe Schwadron Kavallerie verfolgt die Indianer in rasendem Galopp. Die Soldaten haben die Säbel gezogen. Und ihre Tiere sind ausgeruht und frisch. Sie kommen immer näher, holen Yard um Yard auf.
Nur noch sieben oder acht Krieger sind es, die ihr Heil in der Flucht suchen. Und dann sehen sie den Wagen.
Chet schießt zweimal kurz hintereinander. Auch Leroy feuert, und unter der grauen Plane des Conestogas blüht es hell auf.
Die Krieger reiten auseinander. Jeder jagt in eine andere Richtung, und das ist ihre einzige Chance. Denn die halbe Schwadron wird sich nicht in noch kleinere Gruppen aufteilen. Sie werden die Roten entkommen lassen.
Der Anführer der Reiter stößt die Linke senkrecht in die Luft. Sekunden später schmettert die Trompete das Signal zum Sammeln.
In Formation reiten die Pferdesoldaten auf den Conestoga zu.
Leroy Spade und Chet verlassen ihre Deckungen und lassen ihre Tiere im Schritt zum Wagen gehen.
Unterwegs laden die beiden Männer ihre Waffen auf und verstauen sie.
Misstrauisch reiten je fünf Blaujacken den beiden entgegen.
Chet kümmert sich nicht um die Männer, die sein dunkles, indianerhaftes Gesicht argwöhnisch mustern.
Er grinst wild und verwegen und fragt laut: »Wer ist denn der Narr, der die Krieger hierher zurücktrieb?«
Die Soldaten grinsen leicht, und einer antwortet: »Captain Brannigan, Mister, Captain Harold S. Brannigan. Und das S steht für Sigfreed, sagt Ihnen das genug, Cowboy?«
Chet nickt und meint: »Ich wette, er ist erst drei oder vier Wochen im Indianerland, was? Er kommt frisch von einer Schule aus dem Osten?«
»So ist es«, murmelt einer der anderen Soldaten bitter und spuckt aus. »Er kann alles, er weiß alles, und er hat ein sicheres Rezept, die Indianer zur Ruhe zu bringen: angreifen, angreifen und noch mal angreifen.«
Chet schüttelt schwach den Kopf. O ja, er hat von solchen Offizieren gehört. Sie kommen frisch von der Militärakademie und kennen weder die Truppe, das Land, noch die Indianer. General Carrington hatte den Männern auf der Skull-Ranch oft von solchen Bilderbuchoffizieren erzählt. Und jetzt sieht es so aus, als stünden sie einem solchen Burschen gegenüber.
Chet erreicht den Wagen und mustert den Hauptmann, der straff im Sattel sitzt. Der Mann ist sichtlich mit sich und seiner Heldentat zufrieden.
»Da sind wir ja gerade richtig gekommen«, dröhnt die Stimme des Captains. »Auf die Kavallerie ist eben Verlass, Ladys und Gentlemen.«
Leroy Spade reitet eine halbe Länge vor den fünf Begleitsoldaten. Der Raubwildjäger ist nicht mehr weit von dem Wagen entfernt. Er hört die Worte des Hauptmannes, und auf einmal lodert wilder Zorn in dem Mountainman auf.
Er zügelt seine Fuchsstute drei Yards neben dem Tier des Offiziers und sagt laut: »Captain, nennen Sie mir den Namen Ihres Vorgesetzten. Ich werde mich über Sie beschweren. Sie haben uns alle in Gefahr gebracht.«
Auf einmal ist es totenstill. Selbst die Pferde scharren nicht mehr mit den Hufen. Fassungslos starrt der Hauptmann den schlanken Fremden in der hirschledernen Kleidung an.
Eine Ader auf seiner Stirn schwillt an. Er blickt von dem Fremden zu dem schlanken Mann auf dem Conestoga, zu den beiden Frauen und lacht heiser auf.
Und dann sieht der Captain den indianerhaften Quade.
»He, da ist ja so ein Halunke«, stößt der Offizier hervor. »Bringt den Kerl zum Sprechen, habt ihr mich verstanden.«
Chet bleibt gleichmütig. Er presst seinem Grauen die Absätze in die Seiten und leitet ihn auf den Captain zu.
»He, was soll das?«, fragt der blonde Hauptmann überrascht.
»Leroy hat recht«, antwortet Chet mit ausdruckslosem Gesicht, als er das Pferd neben dem Anführer der halben Schwadron verhält. »Sie haben sich wie ein Narr verhalten, Mister. Wenn Sie keine Ahnung haben, sollten Sie sich zurückhalten. Auch ich werde mich über Sie beschweren. Wie können Sie die Angreifer dorthin zurücktreiben, wo sie kurz zuvor gekämpft haben? Es hat nicht viel gefehlt, und die Indianer hätten uns aus purer Rache niedergemacht. Warum trieben Sie die restlichen Krieger nicht in den Arkansas River, Captain?«
Der Offizier presst die Lippen zusammen, dass sie wie dünne Striche in seinem Gesicht wirken. Irgendwie spürt er, dass die Fremden recht haben, aber das wird er nicht zugeben.
»Lass ihn doch, Chet«, sagt Mary-Lou vom Wagen herab. »Er ist sicher ein guter Soldat. Aber von Indianern hat er keine Ahnung. Wir sollten machen, dass wir weiterkommen.«
Und der junge Auswanderer streicht sich über sein sandfarbenes Haar und meint: »Wir wollten in Fort Gibson eine Pause machen. Wir fahren hinter Ihnen her, Captain.«
»Meine Aufgabe ist noch nicht beendet«, antwortet der Hauptmann barsch.
»Doch, Sie ist zu Ende«, sagt Quade sanft. »Denn Sie müssen sich neue Anweisungen von Ihrem Kommandanten holen. Ein Mann wie Sie darf keine halbe Schwadron kommandieren. Sie bringen es fertig und führen die Männer in den Tod. Denn Sie begreifen wohl nicht, dass die Indianer angriffen, um zu töten, um Beute zu machen. Sie halten das wohl für Sandkastenspiele, die Sie während Ihrer Ausbildung kennenlernten.«
Captain Brannigan wird bleich. In seinen Augen funkelt der Zorn. Der Hauptmann weiß, dass ihn die Veteranen unter den Soldaten für einen ausgemachten Narren halten. Und er will alles daransetzen, seine Kenntnisse und Fähigkeiten einzusetzen. Denn er hält sich für mehr als überlegen. Aber er vergisst ganz, dass Theorie und Praxis zwei ganz verschiedene Dinge sind. Die Kämpfer hier sind erfahrene Soldaten. Sie kennen die Indianer und wissen, was sie zu tun haben. Doch sie können sich nicht gegen einen starrköpfigen Vorgesetzten durchsetzen.
Spade nickt dem jungen Mann und seiner Frau zu.
»Ich heiße Alf Henderson, und das ist meine Frau Chaty«, sagt der Auswanderer. »Wir hielten Oklahoma für sicher. Immerhin untersteht das Indianerterritorium einer ordentlichen Verwaltung. Wir verstehen gar nicht, dass wir angegriffen wurden.«
»Klarheit können wir nur im Fort bekommen«, meint Spade.
Henderson nickt, packt die Winchester am Kolbenhals und klettert auf den Kutschbock.
Sekunden später klatschen die Zügel auf die Rücken der acht Mulis.
»Los, zieht an, ihr Ziegenböcke!«, schreit der Auswanderer, »zieht, oder ich schneide euch das Fell in Streifen.«
Und die Biester stemmen sich in die Geschirre. Knarrend setzt sich der Prärieschoner in Bewegung. Mary-Lou springt von der Plattform, läuft ein paar Schritte nach hinten und löst die Zügel ihres Braunen. Sekunden später sitzt das Mädchen im Sattel und lenkt ihr Pferd zu Chet hinüber.
»War das klug?«, fragt sie leise. »Dieser aufgeblasene Captain ist uns gegenüber doch im Vorteil. Er wird eine ganz andere Schilderung bringen als wir, Chet.«
»Na und?«, fragt Quade mit einer Spur Zorn in der Stimme, »da sind einmal die Hendersons, und dann wir drei. Das sollte doch wohl reichen. Es ist zum Speien, dass immer wieder solche Kerle wie dieser Brannigan ins Indianergebiet versetzt werden. Sie sind immer wieder Ursache neuer Streitigkeiten. Sie haben keine Ahnung. Sie handeln nach den Anweisungen, die sie aus Büchern lernten. Und die Besonderheiten dieses Landes sind ihnen fremd. Nein, Mary-Lou, wir müssen dagegen angehen, meine ich.«
Leroy Spade beobachtet unauffällig den Captain. Der Offizier scheint einen Entschluss gefasst zu haben. Er richtet sich steil im Sattel auf, hebt die Linke und ruft: »Soldaten, wir verfolgen diese Rothäute. Ich will sie haben, diese Kerle. Und dann bringen wir sie ins Fort und hängen sie auf.«
Die Männer in den blauen Uniformjacken verdrehen die Augen und stöhnen leise. Aber sie wagen es nicht, Widerstand zu leisten.
Captain Harold S. Brannigan hat eine neue verrückte Idee. Er will ein paar Indianerbanditen verfolgen und einfangen. Und er denkt überhaupt nicht daran, dass sich die Krieger längst getrennt haben und auf verschiedenen Fährten reiten.
»Jetzt ist er komplett verrückt geworden«, stellt Leroy laut fest.
Der Hauptmann fährt im Sattel herum, bedenkt Spade mit einem giftigen Blick und sagt scharf: »Mister, wenn Sie ihr Mundwerk nicht zügeln, lasse ich Sie als Gefangenen nach Fort Gibson bringen.«
Interessiert blickt der Raubwildjäger den wütenden Offizier an und fragt: »Mit welcher Begründung denn, Mister?«
»Captain, für Sie bin ich Captain Brannigan!«, ruft der Hauptmann wild. »Und ich lasse Sie festnehmen, weil Sie eine Meuterei anzetteln wollen.«
Triumphierend schaut der Offizier den Trapper an. Aber Leroy legt den Kopf zurück und lacht laut auf.
»Greenhorn!«, ruft der Jäger schließlich. »Sie haben etwas vergessen. Ich bin keiner Ihrer Befehlsempfänger. Ich bin ein freier Mann. Wir sind hier im Indianerland. Die einzigen, die hier was zu sagen haben, sind die Marshals der zivilisierten Stämme. Ihr Blaujacken werdet doch nur geduldet, wissen Sie das denn nicht, Captain?«
Und dann zieht Leroy sein Pferd am Zügel herum und reitet hinter dem Conestoga her.