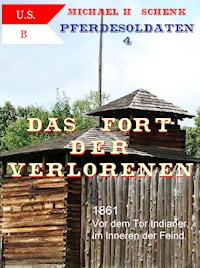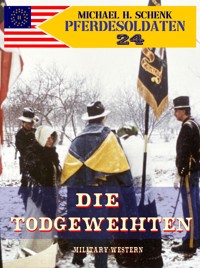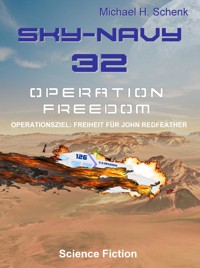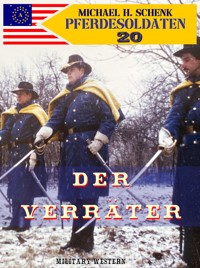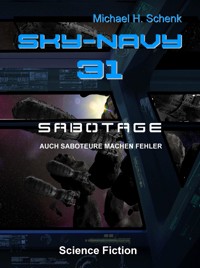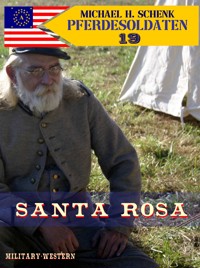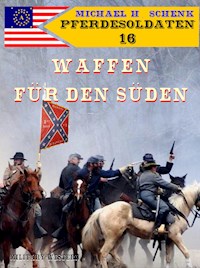
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Pferdesoldaten
- Sprache: Deutsch
Mark Dunhill und seine H"-Kompanie dienen im Indianergebiet und der Bürgerkrieg scheint fern. Doch dann erfährt man von einem als Siedlertreck getarnten Waffentransport der Konföderierten, denn die Union unbedingt abfangen will. Tatsächlich gelingt es Mark und seiner Kavallerieeinheit den Treck aufzuspüren, aber er bekommt es nicht nur mit hart gesottenen Südstaatlern unter Colonel Ronay zu tun, sondern auch noch mit kriegerischen Ute, die sich ebenfalls in den Besitz der Waffen bringen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Michael Schenk
Waffen für den Süden
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1 Treck nach Süden
Kapitel 2 Zwischen Rockies und Big Horn Mountains
Kapitel 3 Fort Bridger
Kapitel 4 Kriegsrat
Kapitel 5 Erneuter Tauschhandel
Kapitel 6 Die Patrouille
Kapitel 7 Auf unbekanntem Weg
Kapitel 8 Der Rat der Häuptlinge
Kapitel 9 Auf Patrouille
Kapitel 10 Tiefe Spuren
Kapitel 11 Der Pfad des Kriegers
Kapitel 12 Verhängnisvolle Erkenntnis
Kapitel 13 Geplänkel
Kapitel 14 Ein tragischer Fund
Kapitel 15 Der Überfall
Kapitel 16 Eine falsche Fährte
Kapitel 17 Ausgetrickst
Kapitel 18 Der brennende Himmel
Kapitel 19 In der Falle
Kapitel 20 In Ehren leben oder in Ehren sterben
Kapitel 21 Kämpft!
Kapitel 22 Umzingelt
Kapitel 23 Der Ruf der Schlacht
Kapitel 24 Ums nackte Leben
Kapitel 25 Auf nach Süden
Kapitel 26 Karte Route des Trecks von Colonel Ronay
Kapitel 27 Ankündigung
Kapitel 28 Maße und Geschwindigkeiten
Kapitel 29 Persönliche Freiheiten in den Romanen
Kapitel 30 Historische Anmerkung
Kapitel 31 Bisher erschienen:
Kapitel 32 Hinweis: Für Freiheit, Lincoln und Lee
Impressum neobooks
Kapitel 1 Treck nach Süden
Pferdesoldaten 16
Waffen für den Süden
Military Western
von
Michael H. Schenk
© M. Schenk 2021
Hundert Meilen südlich der amerikanisch-kanadischen Grenze, fünfzig Meilen westlich Fort Benton, in der Nähe des Marias Passes über die Rocky Mountains.
Der Kolonne bestand aus einhundertsechsundzwanzig Wagen. Gespanne unterschiedlicher Bauart, doch die meisten waren die schweren Conestoga-Wagen und Prairie-Schooner, die so typisch für die vielen Siedlertrecks waren, die sich entlang der Trails bewegten. Dieser Zug war keineswegs ungewöhnlich groß, aber im Gegensatz zu den meisten fuhr er nicht von Osten nach Westen, sondern kam ursprünglich von Süden und hatte diesen nun wieder zum Ziel. Während fast alle Siedler erleichtert waren, wenn sie einer Abteilung der Unions-Kavallerie begegneten und, wenigstens vorübergehend, deren Schutz genossen, mieden diese die Nähe des Militärs aus gutem Grund.
Einhundertsechsundzwanzig Wagen, fünfhundertzwanzig Gespann- und Ersatztiere, dreihundert Rinder, vierhundertfünfzig Reitpferde, inklusive der Reservepferde, dazu dreihundertsiebzig Siedler, Männer und Frauen sowie zwölf Kinder, und eine Begleiteskorte von zweihundertfünfzig Reitern … Trotzdem war es kein außergewöhnlich großer Treck, denn viele Siedlergruppen schlossen sich auf der Reise zusammen, um drohenden Gefahren überstehen zu können.
Außergewöhnlich waren eher die straffe Haltung der Reiter und die ungewöhnliche Disziplin, die bei diesem Wagenzug herrschten. Dies hatte seinen besonderen Grund, denn in Wirklichkeit suchten diese Menschen kein neues Land. Ihre Heimat war Texas, im Süden der Konföderation der Südstaaten. Ihre Mission war es, diese mit Waffen zu versorgen.
Sie waren auf dem Rückweg.
Fast hundert Meilen hatten sie sich entlang des Saskatchewan River nach Kanada hinein bewegt, um sich dort mit dem großen Transport eines Lieferanten zu treffen. Viel Gold hatte den Besitzer gewechselt. Dann überschritt der Wagenzug wieder die Grenze in die USA und konnte bislang weitere hundert Meilen auf dem Boden der Union zurücklegen. Gute zwei Wochen hatten sie hierfür benötigt. Weitere 2.000 Meilen standen ihnen bis Texas bevor, immer auf der Hut vor feindlichen Indianern und den Truppen der Union. Dabei legten sie im Wesentlichen jenen Weg erneut zurück, den sie von Texas heraufgekommen waren. Zwar mieden sie die bekannten Trails, so gut es eben ging, doch die schwer beladenen Wagen benötigten passierbare Wege und so waren die Scouts beständig unterwegs, um nach Gefahren und dem Verlauf der täglichen Wegstrecke zu suchen.
Es stand nicht besonders gut um die Sache des Südens.
Die Übermacht der Unionstruppen und die enorme Kapazität des Nordens machten sich immer deutlicher bemerkbar. Die US-Navy blockierte die Häfen und Flüsse und die US-Army die Schienenstränge und Verkehrswege an Land. Noch gab es offene Routen, doch ihre Zahl nahm ab und in der Konföderation herrschte an vielen Dingen Mangel. Vor allem an guten Waffen. Zwar stellte man selber welche her, aber es handelte sich meist um minderwertige Nachbauten von Revolvern, Karabinern und Gewehren, wie sie der Feind verwendete. Das lag nicht an mangelndem handwerklichen Geschick und fehlendem Wissen, sondern an immer knapper werdenden Ressourcen.
Zwar waren europäische Länder, allen voran England, bereit, den Süden zu beliefern, doch viel zu viele Blockadebrecher wurden von Unionsschiffen aufgebracht oder versenkt. So versuchte die Konföderation auch zusätzliche Waffen in Mexiko zu erwerben und einer der zahlreichen Wagenzüge, die der Waffen- und Munitionsbeschaffung dienten, war eben jener Treck, der nun von Kanada wieder gen Süden fuhr.
Die Männer, Frauen und Kinder, die offiziell als Siedler unterwegs waren, erwiesen sich als wahre Patrioten, da sie die Beschwernis der Reise und deren Gefahren auf sich nahmen. Daran konnte auch die starke Eskorte nichts ändern, die aus einer Elitetruppe konföderierter Reiter bestand – dem ersten Regiment der Ronny´s Raiders von Colonel Niklas P. Ronay. Von den meisten seiner Männer wurde der Colonel „The Iron“, der „Eiserne“, genannt, eine Anerkennung seiner Zähigkeit. Etwas weniger respektvoll, doch kaum weniger anerkennend, klang da ihre Bezeichnung „Hard Backsides“, „Hartarsch“, die sich auf seine Ausdauer im Sattel bezog.
Niklas Peter Ronay war nun siebenunddreißig Jahre alt und sicher einer der erfahrensten Kavallerieführer des Südens. Bereits in jungen Jahren hatte er es zum Rittmeister in der Armee des preußischen Königs gebracht. Seine Sympathien für die Demokratiebewegung zwangen ihn jedoch, den Dienst zu quittieren und sein Glück, wie so viele andere, im Jahr 1849 in Nordamerika zu suchen. Im Jahr 1860 besaß er bereits eine der größten Longhorn-Ranches in ganz Texas und gebot über zweihundert Cowboys. Als er bei Ausbruch des Krieges sein eigenes Kavallerieregiment aufstellte, bildeten etliche dieser Männer den Kern der Truppe.
Ronay wirkte fast hager und seine stahlgrauen Augen konnten gleichermaßen kalt wie mitfühlend blicken. Ein besonderes Funkeln trat in sie, wenn er Monique ansah. Drei Jahre jünger als der Colonel, entstammte „die Lady“, wie sie von den Männern genannt wurde, einer Pariser Adelsfamilie. Sie gab Sicherheit und Privilegien auf und begleitete Niklas, gemeinsam mit ihrer treuen Zofe Madeleine, bereitwillig in die neue Zukunft, wobei sie sich als ebenso klug und ebenso zäh wie der Colonel erwies. Die rauen Jahre in Texas nahmen ihr nichts von ihrer natürlichen Schönheit und Anmut. Während Niklas im Bürgerkrieg gegen die Yankees kämpfte, focht Monique, gemeinsam mit der Rumpfmannschaft der Ranch, gegen Banditen, Comanchen und Apachen, und erwies sich dabei als ebenso treffsicher wie ihr Mann.
Bei diesem Treck kam es darauf an, bei einer möglichen Begegnung mit Unionstruppen glaubhaft zu machen, dass man eine harmlose Gruppe von Siedlern sei, die ihr Glück in einer neuen Heimat suche. So hatte Niklas P. Ronay, wenn auch eher widerwillig, zugestimmt, dass Monique und eine Reihe anderer Frauen, ja sogar Kinder, im Wagenzug mitfuhren.
Vor allem Letzteres erfüllte den Colonel und seine Raiders mit äußerstem Unbehagen. Keiner von ihnen schätzte es, Frauen und Kinder in solche Gefahr zu bringen, aber das Kriegsministerium in Richmond hatte deutlich gemacht, dass dies zur Tarnung erforderlich sei. Man lege aber Wert auf Freiwilligkeit. So mussten die Raiders akzeptieren, dass Frauen ihren Männern im Patriotismus nicht nachstanden und Niklas begriff wieder einmal, wie schwer es ihm fiel, gegen Moniques Argumente zu bestehen. Wenn sein heißes Blut auf Moniques kühle Argumentation traf, musste sich der hartgesottene Colonel immer wieder eingestehen, wie rasch er den Wünschen seiner Frau nachgab. In diesem Fall tröstete er sich damit, ihre Gesellschaft für viele Monate genießen zu können, was in Zeiten des Krieges nicht selbstverständlich war.
Schon der Weg hinauf nach Kanada beanspruchte die Wagen, aber das war nichts im Vergleich zu dem Rückweg, denn jetzt musste die Fuhrwerke nicht nur den „Hausstand“ der Siedler und die Vorräte transportieren, sondern zudem die versteckten Waffen. Diese Verstecke waren auch der Grund, warum man die Gespanne in Texas hatte fertigen müssen und keine Wagen aus Kanada verwenden konnte. Zwölf der Fahrzeuge waren so gekonnt umgebaut worden, dass ihre Hinterachse sogar Bestandteil eines Geschützes war, welches vom Wagenaufbau verborgen wurde.
Die Waffen waren kaum mehr als der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein, allerdings vermochten viele Tropfen sogar ein Fass zu füllen. Nur dies hatte Colonel Ronay bewogen, den Auftrag des konföderierten Kriegsministeriums überhaupt anzunehmen.
Die Kolonne erstreckte sich über fast drei Meilen, was auch an den Herden der mitgeführten Rinder und Pferde lag. Die zweihundertfünfzig Kavalleristen von Ronnys Raiders flankierten den Wagenzug und bildeten Vorhut und Nachhut. Ein besonderes Augenmerk galt den Tieren, denn man bewegte sich durch Indianergebiet. Pferde stellten für alle Stämme eine große Verlockung dar und manche Rothaut verschmähte Rindfleisch nicht, wenn der Büffel rar wurde.
Colonel Niklas Peter Ronay trug, wie alle Angehörigen des Trecks, zivile Kleidung. Er und seine Männer mussten auf die auffälligen und feuerstarken LeMat-Revolver verzichten und sich mit Colt Navy und Colt Army begnügen. Einzelne LeMat mochten in Händen von Privatleuten sein, doch eine Yankee-Patrouille musste misstrauisch werden, wenn fast jeder Angehörige des Trecks über eine solche Waffe verfügte. Neben den üblichen Coltrevolvern gehörten Karabiner und Gewehre verschiedener Modelle zur Ausstattung von Begleitmannschaft und „Siedlern“. An Stelle der gewohnten Säbel trug man Messer und Ronay schätzte das Gewicht des schweren und von ihm selbst gefertigten Bowiemessers an seiner Hüfte. Für manchen der konföderierten Kavalleristen war es ein Trost, dass ihre Uniformen und Waffen in geschickt getarnten Verstecken mitgeführt wurden.
Der Colonel hatte sich von der Vorhut zurückfallen lassen und trabte nun gemächlich neben dem vorderen Wagen, neben dessen Gespannführer, wie hätte es auch anders sein können, seine Frau Monique auf dem Bock saß. Ebenso selbstverständlich war die langläufige Schrotflinte, die quer über den Schenkeln lag. „Die Lady“ war in ein einfaches Baumwollkleid gehüllt und trug, zum Schutz gegen die Sonne, einen der bei einfachen Siedlerfrauen beliebten schlichten Schutenhüte.
Es ging auf den Mittag zu und es war ein heißer Tag, der allen den Schweiß aus den Poren trieb. Die Wagen bewegten sich an der Ostseite der Rocky Mountains entlang. Das mächtige Gebirge beherrschte alles und wer es neben sich aufragen sah, der begriff, warum es so lange ein unüberwindliches Hindernis zwischen Osten und Westen gewesen war.
Niklas zog den Hut vom Kopf und wischte sich mit dem Halstuch Schweiß von der Stirn. „Wir müssten jetzt ungefähr einhundert Meilen vom Fort Benton entfernt sein. Ich glaube nicht, dass die Yankees ihr Patrouillengebiet bis hierher ausdehnen.“
Monique schüttelte den Kopf. „Vergiss den Marias Pass nicht, den wir hinter uns gelassen haben. Benton ist der einzige Yankee-Vorposten in weitem Umkreis. Ich bin mir sicher, dass sie auch hier nach dem Rechten schauen.“
Der Fahrer neben ihr ließ ein leises Schnauben hören. „Ihr Pech, wenn sie uns in die Quere kommen.“
„Sei kein Narr, Slim“, rügte Monique und ihr Lächeln nahm ihren Worten die Schärfe. „Natürlich werden wir mit einer Patrouille fertig, aber was ist dann? Die anderen Yankees werden nach ihrer Patrouille suchen und die sind schneller, als wir mit den schwer beladenen Wagen. Sie würden uns einholen und du weißt, Slim, wie die Yankees sind.“
„Wie die Schmeißfliegen“, knurrte der stämmige Mann. „Kaum hat man eine erschlagen, sind auch schon die nächsten da.“
Die Französin zeigte Slim ihr strahlendstes Lächeln. „Slim, du bist ein netter Bursche, jedoch auch ein schrecklicher Barbar. Statt dich mit dem prachtvollen Anblick dieser Berge zu berauschen, hegst du hässliche Gedanken wegen der Yankees. Weißt du eigentlich, wie beeindruckend die Rocky Mountains sind?“
Der Fahrer und Niklas warfen sich einen vielsagenden Blick zu.
„Du wirst es uns sicher gleich sagen, Lady“, brummelte Slim.
Monique ließ sich niemals zweimal auffordern, die gute Bildung ihrer Pariser Privatschule kundzutun. Zumal sie diese beständig durch die Lektüre von Büchern erweiterte. Auch während des Trecks führte sie einen kleinen Reisekoffer mit sich, der einen Querschnitt aus Reiseberichten und Lexika enthielt, nebst der für Monique unentbehrlichen Poesie. Immer wieder gab die hübsche Rotblonde ihr Wissen kund. Sie tat dies nicht aus Eitelkeit, sondern aus dem Gefühl heraus, dass sich Wissen stets auszahlte und oft genug behielt sie damit auch recht.
„Die Rocky Mountains, meist auch schlicht Rockies genannt, erstrecken sich über 3.000 Meilen von Kanada bis in den Süden der USA und bildeten lange Zeit ein unüberwindliches Hindernis zwischen dem Osten und dem Westen. Die seitliche Ausdehnung dieser Bergkette beträgt in Colorado bis zu dreihundertsiebzig Meilen, an den schmalsten Stellen immerhin noch dreißig. Der höchste Berg ist der Mount Elbert, ebenfalls in Colorado, mit einer Höhe von stolzen 14.400 Fuß. Ihre durchschnittliche Höhe liegt allerdings nur bei 3.000 Fuß.“
„Yeah“, knurrte Slim in seinem breiten texanischen Dialekt, „und das sind 3.000 Fuß zu viel, wenn man auf die andere Seite will. Und dann sind da noch die Rothäute.“
„Nett, dass du das ansprichst, Slim.“ Monique verschob das Kissen unter ihrem Gesäß ein wenig. Der Wagen selbst war kaum gefedert und die Blattfedern des Bocks dämpften die Stöße nur unvollständig. „Früher lebten Absarokee, Apachen, Arapahoe, Sioux, Bannock, Cheyenne, Shoshone und Ute in den Ausläufern der Berge. Ab dem Jahr des Herrn 1720 drangen die ersten Weißen vor. Die Rockies wurden zum Kriegsgebiet zwischen den Pelzhandelskompanien der Hudson´s Bay Company und der North West Company auf kanadischer Seite und der American Fur Company und der Missouri Fur Company auf amerikanischer Seite. Es war die Zeit der großen Pioniere wie William Ashley, Jim Bridger, Kit Carson und anderen. Männer, die auch einen Weg über die bis dahin unbezwingbaren Berge suchten.“
„Unbezwingbar, wenn es um Wagen wie die unseren geht“, wandte Niklas aus dem Bedürfnis heraus ein, überhaupt etwas beizutragen.
Monique nickte. „1824 hat Jedediah Smith dann den South Pass entdeckt und inzwischen gibt es eine Reihe von Wegen, die durch die Rockies führen. So wie der Marias Pass, der nun hinter uns liegt.“
„Und der Bridger Pass, den wir noch vor uns haben.“ Slim biss ein Stück von seinem Kautabak ab und begann den Pfriem genüsslich hin und her zu schieben. Seine nächsten Worte klangen daher ein wenig undeutlich. „Hey, Colonel, über den müssen wir doch auf die andere Seite, nicht wahr?“
„Verdammt, Slim“, rügte nun Niklas, „wie oft soll ich dir noch sagen, dass wir auf dem Treck keine militärischen Bezeichnungen und Dienstgrade verwenden? Wir sind ein harmloser Siedlertreck aus Kanada, merke dir das endlich, du sturer Esel.“
Slims grinste. „Klar, Boss. Aber nur so lange, wie uns die Yanks nicht auf die Schliche kommen.“
„Das lass meine und Moniques Sorge sein“, knurrte der Colonel verdrießlich. „Du achte nur auf die Regeln. Ich will mich unterwegs nicht mit den Blaubäuchen anlegen.“
„Da kommt einer von der Vorhut.“ Slim wies mit der Peitsche vor sich. „So wie der im Sattel hängt, müsste das Thompson sein.“
Tatsächlich kehrte einer der Vorhutreiter zurück, orientierte sich zum vordersten Wagen und kam rasch heran. „Meldung von, äh, Mister Soames. Yankees vor uns.“
Die Augen des Colonels verengten sich. „Wie viele?“
„Neun Kavalleristen und eine kleine Kutsche. Sieht nicht nach einer Patrouille aus, sondern nach der Eskorte für einen höheren Offizier oder wichtige Zivilisten.“
„Lass dein Eisen stecken, Slim“, mahnte Monique. „Die Leute sind keine Gefahr für uns.“
„Aber sie werden zu einer Gefahr, wenn sie misstrauisch werden und uns melden“, hielt der Fahrer dagegen.
„Wir überlassen das Reden möglichst Monique“, meinte Niklas. „Dann wird auch alles gut gehen. Die Streife der Royal Canadian Mounted Police, an der kanadischen Grenze, hat sie ja auch um den Finger gewickelt.“
„Yeah, unsere Lady ist verdammt überzeugend“, gab Slim bereitwillig zu. „Weiterfahren, Boss?“
„Was denn sonst?“
Colonel Ronay gab seinem Pferd die Zügel frei, um zur Vorhut aufzuschließen. Der lange Treck folgte mit der Kakofonie jener Geräusche, die für einen Wagenzug typisch waren. Das Rumpeln der Wagen, Stampfen der Hufe, die Rufe von Reitern und Fahrern, dazu die Schreie einiger Kinder, das Wiehern von Pferden und Brüllen der Rinder. Kein Wagenzug war in der Lage, lautlos durch das Land zu schleichen und kündete sich durch den Lärm über Meilen hinweg an.
Die kleine Vorhut bestand aus fünfzehn Männern, die dem Treck ungefähr drei Meilen voraus waren. Sie hielten nach Gefahren Ausschau und zugleich nach einer leichteren Passage für die Wagen. Zwar war die Route bekannt, aber Erosion konnte einen Felssturz auslösen, ein starker Regenfall tiefe Furchen in den Pfad spülen und Bäume konnten durch Schneelast oder Alter umstürzen und den Weg blockieren.
In diesem Fall war man auf eine kleine Abteilung des Gegners gestoßen. Für Colonel Niklas P. Ronay war sich sofort sicher, dass von ihr keine wirkliche Gefahr ausging. Es waren neun Kavalleristen unter der Führung eines alten Lieutenants, die eine kleine Kutsche eskortierten.
Die Männer trugen nicht die übliche Felduniform mit den schlichten „Sackjacken“. Diese waren durch die kurzen „Shell Jacketts“ ersetzt, die bei Paraden getragen wurden und mit gelben Besatz verziert waren. Auf die aus Messing bestehenden Epauletten, die als Säbelschutz konzipiert waren, hatte man jedoch verzichtet, wohl weil sie in der Sonne verräterische Reflexe erzeugten. An Stelle der Paradehüte saßen die einfachen Feldmützen, die „Bummers Caps“ auf den Köpfen. Im Feld war diese Kombination der Uniformteile eher ungewöhnlich.
An der Kutsche waren die Speichen eines Hinterrades gebrochen und dies brachte die Unionstruppe offensichtlich in erhebliche Schwierigkeiten, da kein Ersatzrad verfügbar schien. Ein wenig hilflos standen die Kavalleristen bei dem havarierten Fahrzeug und ihr Offizier unterhielt sich angeregt mit Soames, der die Vorhut befehligte.
Als Niklas näher trabte, erkannte er eine junge Frau, die ein wenig abseits stand und zum Schutz gegen die grelle Sonne einen Schirm aufgespannt hielt. Er ahnte sofort, was das zu bedeuten hatte, und empfand eine gewisse Sympathie und Respekt für den weiblichen Passagier der Kutsche. Dies war offensichtlich auch der Grund für die ungewöhnliche Uniformierung. Die Soldaten hatten sich, zu Ehren des weiblichen Passagiers, ein wenig „herausgeputzt“, um einen guten Eindruck zu machen.
Der Colonel war froh, dass er durch seine Frau auch einige Sätze Französisch beherrschte, was der Tarnung des Waffentransportes zugute kam. Er lenkte sein Pferd zu der Gruppe und wandte sich lächelnd an den Kommandeur der Eskorte. „Allors, mon ami, mir scheint, Sie stecken ein wenig in der Bredouille, n´est-ce pas?“
Der Mann musste sich schon dicht an der Pensionsgrenze befinden. Die Haut des Gesichtes wirkte, vom Dienst an der Grenze, wie gebräuntes Leder und als der Lieutenant das Lächeln erwiderte, erschienen zahllose Fältchen um seine Augen. „Kann man so sagen, Mister. Uns ist das Rad gebrochen. Ein verdammter Stein hat den Radreifen gesprengt und das haben die Speichen nicht ausgehalten. Verdammtes Pech, weil uns das schon einmal passiert ist und wir kein Ersatzrad mehr haben.“
„Ja, verdammtes Pech“, stimmte Niklas zu. „Andererseits haben Sie und die junge Mademoiselle Glück, dass sie uns begegnet sind.“
„Lieutenant van Eyck“, stellte sich der Offizier nun vor. „Ich befehlige die Eskorte für Miss Sanders. Wir sind auf dem Weg nach Fort Benton.“
„Niklas P. Ronay. Ich führe den Wagenzug. Wir sind von Kanada auf dem Weg nach New Mexico, um dort zu siedeln.“
„Himmel, da haben Sie aber einen verdammt weiten Weg vor sich“, knurrte van Eyck. „Was treibt Sie denn dort hinunter? Ich dachte immer, Kanada sei groß genug.“
„Das gilt sicher auch für die Vereinigten Staaten, n´est-ce pas?“ Niklas lachte und sah erleichtert, dass sich die Wagen näherten. Bald würde ihm Monique zur Seite stehen und auf ihre charmante Weise dafür sorgen, dass keiner der Yankees Verdacht schöpfte.
„Ihr Vorhutreiter meinte, dass Sie uns sicher mit einem passenden Rad aushelfen können“, meinte van Eyck und warf einen raschen Blick zu Soames, der entspannt im Sattel saß und seine Meerschaumpfeife im Mundwinkel hatte. „Selbstverständlich bezahlen wir.“
„Unsinn, Lieutenant. Wir können ein Rad sicher entbehren und im Westen hilft man sich ja wohl.“ Niklas sah zu der jungen Frau hinüber. „Mademoiselle will nach Benton?“
„Und sie will dort heiraten“, bestätigte der Offizier.
Niklas sah seine Ahnung bestätigt. „Es gibt sicher nicht viele Frauen, die einen solchen Entschluss fassen.“
„Nein, nicht viele. Das Leben in einem Grenzfort ist alles andere als behaglich. Vor allem jetzt, da die Roten unruhig sind.“
„Meinen Sie, es besteht Gefahr für meine Leute?“
„Sie haben eine Menge Wagen und eine Menge Leute“, antwortete van Eyck bedächtig. „Schätze, Sie haben um die dreihundert Gewehre. Da werden sich die Roten nicht leichtfertig mit Ihnen anlegen, Mister Ronay. Allerdings … Sehen Sie, Mister, es herrscht Krieg zwischen den Nord- und den Südstaaten. Mancher Rote glaubt daher, seine Chance sei gekommen, um die Weißaugen aus seinem Land zu vertreiben. Da ist Vorsicht angebracht und, offen gesagt, ich bin froh, wenn wir hier bald verschwinden können.“
„Verständlich, Monsieur van Eyck. Ah, da kommt meine Frau Monique. Sie wird sicher ein paar Worte mit Ihrer reizenden Begleitung wechseln wollen. Frauengespräch, Sie verstehen?“
„Durchaus, Mister. Im Fort leben nur noch zwei andere Frauen und die sind begierig auf weitere Gesellschaft.“
„Mister Soames, holen Sie Mister Curtis, unseren Wagenbauer“, wies Niklas an. „Er soll sich die Kutsche ansehen.“
Niklas drängte es zur Eile. Je mehr Zeit die Unionssoldaten hatten, den Treck zu beobachten und sich ihre Gedanken zu machen, desto größer war die Gefahr, dass sie doch noch misstrauisch wurden.
Glücklicherweise zog Monique die Aufmerksamkeit der jungen Frau und ihrer Eskorte auf sich, als sie mit französischem Dialekt von ihrem Dorf in Kanada berichtete, das man hatte aufgeben müssen, da die Regierung dort Indianer ansiedelte. Die Teilnehmer des Trecks seien dermaßen enttäuscht gewesen, dass sie sich zum Umsiedeln in die Vereinigten Staaten von Nordamerika entschlossen. Natürlich waren sie besorgt, wegen dieses schrecklichen und barbarischen Krieges, der die netten Nordamerikaner so plagte, aber der werde ja sicher bald zu Ende sein. Außerdem habe man in Kanada von den Lockungen New Mexikos gehört und so habe es kein Halten mehr gegeben.
Was die Nordstaatler von Moniques wortreichen Ausführungen dachten, war schwer zu beurteilen. Wahrscheinlich hielten sie die „Kanadier“ für ein bisschen verrückt, sie hatten schließlich ihre eigenen Probleme. Jedenfalls tauten die Yankee-Kavalleristen sichtlich auf, als sich weitere Frauen und sogar ein paar Kinder einfanden. Die Anwesenheit der Letzteren beunruhigte den Colonel nicht wenig, denn Kinder besaßen, nach seiner festen Meinung, keine Disziplin und sahen ihre Rolle als Siedlerkinder, als wären sie an einem Spiel beteiligt.
Inzwischen war der bullige Curtis eingetroffen. Gemeinsam mit zwei Gehilfen und einigen der Yankees nahm er Maß für das Ersatzrad, ließ es von einem der Wagen bringen und bereitete die Montage an der Kutsche vor. Die Arbeit war nicht kompliziert, nur zeitaufwendig. Man musste die Kutsche mit einem Hebel weit genug anheben, um das Rad aufzuziehen, Achse und Nabe gut fetten und die Splinte befestigen, die es an Ort und Stelle hielten.
Niklas P. Ronay räusperte sich und wandte sich den Umstehenden zu. „Mes amis …“ Er klatschte auffordernd in die Hände. „Wie der nette Offizier es so treffend sagte … Wir haben noch einen weiten Weg vor uns und wir sollten keine unnütze Zeit verlieren. Wir haben noch ein paar Stunden Tageslicht und die will ich nutzen. Zumal Mister Soames noch nach einem geeigneten Nachtlager, mit genug Futter und Wasser, Ausschau halten muss. Also, mes amis, auf die Wagen, wir fahren weiter. Ich folge mit Mister Curtis und seinen Helfern und werde euch beizeiten einholen.“
Auch wenn sie der Feind waren, so boten die Unionssoldaten doch eine Abwechslung und sie waren so tief im Indianergebiet immerhin Weiße. So gab es einiges Murren, als sich der Treck wieder in Bewegung setzte und die lange Kolonne an der Kutsche und den Zurückbleibenden vorbei fuhr.
Monique scherzte mit den Yankees, während Curtis und seine Gehilfen das neue Rad aufsetzten und die Kutsche fahrbereit machten.
Niklas wandte sich nochmals an den älteren Lieutenant. „Auf unserem Weg sind wir oft im Indianergebiet unterwegs. Den Gebieten verschiedener Stämme. Sie sagten, wir müssten mit Feindseligkeiten rechnen?“
Der Kavallerieoffizier zuckte mit den Schultern. „Es ist immerhin möglich. Die meisten Roten schätzen uns Weiße ja nicht besonders. Aber ihr Treck ist stark und sie werden sich nicht unbedingt mit Ihnen anlegen, Mister Ronay. Ich würde Ihnen aber auf jeden Fall empfehlen, mit den Stämmen zu handeln, wenn Sie deren Gebiet erreichen. Kaffee, Zucker, Tabak und Mehl sind stets willkommen und könnten Ihnen die freie Durchfahrt bringen. Aber hüten Sie sich davor, den Roten Alkohol oder Waffen zu geben. Alkohol enthemmt diese Brüder und kann rasch dazu führen, dass sie plötzlich doch noch auf frische Skalpe aus sind.“
„Hm, danke für den Rat, Lieutenant, ich werde ihn beherzigen“, versicherte Ronay. „Glücklicherweise haben wir genug Vorräte und auch ein paar Handelswaren. Die von Ihnen erwähnten Dinge, auch Decken und Stoffe. Ich glaube, sogar Glasperlen. Die nehmen die Roten angeblich gerne, um ihre Prunkgewänder zu verzieren.“
Van Eyck nickte lächelnd. „Ja, das kann ich bestätigen. Welche Route wollen Sie nehmen?“
„Zum Quellgebiet des Yellowstone, dann über den Bridger Pass auf die andere Seite der Rockies und dann hinunter nach Süden.“
„Auf dieser Seite werden Sie überwiegend Cheyennes und Sioux begegnen. Es gab unlängst einige Unruhen mit diesen Stämmen. Ein gewisser Chivington hatte eines ihrer Winterlager überfallen und es gab eine Menge böses Blut. Inzwischen haben die Truppen die Ordnung wieder hergestellt. Wahrscheinlich können Sie mit diesen Stämmen wieder Handel treiben. Aber auf der anderen Seite der Rockies kommen Sie in das Gebiet der Ute. Die Burschen sind heikel, denn sie legen sich mit jedermann an. Versuchen Sie zu handeln, Mister Ronay, aber bereiten Sie sich auch auf die härtere Gangart vor.“
„Wie schon erwähnt, ich werde Ihre Ratschläge beherzigen. Ah, ich sehe, Mister Curtis ist fertig …“
Vielleicht bemerkte nur Niklas die Anspannung seiner Männer. So gewissenhaft sie auch sein mochten, es bestand dennoch die Gefahr, dass einer von ihnen eine unbedachte Bemerkung machte und einen der Kameraden mit dessen militärischem Rang ansprach.
Der Colonel hatte diesen Gedanken kaum gehabt, als es auch tatsächlich geschah.
„Gute Arbeit, Sergeant Curtis“, lobte einer der Südstaatler den bulligen Kameraden. „Jetzt können die Yankees wohl weiterfahren.“
Niklas beobachtete, wie der Lieutenant zusammenzuckte. Bevor sich in diesem ein Verdacht bildete, versuchte der Colonel, die Situation zu entschärfen. „Lass gut sein, Jennings, du weißt doch, dass Curtis nicht gerne an seinen Militärdienst bei den British Grenadiers erinnert wird. Und ich glaube, hier in den USA gilt es als unhöflich, die Bewohner als Yankees zu bezeichnen, auch wenn das bei uns in Kanada durchaus üblich ist.“
Raider Jennings errötete unmerklich. „Tut mir leid, Boss“, brummte er. „Ich wollte niemanden beleidigen.“
Curtis warf einen Seitenblick auf den Yankeeoffizier. „Werde nicht gerne an meine Zeit bei den Grenadiers erinnert, Lieutenant. Zwei Jahre in Indien. Unter Aufständischen, Stechmücken und Fieber. War froh, als ich wieder Zivilist wurde.“
„Hm“, brummte van Eyck einsilbig. Er war nun schon etliche Jahre im Dienst der US-Armee und konnte nicht nachvollziehen, dass jemand etwas dagegen hatte, als Soldat für sein Land einzutreten. Aber Patriotismus war wohl nicht die Sache dieser Kanadier.
Monique und ihr Wagen waren ebenfalls zurückgeblieben, da Curtis und seine Helfer nicht beritten waren und ein Transportmittel benötigten. Die „französische Lady“ legte den Arm um die Schulter von Miss Sanders und dirigierte sie sanft zum Einstieg der Kutsche. „Bald werden Sie Ihren Verlobten sehen, Miss. Es wird sicher eine fabelhafte Hochzeit werden. Wirklich, ich beneide Sie jetzt schon. Ihr künftiger Ehemann ist sicherlich ein prachtvoller Soldat.“
„Ja, das ist er“, antwortete die jüngere Frau und die Gedanken an ihren Zukünftigen zauberte ein inniges Lächeln auf ihr Gesicht. „Wir waren jetzt zwei Jahre getrennt und konnten uns nur schreiben. Dieser dumme Krieg, Sie verstehen? Peter diente in einem der Bürgerkriegsregimenter und wurde dann vor einem halben Jahr nach Benton versetzt.“ Sie seufzte leise. „Ich ziehe die relative Langeweile in einem Grenzfort der Aufregung einer Stadt im Kriegsgebiet vor.“
„Gütiger Himmel, meine Liebe, da kann ich Sie gut verstehen. Ich kann uns nur wünschen, dass wir von diesem Krieg und vor Indianerüberfällen verschont bleiben.“
Die beiden Frauen reichten sich die Hände und wünschten sich gegenseitig Glück. Für Niklas und den Lieutenant war dies das Zeichen zum Aufbruch. Mit knappen Befehlen brachte der Offizier die Eskorte in den Sattel. Nach kurzem Zögern lenkte er sein Pferd zu Niklas.
„Sie scheinen mir erfahren zu sein, Mister Ronay. Dennoch, beherzigen Sie meinen Rat. Schon im Interesse der Frauen und Kinder. Auch wenn Ihr Wagenzug groß ist, so ist das keine Garantie, dass Sie ungeschoren durch die Indianergebiete kommen. Im Gegenteil, es kann durchaus sein, dass die vielen Wagen eine große Verlockung für die Roten sind. Ich habe den Eindruck, dass Sie Ihre Route gut geplant haben. Haben Sie einen erfahrenen und ortskundigen Treckführer?“
„Mister Soames kennt sich aus und wir haben eine gute Karte.“
„Dann nutzen Sie nach Möglichkeit die Trails, auch wenn diese überwiegend eine Verbindung zwischen dem Osten und dem Westen bieten. Aber die Trails werden von der Armee patrouilliert und das bietet Ihnen zusätzliche Sicherheit.“
„Wir kommen schon klar, Lieutenant.“
Der Offizier nickte mit ernstem Gesicht. „Davon bin ich überzeugt, Mister Ronay. Viel Glück. Ich wünsche Ihnen und Ihren Leuten, dass Sie einen guten Flecken Land zum Siedeln finden.“
Der Kavallerist deutete den militärischen Gruß an, nickte Niklas nochmals zu und folgte dann der Kutsche und ihrer Eskorte, die sich nach Westen bewegten.
Monique hakte sich bei Niklas unter. „Ein netter Yankee, mein Herz, und er meint es gut. Ich bin erleichtert, dass es zu keiner Auseinandersetzung kam. Schon wegen der netten Miss Sanders.“
„Es gibt nicht viele Frauen, die von der Liebe in die Wildnis der Indianergebiete gezogen werden“, sagte er nachdenklich und berührte sanft ihre Wange.
Sie lehnte ihr Haupt für einen Moment gegen den leichten Druck seiner Hand und lächelte. „Allors, mon Cher, es wird Zeit, den anderen zu folgen.“
Er küsste sie flüchtig und sah aus den Augenwinkeln das breite Grinsen von Slim. „Du hast recht, Liebes. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns.“
Sie waren über 2.000 Meilen von Texas hinauf nach Kanada gezogen, waren am Saskatchewan River mit den Waffenhändlern zusammengetroffen und nun mussten sie den gleichen Weg zurück nehmen. Ein wahnwitziges Unterfangen, denn auch wenn sie eine Vielzahl von Waffen und Munition mit sich führten, so war ihre Fracht kaum von kriegsentscheidender Bedeutung. Selbst ein Dutzend solcher Wagenzüge würden die Lage für die Konföderation nur unwesentlich verbessern. Dem erfahrenen Soldaten Niklas P. Ronay war dies bewusst und er führte diesen Auftrag nur durch, weil er sich längst seine eigenen Gedanken über ihn gemacht hatte.
Kapitel 2 Zwischen Rockies und Big Horn Mountains
In der Nähe des Quellgebietes des Yellowstone Rivers in Montana.
Sie hatten die relative Nähe zu Fort Benton und dem Missouri River hinter sich gelassen und gelangten nun in das Quellgebiet des Yellowstone River. Hier näherten sich die Big Horn Mountains den Rocky Mountains an. Zwischen den Ausläufern der beiden Gebirge blieben manchmal nur zwanzig oder sogar nur zehn Meilen Abstand. Zwar war die Passage für die schwer beladenen Planwagen bequem zu meistern, doch dieses Gebiet war lange Zeit heiß umkämpft gewesen. Hier waren Sioux und Cheyennes nicht nur gegen die Weißen, sondern auch gegen Apachen, Pawnees und andere Stämme angetreten und hatten diese schließlich vertrieben. Nun waren sie die uneingeschränkten Herren in einem Gebiet, welches Teile von Montana und Dakota umfasste sowie jenes Dakota zugerechnete Territorium, durch das sich der Treck nun bewegte.
Colonel Niklas P. Ronay hatte den Wagenzug ungewöhnlich früh lagern lassen. Hier, am Ufer des Yellowstone, fanden die Tiere reichlich Nahrung und Wasser. Der Pass zwischen den Gebirgen war kaum fünf Meilen entfernt und Niklas rief seine Offiziere und führenden Sergeants zusammen, um den kommenden Tag zu besprechen. Natürlich ließ sich Monique nicht von der Teilnahme abhalten, da sie, nicht ganz zu Unrecht, geltend machte, für die Frauen und Kinder zu sprechen, die ein Recht hatten zu erfahren, was „The Iron“ plante.
Überall bereitete man sich auf die Nacht vor. Tiere wurden versorgt, die Planwagen auf Schäden untersucht, die man ausbessern musste, und an den zahlreichen Kochfeuern wurden Kaffee und eine warme Mahlzeit zubereitet.
Niklas wartete, bis alle mit einem Becher frisch gebrühten Kaffees versorgt waren, wobei Monique einen Tee bevorzugte. Sie sah ein wenig missmutig in die feine Porzellantasse, was den Colonel zu der Frage bewegte, was sie denn bedrücke.
„Mein Vorrat geht zur Neige, mon Amour“, gestand sie ein. „Es sind nur noch wenige Blätter in meiner großen Teedose. Danach werde ich mich mit dem zweiten und dritten Aufguss begnügen müssen.“
„Nun, meine Liebste, das ist bedauerlich“, antwortete er leise. „Möglicherweise begegnen wir einem Händler, der Tee in seinem Sortiment hat.“
Sie zuckte mit den Schultern, was bei ihr anmutig aussah. „Americans schätzen Tee nicht sonderlich. Es wird schwer, einen solchen Händler zu finden.“
Captain Soames bemerkte die Hilflosigkeit seines Befehlshabers und versuchte ihm zur Seite zu stehen. „Nicht unbedingt, Lady. Bei den Damen der Yanks ist dieses Gesöff ebenfalls recht beliebt. Es kann also durchaus sein …“
Der Südstaaten-Offizier verstummte unter ihrem Blick. Er fing sich nun jene Kritik ein, die ansonsten dem Colonel gegolten hätte. „Mister Soames, als Südstaatler, Offizier und Gentleman, sollten Sie dieses von Ihnen als Gesöff bezeichnete Getränk ebenfalls zu schätzen wissen. Tee erfrischt ebenso wie Ihr Kaffee und ist weitaus bekömmlicher.“
Sergeant Slim, der für die Wagenführer sprach, grinste. „Und beide Getränke kann man mit einem guten Schuss eines ausgezeichneten Whiskeys noch bekömmlicher machen.“
Monique Ronay warf ihm einen mitleidigen Blick zu. „Slim, auch wenn ich mich wiederhole … Ich schätze Sie als Weggefährte, aber Sie bleiben dennoch ein Barbar.“
Niklas nickte. „Sie hat nun einmal recht, Slim. Man sollte einen guten Whiskey nicht durch Tee oder Kaffee verdünnen.“
Ein paar Lacher ertönten, während Monique sanft lächelte. Wie üblich war es ihr gelungen, ein Ventil für die Anspannung der Männer zu erschaffen. „Niklas?“
Er räusperte sich kurz, zog sein Bowie-Messer aus dem Waffengürtel und zog ein paar Linien in den weichen Boden. Mit knappen Worten schilderte er die Örtlichkeiten, die sie erwarteten. „Wir kennen diesen Pass von unserem Hinweg nach Kanada. Damals haben wir nur ein paar Rothäute aus der Ferne gesehen. Ich fürchte, diesmal werden wir nicht so leicht durchkommen. Ich erinnere die Gentlemen an die gut gemeinten Warnungen dieses Yankee-Lieutenants. Offensichtlich gab es vor Kurzem eine heftige Auseinandersetzung mit den Sioux und Cheyennes. Wir müssen also damit rechnen, mit ihrer Feindseligkeit konfrontiert zu werden. Einige von uns bemerken schon seit drei Tagen Späher, die uns beobachten. Sicher wissen ihre Brüder längst über uns Bescheid und die ideale Stelle, um uns aufzuhalten, ist dieser Pass.“
Captain Soames strich sich über den dichten Vollbart. „Wir haben dort teilweise nur zehn Meilen Breite. Theoretisch ist das mehr als genug Raum zum Manövrieren, aber unsere Wagen sind allesamt schwer beladen und langsam. Wir werden also kaum ausweichen können und müssen nehmen, was da kommt.“
Slim nickte. „Immerhin haben wir oft genug geübt, wie man eine Wagenburg bildet.“
Niklas P. Ronay wiegte nachdenklich den Kopf. „Eine Wagenburg ist eine defensive Maßnahme und würde die Rothäute davon überzeugen, dass wir sie fürchten. Das könnte sie erst recht zu einem Angriff ermutigen. Trotz unserer relativ großen Zahl.“
„Wir sollten unsere eigentlichen Waffen aus den Verstecken holen“, schlug einer der anderen Offiziere vor. „Damit könnten wir weitaus wirksamer kämpfen als mit dem Schrott, den wir momentan mit uns herumschleppen.“
„Wohl wahr, Mister Wheeler“, stimmte Ronay zu, um jedoch sofort abzulehnen. „Ich würde sogar weitaus lieber in der Uniform kämpfen als in diesen Zivilklamotten, aber es geht nun einmal nicht. Gentlemen, wenn wir zufällig von ein paar Yankees mit unseren Uniformen und Waffen beobachtet werden, dann brauchen wir uns keiner Illusion hinzugeben … Dann werden wir Texas niemals wieder erreichen. Zudem sind die Waffen, die wir verwenden, nicht wirklich schlecht. Man kann mit ihnen schießen und auch treffen.“
„Yeah, wenn der Allmächtige ein wenig nachhilft“, spottete ein Sergeant.
„Allors, mon Cher, du hast doch sicher einen deiner berühmten Pläne“, warf Monique ein.