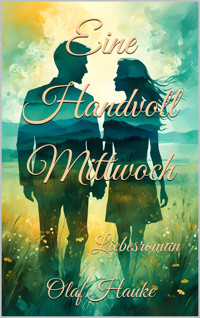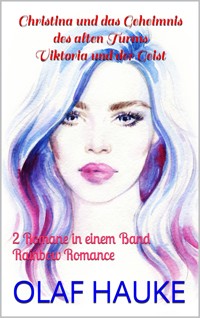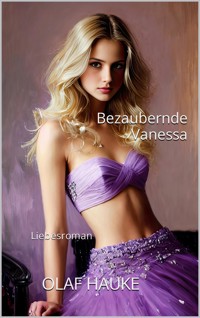0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tabea führt ein zurückgezogenes Leben, seit sie ihr Kind verloren und dies zur Trennung von ihrem Mann führte. Sie ist Psychiaterin in einer Klinik, hat dort eine Wohnung und verlässt das Gelände so gut wie nie. Ihr Beruf ist zu ihrem Leben geworden. Eines Nachts erhält sie einen Anruf, dass ein Patient von ihr aus der Klinik floh und nun auf einer Brücke steht, bereit, sich in die Tiefe zu stürzen. Sofort macht sie sich auf den Weg aber sie kommt zu spät. Letztlich kann sie seinen Tod nicht verhindern. In den nächsten Tagen spürt sie, dass sich etwas in der Klinik verändert. Schuld daran ist der Tod des Mannes, aber auch eine neue Patientin, die jeder, außer ihr, zu kennen scheint. Erst durch einen Zufall erfährt Tabea um wen es sich handelt. Damit kommen Steine ins Rollen, die schnell zu einer Bedrohung für Tabea werden. Wo ist ein Mensch, der sie nicht belügt und dem sie noch vertrauen kann?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Ende
Willkommen in deinem Leben
Olaf Hauke
2024
Copyright 2024
Olaf Hauke
Greifswalder Weg 14
37083 Göttingen
T. 01575-8897019
Cover: aalmeidah
Kapitel 1
Das Geräusch brauchte einen Moment, ehe es vom Unterbewusstsein in Tabeas Gehirn drang und von dort die Reaktionen in Gang brachte, die schließlich dazu führten, dass sie die Augen aufschlug und direkt auf den Nachttisch starrte. Sie sah das Display ihres Mobiltelefons in einem fahlen, grünen Licht blinken und begriff im selben Moment, dass es klingelte und nach ihrer Reaktion verlangte.
Langsam drückte sie sich aus der Wärme des Kissens. Ihr Kopf war schwer, wollte wieder zurückfallen, sie musste ihren ganzen Willen aufbieten, um die Schultern nachzuziehen und den Arm, den sie unter das Kissen geschoben hatte, in Richtung des flackernden Lichts zu schieben. Die Nummer sagte ihr nicht das Geringste, aber in der oberen Ecke des Handys erkannte sie leicht verschwommen, dass es halb Drei in der Früh sein musste.
Tabea machte sich nicht mal die Mühe, sich zu räuspern, sondern drückte den Button, um das Gespräch anzunehmen. Erst jetzt war der Schlaf soweit aus ihrem Kopf gewichen, dass sie spürte, wie die Anspannung die Müdigkeit aus ihrem Körper drückte. Ein Anruf um diese Zeit konnte nichts Gutes bedeuten. Diese Überlegung ließ sie sofort hellwach werden, ihr war klar, dass sie ihr Bett verlassen und so schnell nicht wiedersehen würde, es sei denn, irgendein Idiot hatte die falsche Nummer gewählt.
„Blumenstein?“ sprach sie in das Halbdunkel des kleinen, spartanisch eingerichteten Schlafzimmers.
„Oberkommissar Köhler, Frau Doktor Tabea Blumenstein?“ Die kräftige, hellwache, männliche Stimme nahm sich nicht die Zeit, auf eine Antwort zu warten. „Ich stehe hier auf der alten Stresemann-Brücke auf Höhe der Trassen. Ungefähr zwanzig Meter von uns entfernt steht ein junger Mann jenseits der Begrenzungsmauer und droht, in die Tiefe zu springen. Ich konnte kurz mit ihm sprechen und zumindest für den Augenblick davon abhalten, von der Brücke zu springen. Er nannte mir Ihren Namen.“
Tabea hatte bereits die Beine aus dem Bett geschwungen. Ihre Füße hatten sich in der Decke verhakt, sie fiel auf den Boden. Aber Tabea bemerkte es kaum. Sie hatte sofort einen Verdacht, wer dort oben auf der Brücke stand. Mit gezielten Griffen nahm sie Jeans und einen leichten Pullover.
„Hat der Mann einen Namen gesagt?“
„Er heißt Christian – lange glatte, dunkelblonde Haare, Pferdeschwanz, eher klein, so um die eins siebzig“, kam die prompte Antwort. „Mehr hat er nicht gesagt. Ich habe einen Einsatzwagen zu Ihnen geschickt.“
Tabea brummte zufrieden, der Mann dachte mit.
Sie selbst hätte sich erst umständlich einen Wagen aus der Tiefgarage holen oder ein Taxi rufen müssen. Abgesehen davon konnte ein Blaulicht die eine oder andere rote Ampel ignorieren.
„Er soll vor dem Haupteingang warten, ich bin in spätestens vier Minuten unten.“
„Dann sind sie ungefähr in fünfzehn Minuten hier. Was kann ich in der Zwischenzeit tun, damit der Mann nicht springt?“
Das weiß ich selbst noch nicht so genau, ging es Tabea durch den Kopf. Diesen Gedanken behielt sie jedoch lieber für sich.
„Ich denke nicht, dass er seine derzeitige Lage vollständig erfassen kann. Sie können ihm erklären, dass ich unterwegs bin. Versuchen Sie nicht, auf ihn einzureden oder Erklärungen dafür zu liefern, dass er nicht springen soll.“
Der Mann versprach, sich zurückzuhalten, Tabea beendete das Gespräch. Ihr blieben knapp zwei Minuten, um alles einzustecken, was sie unter Umständen brauchen würde.
Natürlich wusste sie, wessen Leben dort draußen mitten in der Nacht an einem dünnen Faden hing. Aber warum?
Mit weit ausholenden Schritten verließ sie das Schlafzimmer der kleinen Wohnung im Gebäudetrakt der Klinik. Im Vorbeigehen griff sie ihren Mantel, streifte ihn über und trat auf den Flur.
Während sie nach unten ging, begann sie, über ihr Mobiltelefon die Patientenakte aufzurufen. Um ein Haar wäre sie dabei über eine Stufe gestolpert. Was hätte Mutter gesagt? Nie beim Gehen lesen!
Unten angekommen sah sie in die Pförtnerloge. Der Mann hinter der Glasscheibe schreckte hoch und sah sie mit bleichem Gesicht an. Natürlich, ihr Auftauchen hier mitten in der Nacht verhieß nichts Gutes.
„Christian Nimitz“, sagte sie schlicht.
„Im Offenen, Zimmer dreißig“, kam die prompte Antwort. Tabea war erstaunt, dass er die Antwort so schnell parat hatte.
„Nein, er steht auf der Stresemann-Brücke und will springen!“
„Scheiße“, folgte das Echo. „Wollen Sie einen Wagen oder soll ich ein Taxi rufen?“
„Nein, eine Streife holt mich ab. Rufen Sie Mendez an, damit er Bescheid weiß. Aber er braucht nicht zu kommen.“
„Haben Sie Nimitz gesehen, als er das Haus verließ?“
Dieses Mal sah der Pförtner auf die Ausgangsliste, die vor ihm auf dem Schreibtisch direkt unter der Glasscheibe stand. Im Hintergrund lief leise ein Radio, ansonsten war es völlig ruhig in der Klinik. Neben der Pförtnerloge stand die große Säule, an der hunderte von Flyern und Info-Broschüren hingen, dazu handgeschriebene Zettel und einige größere Poster. Eines davon machte mit dem Gesicht des Bürgermeisters Werbung für ein Gartenfest, das später im Frühsommer stattfinden sollte. Jemand hatte dem breit grinsenden Mann mit Kuli eine Zahnlücke und einen Schnauzer gemalt.
„Er hat sich nicht abgemeldet, zumindest nicht hier im Empfang.“
Das war zwar offiziell Vorschrift, aber es gab etliche Patienten im offenen Bereich, die sich nicht oder nur unregelmäßig daran hielten. Normalerweise kamen sie ja auch zurück und standen nicht auf einer Brücke, um in den Tod zu springen.
Tabea sah durch die breite, automatische Glastür, dass ein Streifenwagen hielt. Sein blaues Licht zuckte in regelmäßigen Abständen durch die Scheiben und brach sich an der Decke.
Tabea nickte dem Pförtner noch einmal zu, dann lief sie nach draußen. Eine junge Polizistin sprang aus dem Wagen und hielt ihr die Wagentür zum Fond des Fahrzeuges auf. Tabea nickte nur und wäre um ein Haar mit dem Kopf an das Dach des Autos gestoßen. Der Fahrer wartete, bis sie und seine Kollegin Platz genommen hatten, dann gab er Gas und schoss förmlich die Einfahrt zur Klinik herunter. Zum Glück war um diese Uhrzeit niemand unterwegs – niemand, bis auf Christian Nimitz, der auf einer Brücke stand und nach unten in die Tiefe auf die Gleise starrte.
Was mochte ihm jetzt gerade durch den Kopf gehen?
In den drei Jahren, in denen Tabea in der Klinik als Psychologin arbeitete, hatte es im offenen Bereich nur zwei Suizid-Versuche gegeben, beide stiller und weniger Aufsehen erregend.
Bis auf den kleinen geschlossenen Bereich waren sie ein offenes Haus. Niemand wurde gegen seinen Willen hier festgehalten, so gut wie alle Patienten waren freiwillig hier, weil sie mit dem Leben, aus welchem Grund auch immer, nicht zurechtkamen. Es gab keine verschlossenen Türen, keine Menschen, die mit Medikamenten ruhiggestellt wurden. Für die wenigen Ausnahmen gab es die Möglichkeit der Fixierung, aber sie diente nur zum Eigenschutz der Patienten, die in einem Moment die Kontrolle über sich verloren hatten und sich nicht selbst verletzen sollten.
Der Streifenwagen nahm mit hoher Geschwindigkeit eine enge Kurve, Tabea wurde hart in ihren Sitz gedrückt, gerade, als sie die Akte von Nimitz aufgerufen hatte. Die Verbindung war nicht sonderlich stabil gewesen, immer wieder hatte ihr Handy nachladen müssen. Sie hatte bisher lediglich sehen können, dass Nimitz seit vier Wochen bei ihnen war. Sie konnte sich an zwei Gespräche erinnern. Unglücklicherweise musste sie den Aufruf für die Akte neu starten, da sie wohl wegen des gewagten Fahr-Manövers an irgendeinen Button am Handy gekommen war. Aus ihrer Erinnerung heraus hätte sie nicht sagen können, dass er Mann gefährdet war, zumindest konnte sie sich an kein Alarm-Signal erinnern.
„Wir sind da“, kam die Stimme von vorne.
Tabea brummte unzufrieden und bat den Fahrer, das Blaulicht und die Sirene auszuschalten. Mitten in der Nacht konnten diese Lichter und die Geräusche eine Schrecksekunde auslösen, die sie unter allen Umständen vermeiden wollte.
Der Wagen stoppte nur wenig später. Ehe Tabea es verhindern konnte, war die Beifahrerin ausgestiegen, um ihr die Tür aufzuhalten. Tabea nickte mechanisch.
„Die Straße ist abgesperrt worden“, sagte die junge Frau, Tabea nickte erneut. Sie überlegte, ob es jetzt noch sinnvoll war, auf ihrem Handy nach der verdammten Akte zu suchen. Sie konnte sich nur noch dunkel an die Notizen erinnern, die sie selbst gemacht hatte.
Sie sah vor ihrem geistigen Auge diesen Mann, so um die Dreißig. Hatte er nicht ein Kind überfahren? Aber sie konnte sich nicht an die näheren Umstände erinnern.
Warum hatte er ihren Namen genannt? Andererseits war es nur natürlich, dass sich Patienten eher an sie erinnerten als umgekehrt.
„Frau Blumenstein?“ Tabea zuckte hoch, vor ihr stand ein Uniformierter, sie erkannte die Stimme sofort, sie hatten zusammen telefoniert.
„Ist er noch da?“ fragte sie und ging in Richtung Absperrung. Sie sah, dass die Polizistin, die ihr bereits die Tür geöffnet hatte, nun auch das Absperrband nach oben hielt, damit sie passieren konnte.
„Ja. Ich habe ihn in Ruhe gelassen, so wie Sie es gesagt haben. Ich habe ihm nur gesagt, dass Sie auf dem Weg seien.“
„Hat er darauf reagiert?“
„Nein, eigentlich nicht“, gab der Polizist zu. Er musste über Eins Neunzig groß sein, das Hemd der Uniform spannte sich über seinem Bauch. Der Stress, unter dem er stand, war deutlich an seinem Gesichtsausdruck abzulesen. Machte er sich Sorgen um den Menschen oder um einen möglichen eigenen Fehler? Er ist eine Spur zu angespannt, ging es ihr noch durch den Sinn.
Tabea versuchte, den inneren Punkt ihrer Ruhe zu finden. Von den Worten, die sie gleich sagen würde, hing ein Menschenleben ab. Am rechten Rand sah sie einen Notarzt. „Sagen Sie ihm, er soll das Blaulicht ausschalten“, stieß sie energisch hervor.
Ein feiner Nieselregen hatte eingesetzt, hier auf der Brücke herrschte ein kühler Wind, der ihr die Tröpfchen ins Gesicht blies. Der Asphalt schimmerte feucht im Schein der Bogenlampen.
Tabea sah den Schatten, der jenseits der Brüstung stand. Die beiden Unterarme hatte er über das Geländer geschoben. Er brauchte sie nur wenige Zentimeter zu heben und die Schwerkraft würde ihn unweigerlich nach unten befördern.
Tabea hatte das Gefühl, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleiben würde, bis er genau das tun würde.
Kapitel 2
„Sie hat mich in der Klinik besucht.“
Die Stimme des Mannes war kaum zu verstehen, es wirkte, als würde der Wind die Worte direkt von seinen Lippen wischen und im Dunkel der Nacht verschwinden lassen.
In der Luft hing ein eigentümlicher Geruch nach dampfendem Asphalt. Tabea stand ungefähr drei Meter neben ihm auf der anderen Seite des Geländers. Sie hatte eine Hand auf das Eisen gelegt, fühlte die feuchte Kälte in ihren Fingern. Sie konnte von seinem Gesicht nur die Nase erkennen, vom Kopf das zurückgekämmte, lange Haar, das von einem Gummi im Nacken gehalten wurde. Über den Tiefen seiner Augen hingen dunkle, gespenstische Schatten, die die Seitenansicht seines Schädels wie einen Totenkopf wirken ließen.
Direkt unter dem Mann verlief ein Stromkabel, das die Züge speiste, die unter der Brücke fuhren. Aber anscheinend herrschte hier in der Nacht Ruhe, denn bisher war alles still geblieben.
Die Polizei und der Notarzt hielten sich im Hintergrund. Tabea fragte sich, ob unten jemand wartete. Vielleicht hatte man auch den Zugverkehr blockiert, falls so etwas möglich war.
Eine düstere, schwere Stille lag über der Brücke. Tabea hatte das Gefühl, als wäre sie mit Nimitz in einer Art Glocke gefangen, als bestände die reale Gefahr, dass er sie mit in den Tod reißen würde, wenn er springen würde.
Aber er machte nicht den Eindruck, als würde er ihr nach dem Leben trachten. Wenn sie genau hinsah, konnte sie sehen, wie seine Silhouette leicht zitterte.
„Wer hat Sie besucht?“ fragte Tabea ruhig. Ihre Lippen fühlten sich beim Sprechen kalt und taub an.
„Sarahs Mutter, sie hat mich besucht.“
Tabea hatte die Akte zwar nicht mehr aufrufen können, aber sie hatte eine Ahnung, wer sich hinter dem Namen verborgen hielt.
„Sarah ist das Mädchen, das ums Leben kam?“ fragte sie und versuchte, ihre Tonlage gleich und entspannt zu halten. Das war nicht einfach, denn in ihr hatte sich eine kalte Angst breitgemacht. Sie konnte förmlich erahnen, wie der Mann plötzlich ansatzlos die Hände hob, nach vorne kippte und im nächsten Moment auf den Gleisen aufschlug oder auf die Kabel traf. Noch stand er da. Sein Kopf ruckte einige Male nach vorn, dann berührte das Kinn beinahe die Brust. Anschließend sah er wieder nach oben in Richtung des sternenlosen, wolkenverhangenen Himmels.
„Sarah ist das Mädchen, das ich getötet habe, dessen Leben ich ausgelöscht habe.“
In Tabea blitzte eine Erinnerung auf. War er nicht betrunken gewesen? Ja, sie erinnerte sich, er hatte eine Haftstrafe verbüßt, weil er betrunken in einem Wohngebiet mit viel zu hoher Geschwindigkeit das Kind totgefahren hatte. Tabea erinnerte sich an irgendwelche Gerichtsprotokolle, die sie in weiten Teilen nur überflogen hatte.
Aber so sehr sie sich auch mühte, sie konnte sich nicht erinnern, in den Unterlagen oder den Gesprächen Selbstmordabsichten bemerkt zu haben.
„Was hat die Mutter gesagt?“ fragte Tabea, als der Kopf des Mannes wieder ein Stück nach vorne ruckte. Sie spürte, wie sich ihre Finger fester um das Geländer klammerten, obwohl bei ihr kaum die Gefahr bestand, dass sie in der nächsten Sekunde nach unten stürzen würde.
„Sie hat gesagt, dass ich springen soll.“
Tabea war einen Moment sprachlos. War es möglich, dass die ihr unbekannte Frau mit einem einzigen Gespräch derartige Schuldgefühle bei dem Mann geweckt hatte, dass er jetzt, einige Jahre nach seiner Tat, aus dem Leben scheiden wollte? Was hatte er in der Zeit nach der Haft getan?
„Ich würde gerne mit Ihnen und der Frau sprechen“, sagte Tabea und merkte, wie sie selbst bei diesen Worten unsicher war. Immerhin, ein Gespräch war nur möglich, wenn der Mann wieder von der Brücke stieg und sein Vorhaben aufgab. Die Hand, die sich um das Geländer presste, begann zu schmerzen.
„Das würde nichts bringen – das Kind wird dadurch nicht wieder lebendig!“ Seine Stimme war lauter und klarer geworden. Aber er machte nach wie vor keine Anstalten zu springen. Hätte er sich tatsächlich umbringen wollen, würde er schon jetzt auf den Gleisen liegen, das hatte Tabea inzwischen verstanden. Die Tatsache, dass er hier stand, dass er ihren Namen gegenüber der Polizei genannt hatte, war ein Hilferuf, kein Suizid-Versuch.
„Ich könnte sie kontaktieren und zunächst alleine mit ihr reden. Sie warten in der Klinik auf das Ergebnis. Natürlich leidet die Frau, sie hat ihr Kind verloren. Aber ihr Tod wird für sie keine Befreiung sein.“
„Aber vielleicht lindert es ihren Schmerz.“
„Rache ist selten ein guter Helfer. Die Leere, die das Verschwinden des Kindes hinterlassen hat, füllt sie möglicherweise derzeit mit Rachegelüsten gegen Sie. Aber was wird sein, wenn Sie nicht mehr sind, weil Sie ihren, nennen wir es mal Rat, befolgt haben? Die Leere wird bleiben. Ihr Tod löst kein Problem für die Frau.“
Irgendwo im Hintergrund der Brücke heulte für einen Moment die Sirene eines Fahrzeugs auf. Irgendein Blödmann hatte einen falschen Knopf gedrückt.
Nimitz zuckte zusammen, aber sein Stand war fest genug, um nicht den Halt zu verlieren. Im Gegenteil schien das Geräusch einen Teil seines Gehirns zu aktivieren, der ihm klarzumachen schien, wo und in welcher Lage er sich befand.
„Wenn ich jetzt auf die Brücke komme, wird man mich verhaften.“
Tabea atmete tief durch, das Schlimmste schien überstanden. Nein, der Mann hatte nie die Absicht gehabt zu springen, die ganze Aktion war ein Hilferuf gewesen, wenn auch zu einer anstrengenden Uhrzeit.
„Nein, die Polizei wird Sie zurück in die Klinik bringen. Wir trinken einen Kaffee, den haben wir uns nämlich verdient. Dann legen Sie sich erst einmal hin und schlafen ein paar Stunden.“
Vor allem die Erwähnung eines Kaffees schien das Interesse des Mannes zu wecken. Irgendwo hatte Tabea gelesen, dass gerade solche Kleinigkeiten wie der Gedanke an einen Becher mit dampfendem Kaffee den Lebenswillen eines Menschen wieder wecken konnten. Sie wirkten mehr als große, pathetische Aussagen, die im Grunde niemand richtig greifen konnte.
„Aber nicht das Zeug aus dem Automaten“, sagte der Mann mit einer derart düsteren Stimme, dass Tabea trotz der angespannten Situation lachen musste.
„Ich habe echten türkischen Kaffee, den ich kochen kann“, sagte sie und machte einen Schritt auf den Mann zu. Ihre Beine waren in der Kälte schwer geworden, fühlten sich taub an. Es wurde Zeit, dass sie aus dem Wind und der Kälte kam. In ihrem Kopf hatte sich ein dumpfer Schmerz ausgebreitet, der die Konzentration erschwerte. Sie warf einen kurzen Blick über die Schulter nach hinten, sah einen Uniformierten. Sie vermutete, dass es der Beamte war, mit dem sie gesprochen hatte. Sie hob leicht die Hand zum Zeichen, dass er sich langsam und möglichst geräuschlos nähern sollte. Nimitz musste über das Geländer geholfen werden. Er war zwar nicht sonderlich kräftig, aber es war besser, wenn diesen Job ein Mann übernahm, der entsprechende Erfahrung hatte. Er machte auf Tabea den Eindruck, als könne man sich auf ihn verlassen.
„Kenne ich nicht“, sagte der Mann und drückte seinen Körper fester an das Geländer. Für Tabea war das ein sicheres Zeichen, dass er seinen Plan aufgegeben hatte. Die Gefahr, in der sich sein Leben befand, schien in sein Bewusstsein zu sickern.
„Warten Sie einen Moment, es kommt jemand, der Ihnen helfen wird“, sagte Tabea und machte einen weiteren Schritt auf ihn zu. Sie sah den Polizisten, der an ihre Seite trat.
In diesem Augenblick hörte sie ein durchdringendes Pfeifen unter sich. Gleichzeitig fing die Brücke an zu vibrieren.
„Ein Zug!“ Der Polizist neben ihr schrie die Worte heraus und sprang zu dem Mann jenseits des Geländers. Unter ihnen rauschte es, die Luft schien für einen Moment zu zittern. Tabea konnte die Vibration unter ihren Sohlen fühlen. Sie hätte nie damit gerechnet, dass ein Zug eine solche Wucht auf der Brücke auslösen konnte. Ihr Blick wanderte zu der zitternden Bogenlampe, kam dann wieder zurück.
Sie hatte ihren Blick nur für eine Sekunde zu dem Beamten abgewandt, aber als sie sah, dass der Polizist die Stelle erreichte, an der Nimitz gestanden hatte, erkannte sie, dass der Mann verschwunden war.
Kapitel 3
„Natürlich war es ein Unfall, du darfst dich nicht in die Sache hineinsteigern. Nimitz wollte von seinem Plan ablassen, vielleicht hat er schon losgelassen. Dann kam dieser dämliche Zug trotz Absperrung. Irgendwer hat das Haltesignal gelöst und aufgehoben, so dass er durchfuhr.“
Tabea hatte den Rest der Nacht schlaflos auf und unter der Brücke verbracht.
Christian Nimitz war auf den Zug gefallen, der Körper musste in einem schrecklichen Zustand sein. Natürlich war jede Hilfe zu spät gekommen. Die Mutter des Kindes hatte also, wenn auch über einen makabren Umweg, ihr Ziel erreicht und ihre Rache gefunden. Tabea bezweifelte, ob sie damit glücklich werden würde, aber diese Frage würde keine Antwort mehr finden.
„Ich hatte ihn soweit, dass er umkehren wollte“, sagte Tabea tonlos und starrte aus dem Fenster. Sie hatte sich in ihrer Wohnung kurz frisch gemacht und umgezogen, danach war sie in ihr Büro gegangen, um, möglichst frisch aus der Erinnerung, ihren Bericht zu schreiben. Vielleicht auch, um die Gedanken zu ordnen, indem sie sie zu Papier brachte. Sie hatte hinter dem Schreibtisch gesessen und nach einigen dürren Sätzen einfach aus dem Fenster gestarrt.
Normalerweise genoss sie den Blick, der über den Park führte, der hinter der Klinik lag. Heute jedoch blieb sie an den schweren Regentropfen hängen, die an der Scheibe herunterliefen.
Doktor Carlos Mendez betreute die medizinischen Angelegenheiten der psychiatrischen Klinik. Natürlich war er sofort in ihr Büro geeilt, nachdem er gehört hatte, was geschehen war.
„Es war allein seine Entscheidung, dort zu stehen. Wenn ich mich auf eine Kreuzung setze, muss ich auch damit rechnen, dass mich jemand über den Haufen fährt, auch wenn ich mich gerade entschlossen habe, dass der Platz dort nicht gerade ideal ist.“ Er verzog das Gesicht. „Du hättest mich anrufen sollen“, schob er hinterher.
„Um dir was zu sagen? Dass die Polizei dabei ist, die Reste meines Patienten von den Gleisen zu sammeln? Entschuldige, das war makaber und widerlich.“
Carlos schüttelte den Kopf. „Nein, es ist die Wahrheit“, sagte er schlicht. Er ließ eine Schwester ein, die ein Tablett mit Kaffee und Keksen auf den äußeren Rand des Schreibtisches stellte. Sie warf Tabea noch einen niedergeschlagenen Blick zu, dann verließ sie wortlos das Zimmer.
Carlos füllte zwei Becher und stellte einen davon direkt vor Tabea ab. Er legte ihr freundschaftlich die Hand auf die Schulter. Hier in der Klinik trug niemand vom Personal einen weißen Kittel, um keine künstliche Mauer zu den Patienten aufzubauen.
„Du solltest dir heute einfach freinehmen“, schlug er mit seiner ruhigen, dunklen Stimme vor.
„Um was zu tun?“ fragte Tabea härter zurück als beabsichtigt. Ihr Kollege meinte es ja nur gut mit ihr.
„Ich habe schon einige Male mit dir geschimpft, weil du dir keine Wohnung außerhalb dieser heiligen Mauern gesucht hast. Wie lange bist du schon hier? Drei Jahre? Zeit genug, um dir ein nettes Appartement zu suchen.“
„Vielleicht mit Familienanschluss?“ fragte Tabea ironisch über den Rand ihres Bechers hinweg.
„Das würde dir guttun!“
Das Thema war nicht neu, Tabea kam dieses Gespräch vor wie das Treffen mit einem alten Bekannten. Sie drehte sich zu dem Arzt, um die Erwartung an die Unterhaltung zu brechen.
„Aber Schatz, das könnte ich nie übers Herz bringen, du bist doch der Einzige für mich.“
Carlos Mendez war offen schwul und hatte vor zwei Jahren in einer riesigen Zeremonie seinen Lebensgefährten, einen Theater-Schauspieler, geheiratet. Mit seinem Aussehen und seiner Stimme hätte er leicht jede Frau erobern können. Er war groß, sportlich, mit dunklen, kurzen Haaren, einem modischen Kurz-Bart. Dazu kam der südamerikanische Einschlag, den er von seiner Mutter mitbekommen hatte.
„Hey, in dir schlummert ja doch noch ein Funken Humor“, stellte Carlos erfreut fest. „Wenn du willst, rufe ich zu Hause an und du kommst für ein paar Tage in unserem Gästezimmer unter. Du weißt, wie gerne wir kochen.“
Tabeas Blick wanderte wieder aus dem Fenster und blieb an den Regentropfen hängen. Die Idee klang wirklich verlockend. Bisher hatte sie in ihrer kleinen Wohnung im Trakt neben den Patienten-Zimmern nichts vermisst. Sie schätzte es, keinen Weg zur Arbeit zu haben und, falls nötig, sofort vor Ort sein zu können.
Bei ihrem Einzug war alles neu gewesen: die Arbeit, die Umgebung, die Stadt. Nach der Scheidung war sie an das andere Ende Deutschlands gezogen, weit weg von allem. Sie war geflohen, nicht im übertragenen, sondern im wörtlichen Sinne. Alle hatten zu Sam gehalten, sogar ihre eigenen Eltern. Damals hatte sich alles gedreht, buchstäblich von einen Tag auf den anderen. Sie hatte das Kind verloren, nein, genauer, sie hatte Sams Kind verloren. Wie hatte es dazu kommen können, dass ihr Ehemann eine Todgeburt als eine persönliche Beleidigung ansah? Sie hatte viele Semester Psychologie studiert, aber keine Antwort auf diese Frage bekommen, von niemandem.
Noch immer wachte sie manchmal nachts auf, weil der gleiche Traum sie hochgeschreckt hatte. Sie hatte damals in dem voll eingerichteten Kinderzimmer gesessen mit dem Wissen, dass es nicht mit Leben gefüllt werden würde. Und dann war aus dem Nichts ihre Mutter aufgetaucht und hatte sich vor ihr aufgebaut. „Warum hast du es getötet?“ hatte sie gefragt.
Und erst heute wusste sie, dass es kein Traum gewesen war, sondern eine reale Erinnerung, die sich verzerrt in ihren Schlaf geschlichen hatte. Eine Frau ohne Kind ist keine Frau – so oder so ähnlich hatte Sam es gesagt. All die Jahre zuvor war er der liebevolle Ehemann gewesen, aber jemand über ihnen hatte mit dem Finger geschnippt und alles von einer Stunde auf die andere gedreht, ganz so, als wenn man eine altmodische Uhr stellt.
Und dann war sie gerannt, das allerdings im übertragenen Sinne. Es hatte nur weniger Telefonate bedurft, eine neue Stelle zu finden, auch wenn sie etwas weniger verdiente. Dafür hatte ihr die Klinikleitung die Wohnung gestellt, sogar mit Möbeln und allem, was es brauchte, um leben zu können. Sie war mit drei Koffern eingezogen, die sie in den Mietwagen gestopft hatte. Und an diesem Besitz hatte sich in den letzten Jahren wenig geändert.
„Hey, hast du nicht gehört? Wir kochen gerne!“
Tabea zuckte hoch, als hätte sie einen Stromschlag erhalten. „Entschuldige, was hast du gesagt?“ fragte sie verwirrt.
„Du musst hier raus, das ist eine simple Frage der seelischen Hygiene. Ich kann Doktor Engel anrufen, er sollte sich mal mit dir unterhalten. Du hast gestern, auch wenn du daran unschuldig warst, einen Patienten verloren. Das steckt man nicht so einfach weg. Du bist kein Roboter, auch wenn du manchmal so tust.“
„Dafür, dass du dir angeblich Sorgen um mich machst, bist du ganz schön frech.“ Sie nahm einen Schluck von dem inzwischen kalt gewordenen Kaffee.
„Der Kaffee ist kalt“, stellte Carlos tadelnd fest.
„Ich weiß – und ich liebe ihn so!“
Carlos schüttelte den Kopf. „Wenn du dich stur stellst, werde ich eine Sitzung der Klinik-Leitung einberufen. Die warten sowieso schon auf deinen Bericht. Und wenn ich jetzt sehe, wie dein Blick zum Bildschirm wandert – nein, nicht mehr heute, bestimmt nicht. Ich verbiete es dir!“
Er versuchte, streng zu wirken, aber es gelang ihm nicht. Er war mehr als ein Kollege, er war ein Freund.
Von dieser Sorte Mensch hatte Tabea nicht mehr viele. In den letzten Jahren hatte sie sich allerdings auch nicht sonderlich um Menschen bemüht. Sie war, auch wenn sie es sich nur selten eingestand, einsam. Möglicherweise berührte sie daher das Schicksal des Mannes so sehr, der vor wenigen Stunden auf einem dahinrasenden Zug sein Leben verloren hatte.