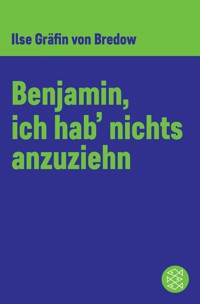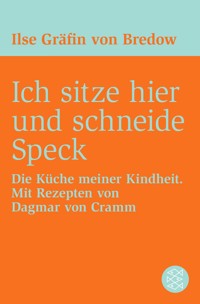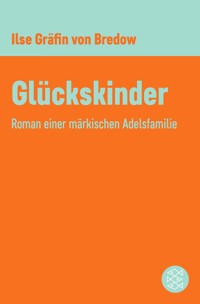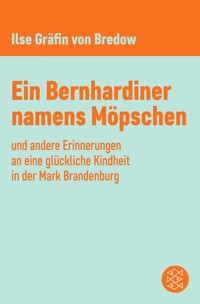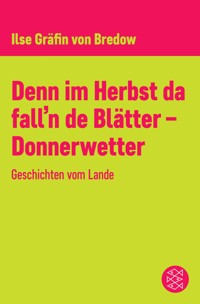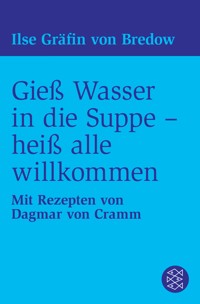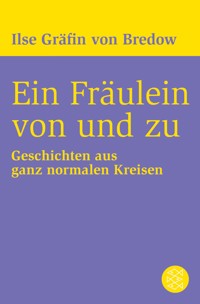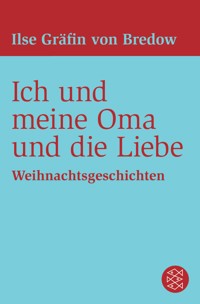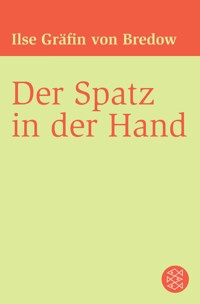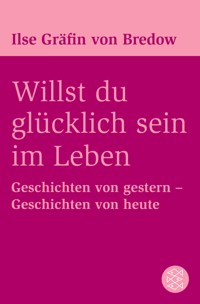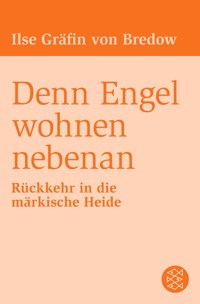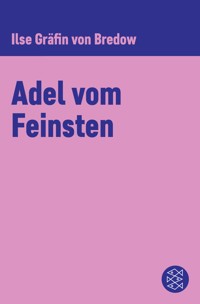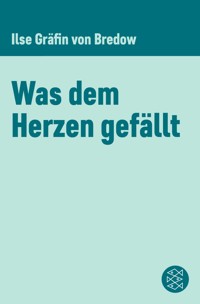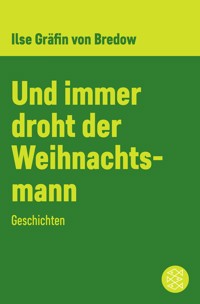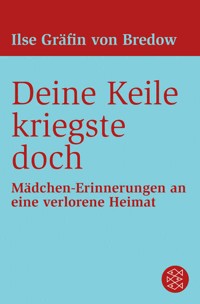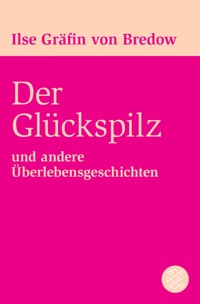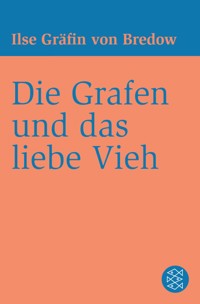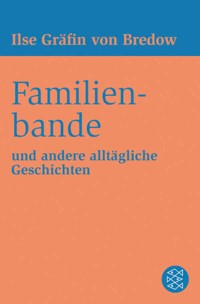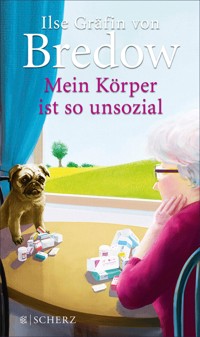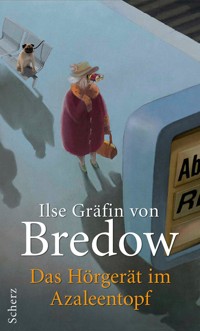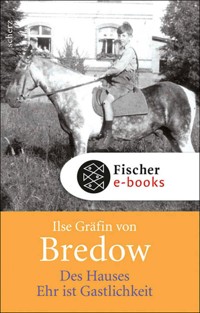
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bei Ilse Gräfin von Bredow ist man gern zu Besuch, denn für beste Unterhaltung ist gesorgt. Mit unnachahmlichem Humor erinnert sie sich an die Erlebnisse mit Gästen in ihrer Kindheit auf dem Land in der Mark Brandenburg. Denn dort, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagten, waren Besucher eine willkommene Abwechslung, die geradezu herbeigesehnt wurde. Doch ob Kinder aus der Stadt, die in die Sommerfrische geschickt wurden, oder erwachsene Verwandte und Bekannte, schließlich hat man sie auch immer gern wieder gehen sehen. Denn bekanntlich bleibt ein Gast wie Fisch nicht länger als drei Tage frisch. Aus ihrem großen Reservoir an komischen und spannenden Geschichten hat die Autorin für diesen Band die schönsten zum Thema Gastfreundschaft ausgewählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Ilse Gräfin von Bredow
Des Hauses Ehr ist Gastlichkeit
Über dieses Buch
Bei Ilse Gräfin von Bredow ist man gern zu Besuch, denn für beste Unterhaltung ist gesorgt. Mit unnachahmlichem Humor erinnert sie sich an die Erlebnisse mit Gästen in ihrer Kindheit auf dem Land in der Mark Brandenburg. Denn dort, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagten, waren Besucher eine willkommene Abwechslung, die geradezu herbeigesehnt wurde. Doch ob Kinder aus der Stadt, die in die Sommerfrische geschickt wurden, oder erwachsene Verwandte und Bekannte, schließlich hat man sie auch immer gern wieder gehen sehen. Denn bekanntlich bleibt ein Gast wie Fisch nicht länger als drei Tage frisch. Aus ihrem großen Reservoir an komischen und spannenden Geschichten hat die Autorin für diesen Band die schönsten zum Thema Gastfreundschaft ausgewählt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: HildenDesign, München
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2010
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400884-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorwort
1 Das Kusinchen
2 Das ewige Kind
3 Ein Sohn aus gutem Hause
4 Die gläserne Katze
5 Unsere heiligsten Kühe
6 Das gestörte Picknick
7 König Pimpernel
8 Die gute Tat
9 Der stolze Bussard
10 Die Kräutertante
11 Des Hauses Ehr
12 Die Bildungsreise
13 Löwe im Haus
14 Das Zauberwort
15 Der unvergessliche Hannibal
16 Mamilein
17 Die Treibjagd
18 Das Mercedeskind
19 Der Vogel Greif
Quellenverzeichnis
Vorwort
»Des Hauses Ehr ist Gastlichkeit«:
Dieser schöne Spruch kam in den Kriegsjahren gelegentlich zu kurz, etwa als Bombengeschädigte untergebracht werden mussten, der Bürgermeister erfolglos pathetisch von »Stadt und Land – Hand in Hand« redete und der Pastor vergeblich die Nächstenliebe beschwor. Statt vor Hilfsbereitschaft zu strahlen, zogen sich die Mundwinkel der Gemeindemitglieder nach unten, und man tat seine Pflicht nur mürrisch. Umso leuchtender die Ausnahme, wie jener Richter in Eutin. Er hieß, anders als seine Nachbarn, die ängstlich ihre Häuser verrammelt hatten, mit weit offener Tür jeden in seinem Haus willkommen, der wie wir durch die Straßen irrte auf der Suche nach einem schützenden Plätzchen. Er versorgte uns freigiebig mit Essen, half den Soldaten mit Zivilkleidung aus und räumte für uns sogar sein Schlafzimmer. Die Dankbarkeit der Gäste war groß, denn ein Pimpf war, bevor er die Hosen endgültig voll hatte, am Ortseingang noch auf die Idee gekommen, seine Panzerfaust auf die heranrückenden Engländer abzufeuern, und die hatten zurückgeschossen.
In früheren Zeiten waren Gäste immer gern gesehen, besonders wenn man »beim Deibel auf der Rinne« wohnte. Man sehnte Besucher geradezu herbei, wie etwa die reichlich vorhandene Töchterschar eines Schlossbesitzers, die – wie man sich erzählte – täglich voller Sehnsucht nach etwas Interessantem Ausschau hielt. Als dann tatsächlich drei Reiter auf das Schloss zugaloppierten, sollen sie mit dem jauchzenden Ruf »Männer! Männer!« zu ihren Eltern gelaufen sein.
Auch wir lebten dort, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagten, und so gehörten Besuche zur willkommenen Abwechslung – vor allem im Sommer, wenn die Verwandtschaft aus der Stadt ihre Brut »auf die Weide« schickte. Zwar waren wir Kinder über diese Art Besuch nicht immer so glücklich, wie uns die Eltern einreden wollten. Aber wenn dann die Hackordnung feststand, hatten wir doch viel Spaß miteinander, der einerseits häufig in lautstarkem Gezänk endete, uns aber andererseits mit dem im Chor vorgebrachten Ausruf: »Wir haben doch gar nichts getan!« wieder sehr schnell zusammenschmiedete. Wenn die zornentbrannten Mütter auftauchten und sich unseretwegen in die Haare kriegten, gab es für uns nur noch den »Herrn Niemand«. »Niemand« hatte dem Kusinchen ins Ohr geflüstert, dem süßen kleinen Kälbchen auf der Koppel einen Besuch abzustatten, das sie dann mit einem kräftigen Stoß in den Graben beförderte, weil das süße Kälbchen ein zorniges Bullkalb war. »Niemand« hatte Vetter Rolf den Rat gegeben, sein Taschenmesser auf dem Schleifstein zu schärfen, denn das wusste doch jeder, die aus der Stadt konnten mit so was wie einem Schleifstein gar nicht umgehen, und nun war die Fingerkuppe weg. »Niemand« hatte die Leiter, mit deren Hilfe Vetter Konrad auf den Heuboden geklettert war, weggestoßen, so dass er nun Stunden eingesperrt war. Diese Leiter war nun mal sehr kipplig und fiel schnell um.
Manchmal kamen die Dorffreunde zufällig bei diesen Auseinandersetzungen mit unseren Müttern dazu. Sie hielten sich nicht lange mit »Herrn Niemand« auf, sondern hatten stärkeren Tobak parat und spielten gern die Zeugen: »Genauso war es, die Erde soll mich verschlingen, wenn ich nicht die Wahrheit sage.« Möpschen das Unheil anzuhängen, ließ man lieber. Der hatte nun mal Mamsell als Schutzpatron.
Während wir Kinder uns längst versöhnt hatten und fröhlich sangen: »Es geht ein Bi-Ba-Butzemann in unserem Kreis herum«, herrschte zwischen den Müttern noch Eiszeit.
Dafür bekamen wir Landkinder unser Fett, wenn wir Onkel und Tante in der Stadt besuchten. Unsere Cousinen und Vettern lachten hämisch, wenn wir auf der Rolltreppe stolperten oder, erschreckt von einer Autohupe, einen Luftsprung machten. Sie sahen uns belustigt zu, wie wir die leicht bekleideten Damen auf den Litfasssäulen bestaunten, und ihre Freunde nannten uns »Landeier«. Auch ihre Eltern, die mit uns den Zoo besuchten, nahmen unser für sie reichlich merkwürdiges Interesse an allem, was wir von zu Hause kannten, wie Spatzen, Tauben und Rehe, mit leichter Herablassung zur Kenntnis. »Die lieben Kleinen der Cousine sind doch noch etwas zurück, Landkinder eben.«
Besucher waren immer für eine Überraschung gut. Manche wollten nur »auf einen Sprung vorbeikommen« und blieben vier Wochen. Andere wieder kürzten nach einem politischen Streitgespräch den Aufenthalt ab und verabschiedeten sich bereits nach zwei Tagen mit der dunklen Andeutung: »Denkt an meine Worte«, oder »Ihr werdet schon sehn, was ihr davon habt.« Auch gab es Gäste, deren Ankündigung allgemeines Entsetzen auslöste: »Nicht die schon wieder!«
Aber egal, ob es um Gast oder Gastgeber, Erwachsene oder Kinder ging, das Reservoir an komischen oder spannenden Geschichten, mit denen wir uns unter viel Gelächter die langen Winterabende vertrieben, wurde im Sommer gut aufgefüllt. Viele von ihnen sind bei uns Alten bis heute in Erinnerung geblieben, und so manches davon ist in diesem Sammelbändchen zu finden.
In der Nachkriegszeit dann nahmen Gäste Unbequemlichkeiten gern in Kauf. Man hatte schließlich zwölf Stunden auf einem Fuß stehend in der Bahn verbracht. Da war einem selbst das zu kurze, zu schmale, durchgelegene Sofa willkommen. Die Gastgeber rückten noch enger zusammen, und selbst ein verstopftes Klo konnte niemanden aus der Ruhe bringen.
Mit wachsendem Wohlstand veränderten sich die Ansprüche an die Gastfreundschaft. Selbstverständlichkeiten, wie Badezimmer mit fließend Warmwasser, erwiesen sich plötzlich als nicht ausreichend, ein Gästeklo musste her. Das Sofa im Wohnzimmer kam aus der Mode. Und überhaupt, in dieser nahegelegenen preiswerten Pension hatte es doch der Gast viel gemütlicher! Dummerweise wurde diese Meinung von der Nachkriegsgeneration nicht geteilt. Manches Elternpaar starrte fassungslos auf das Chaos, das der Nachwuchs während ihrer Abwesenheit in ihrem schmucken, neu erworbenen Häuschen angerichtet hatte. Die Zimmer waren eine Stätte der freien Liebe geworden, und überall stolperte man über Halbnackte. Inzwischen ist nun auch diese Generation fast im Rentenalter und weiß ein gesittetes, bürgerliches Leben sehr zu schätzen.
Und wie sieht es heute mit der Gastfreundschaft aus? Durch Schüleraustausch, Auslandspraktikum und -studium oder Berufsreisen in alle Welt ist sie international geworden. So ist es ganz selbstverständlich, dass der geliebte Sohn nach einem längeren Auslandsaufenthalt als Gast eine junge Chinesin mitbringt – »ein entzückendes Geschöpf, wirklich, hübsch, höflich und bescheiden«. Trotzdem ist die moderne, allem Neuen aufgeschlossene Mutter plötzlich nicht mehr so für das Globale und denkt: »Reizendes Kind, aber bitte nicht meine zukünftige Schwiegertochter.«
So hat sich im Laufe der Zeit unsere Auffassung von Gastlichkeit hie und da verändert, aber was Wilhelm Busch dazu sagt, gilt nach wie vor:
»Es ist halt schön,
wenn wir die Freunde kommen sehn.
Schön ist es ferner, wenn sie bleiben
und sich mit uns die Zeit vertreiben.
Doch wenn sie schließlich wieder gehn,
ist’s auch recht schön.«
1Das Kusinchen
Vaters Gefühle gegenüber seinem Schwager waren zwiespältig. »Der gute Karl weiß nicht nur alles, er weiß auch alles besser«, schimpfte er gern. Die beiden kabbelten sich oft, was Onkel Karl jedoch nicht hinderte, allein oder mit der Familie häufig mal eben von seinem zwei D-Zugstunden entfernten Gut »auf einen Sprung« zu uns zu kommen.
Uns Kindern war Onkel Karl ziemlich gleichgültig. Wir liebten Tante Sofie, und wir hassten unsere gleichaltrige Kusine Elisabeth.
Klein-Didi, wie sie von ihrem Vater zärtlich genannt wurde, war ein rechtes Goldkind. Sie hatte seidiges, blondes Haar, und ihre Haut verdunkelte sich in der Sommersonne nicht wie bei uns zu einem schmutzigen Braun, sondern behielt bis in den Winter hinein einen warmen Honigton. Teure Ballettstunden hatten dafür gesorgt, dass ihre Bewegungen anmutig und geschmeidig waren. Sie liebte es, sich wohlgefällig im Spiegel zu betrachten, sich vor ihm hin und her zu wenden und ihr Körperchen wie Knete zu streicheln und zu betasten.
Wir waren froh, wenn wir von den Erwachsenen in Ruhe gelassen wurden. Sie aber trieb sich mit Vorliebe bei ihnen herum und war ganz Ohr, wenn uralte Familiendramen neu aufgebacken wurden. Vater mochte es nicht, wenn man ihm zu nahe auf den Pelz rückte. Er machte deshalb jedesmal unwillkürlich eine scheuchende Bewegung, als wollte er eine lästige Katze verjagen, wenn sie sich zwischen ihn und ihren Vater auf das Sofa quetschte. Onkel Karl war dagegen ganz vernarrt in seine Tochter. »Na, mein Mäuschen«, schnurrte er, und Didi warf ihr langes, offenes Goldhaar zurück, so dass es Vater unangenehm in der Nase kitzelte, und piepste: »Ach, Papilein.«
Für uns war sie eine scheinheilige, verlogene, boshafte Hexe, raffiniert genug, uns Geschwister im Handumdrehen gegeneinander aufzuhetzen, so dass wir den verdutzten Eltern unerwartet den Anblick dreier sich streitender, prügelnder kleiner Idioten boten, während Didi selbst, ein Bild süßer Harmonie, still in einer Ecke saß und, vor sich hinsummend, eifrig malte. Meinen sonst schon recht vernünftigen Bruder Billi verhexte sie beim Angeln derart, dass er wie ein Irrer lachte, anstatt ihr eine zu kleben, als sie die gefangenen Plötzen und Barsche wieder zurück in den See warf. Ja, er entblödete sich nicht, ihr dabei noch zu helfen, während Bruno, der Krepel, vor Wut über so viel Schwachsinn fast einen seiner epileptischen Anfälle bekam.
Vor Didis Habgier war nichts sicher. Sie klaute mir meine gläserne Lieblingsmarmel, in die ein weißes Lamm eingeschlossen war, und köpfte unsere schönsten Papierpuppen, ohne dass wir ihr etwas nachweisen konnten. Ihr letzter Besuch bei uns im Forsthaus war besonders unerfreulich gewesen. Die schlimmste Gemeinheit hatte sie sich noch kurz vor ihrer Abreise geleistet. Vater war mit Tante Sofie ins Kinderzimmer gekommen, als sie sofort losquengelte: »Mami, Omamis Spieluhr.«
»Ja, ja, das Leben ist voller Erinnerungen«, sagte Tante Sofie, die herzensgute, ohne zu begreifen, worauf ihre Tochter eigentlich hinauswollte.
»Aber sie gehört mir«, rief das Goldkind. »Kannst Paps fragen.«
»Das ist mir neu«, sagte Tante Sofie.
»Vera hat sie von ihrer Großmutter bekommen. Ich war selbst dabei, als Mutter sie ihr geschenkt hat«, sagte Vater.
»Aber natürlich, Alfred«, beschwichtigte ihn Tante Sofie. »Die Sache ist doch nicht der Rede wert.«
Aber für Didi war sie es durchaus. Sie steckte sich hinter ihren Vater, und Onkel Karl hatte eine kleine Aussprache mit Tante Sofie, die daraufhin mit unglücklichem Gesicht zu Vater ging. Er kämmte mir gerade das Haar, was er gern tat, und sah sie erstaunt an. »Was hast du denn?« fragte er.
Tante Sofie tat einen tiefen Seufzer. »Karl lässt mir mal wieder keine Ruhe. Er behauptet fest, unserer Elisabeth gehöre die Spieldose, so stünde es auch im Testament. Er sagt, sie habe einen beträchtlichen Wert. Du kennst ihn ja.«
»Bin ich vielleicht ein Erbschleicher?« Vater ließ seine Gekränktheit an meinen Haaren aus, und ich schrie. »Meinetwegen kann eure Elisabeth dieses verdammte Ding haben. Ich werde es Vera erklären. Sie ist eine sehr vernünftige Person.«
Vera jedoch dachte nicht daran, eine vernünftige Person zu sein. Sie weinte und wütete, bis Vater ratlos schnauzte: »Schluss jetzt, benimm dich! Reiß dich zusammen, stell dich nicht an!«
Triumphierend zog unsere Kusine mit der Spieldose ab, und Abend für Abend mussten wir in unseren Betten mit anhören, wie aus ihrem Zimmer das Lied ertönte: »Mein Hut, der hat drei Ecken.«
Vera strampelte vor Wut und sagte: »Eines Tages bring ich sie um. Ich erwürge sie mit meinen eigenen Händen.« Eine Redensart, die sie irgendwo aufgeschnappt hatte.
»Leere Drohungen«, sagte ich.
»Wirst schon sehn«, versicherte Vera.
Und jetzt stand uns Didi schon wieder ins Haus.
»Können die nicht mal in den Ferien woanders hinfahren«, brummte Billi. Vorsorglich versteckten wir, woran unser Herz hing: einen Bismarckkopf, auf dem man Gras säen konnte, eine aufziehbare Maus, den Karton mit den Papierpuppen und unsere Schuhspangen vom Lumpenmann.
Wie gewöhnlich reiste die Familie mit dem Abendzug an. Als Mamsell den Spargelpudding aus dem Wasserbad nahm, hielt der Wagen vor dem Haus. Zuerst pellte sich Onkel Karl zappelig wie gewöhnlich aus den Decken und sprang aus dem Wagen. »Schlechte Zeiten, Alfred, schlechte Zeiten.« Er küsste Mutter die Hand. Ihm folgte, füllig und schweigsam, Tante Sofie. Sie bedachte jeden von uns mit einem freundlichen, aber abwesenden Lächeln. In der Familie galt sie als etwas eigentümlich, weil sie oft in Gedanken versunken vor sich hinstarrte. In Wahrheit war sie wohl nur ein wenig träge und litt mit stoischer Ruhe unter ihrem ungeduldigen und rechthaberischen Mann. Hinter ihr hüpfte unsere Feindin vom Trittbrett. Den Schluss bildete Wilhelma, ein gutartiges, unterdrücktes, ziemlich hässliches Wesen, das von seiner älteren Schwester unter dem Deckmantel größter Fürsorge schikaniert wurde.
»Gib mir meine Brille wieder«, hörten wir Wilhelma klagen. Sie stolperte und schlug sich das Knie auf.
Didi drehte sich nach ihr um. »Pass doch auf, Dummchen.«
»Immer nimmst du sie mir weg«, weinte die Kleine.
»Nur, damit du sie nicht verlierst.« Didi wischte ihr mit dem Taschentuch so kräftig über die Schramme, dass Wilhelma aufschrie und nach ihr schlug.
»Aber, aber!« Onkel Karl drehte sich nach seiner kleinen Tochter um. »Wie kann man sich nur so anstellen. Heb lieber deine Füße.«
»Ich seh aber nichts«, schrie Wilhelma.
»Du musst nicht immer das letzte Wort haben«, verwies sie der Onkel. »Kinder in deinem Alter sollten überhaupt nicht so viel reden.«
Wir Geschwister sahen uns an. Die Kleine konnte einem leid tun.
Unsere Kusine war kaum eine Stunde im Haus, und schon hatte sie es mühelos fertiggebracht, uns bis ins Mark zu kränken. Sie hatte fünf Vornamen – wir hatten nur drei. Sie besaß eine echte Vollblutstute – Vera nur ein Hinkebein als Pferd. Ich würde dieselbe dicke Nase wie Onkel Adalbert, der Puffbiber, bekommen, und für Billi sei es höchste Zeit, unser Kuhdorf zu verlassen, sonst werde sich sein Brett vorm Kopf zu einem Scheunentor auswachsen.
Vater las mir die Leviten, weil sich am nächsten Morgen auf meinem Frühstücksteller unverschämt viel Pelle der guten Schlackwurst angesammelt hatte, und blamierte mich mit der Bemerkung »du Raffzahn« vor dem Besuch. Dabei war es Didi gewesen, die ihre Pelle dazugelegt hatte. Ich rächte mich, indem ich eine Küchenschabe zerhackte, sie in ein Stück Nusstorte drückte und schadenfroh zusah, wie Didi es sich schmecken ließ. Als sie hörte, was sie da eben gegessen hatte, begann sie fürchterlich zu würgen, und ich jubelte: »Elisabeth, wie ist dein Bett, krumm oder gerade!«
Sie verpetzte mich nicht. Sie hatte ihre eigenen Methoden.
Vater veranstaltete zur Unterhaltung der Gäste ein Preisangeln, und Didi, die herumtönte: »Die Preise hat mein Paps ganz allein gestiftet«, ließ es sich nicht nehmen, mir, der Siegerin, den ersten Preis, ein großes Schraubglas voll Himbeerbonbons, zu überreichen. Dabei täuschte sie vor zu stolpern und ließ das Glas geschickt in ein Modderloch am Ufer fallen, wo es sogleich mit einem schmatzenden Geräusch auf Nimmerwiedersehn verschwand.
Scheinheilig jammerte sie: »Was bin ich bloß für ein Tollpatsch!« – und schnitt mir eine höhnische Grimasse. Vater fiel prompt auf ihr Theater herein. »Das hätte mir ebensogut passieren können, mein Kind. Mach dir nichts draus«, tröstete er sie. Ich musste mich mit einer schäbigen Rolle Drops abfinden.
Wenn Didi nun wenigstens eine Heulsuse, ein Feigling gewesen wäre. Aber den Gefallen tat sie uns nicht. Sie sprang vom höchsten Balken ins Heu, radelte den steilsten Berg freihändig hinunter und näherte sich dem wütend mit den Hufen scharrenden Bullen auf der Weide bis auf wenige Schritte, obwohl er sich schon zweimal von der Kette gerissen hatte. Widerwillig bewunderten wir sie, wenn sie sich bei unseren Streifzügen in einer Koppel auf ein fremdes Pferd schwang und ohne Zügel und Sattel mit wehendem Haar das erschrockene Tier zu immer schnellerem Galopp zwang. Als Billi hämisch sang: »Ach, wenn die Elisabeth nicht so krumme Beine hätt«, setzte sie ihm ihre Elfenhand mitten ins Gesicht, dass ihm die Funken vor den Augen tanzten.
Der Einzige, vor dem sie sich in Acht nahm, war Bruno. Seine Wutanfälle nötigten auch ihr Respekt ab. Einmal hatte sie, um ihn zu ärgern, einen Klumpen Dreck nach seinem Kater Mauzer geworfen und ihn zielsicher getroffen. Der Kater war vor Schreck auf einen Wäschepfahl geflohen. Daraufhin hatte Bruno sie an den Haaren gepackt, hatte sie zu dem Schleifstein gezerrt, ihm einen ordentlichen Schwung gegeben und versucht, ihre Hand auf den rotierenden Stein zu drücken. Tatsächlich wäre es ihm fast gelungen, ihre Finger wie die Schneide eines Beils abzuschleifen, wäre nicht im letzten Augenblick Wilhelm Wenzel, der Stallknecht, auf der Bildfläche erschienen. Der Schreck stand Didi ins Gesicht geschrieben, aber sie weinte nicht. Im Bösen wie im Guten war sie fixer als wir, und als Veras Haar plötzlich in Flammen stand, weil sie zu nahe an eine brennende Kerze gekommen war, ergriff sie blitzschnell eine Decke und erstickte das Feuer damit.
Von unseren ständigen Streitereien bekamen die Erwachsenen nur am Rande etwas mit. Sie ahnten nichts von der wahren Natur dieses holden Engels, obwohl Didi es mühelos fertig brachte, auch zwischen ihnen Unfrieden zu stiften.
An einem wunderschönen Sommertag, der die Luft über den Wiesen flirren ließ, saßen wir im abgedunkelten Esszimmer und spielten das Kartenspiel »Tod und Leben«. Vater räusperte sich missbilligend, als er uns entdeckte. »Was soll denn das schon wieder?« Er jagte uns an die frische Luft, Wir mussten mit den Gästen zum Baden gehen. Bepackt mit Badesachen zogen wir über die Wiesen. Es waren mindestens 28 Grad im Schatten, aber Wilhelma zockelte, große Schweißperlen auf dem feuerroten Gesicht, in einer dicken Strickjacke hinter uns her.
»Zieh sie aus«, bot sich Vera mitleidig an, »ich trag sie dir.«
Sogleich war Didi zur Stelle. »Kommt nicht in Frage«, rief sie. »Wilhelma hat gerade erst Windpocken gehabt, sie darf keinen Zug bekommen.«
Wie auf Kommando fielen wir über sie her. Mein Bruder nahm sie in den Schwitzkasten, Vera schoss mit der Gummizwille nach ihr, und ich riss sie von hinten an den Haaren.
»Recht zänkisch, deine Kinder.« Onkel Karl zerschmolz vor Mitgefühl mit seinem Liebling.
»Das ist gar nicht ihre Art«, nahm uns Mutter in Schutz.
»Ach, hätten wir sie lieber zu Hause gelassen.« Tante Sofie schlug nach einer hartnäckigen Bremse.
»Wir können uns doch unmöglich den wundervollen Schmetterlingsstil eurer Tochter entgehen lassen, von dem Karl so viel erzählt«, sagte Vater bissig.
Während die Sonne auf uns herunterknallte und Dutzende von Grashüpfern bei jedem unserer Schritte zur Seite sprangen, wurde die Stimmung von Minute zu Minute gereizter.
»Ziemlich sauer, deine Wiesen«, meinte Onkel Karl. »Fressen die Kühe das Gras überhaupt?« Und Vater sagte: »Sollst ja so viel Pech in letzter Zeit mit deinem Inspektor gehabt haben. Hab mich gleich gewundert, dass du den Kerl eingestellt hast.«
Als wir die Badestelle erreichten, hatten es sich die Kühe dort gemütlich gemacht. Sie standen bis zum Bauch im Wasser, und was so drum herum schwamm, zeigte, dass ihre Verdauung durchaus in Ordnung war.
Tante Sofie seufzte: »Ach du liebe Güte!« Und auch uns war die Lust auf ein Bad vergangen. Von Mücken umschwirrt, standen wir mürrisch herum und konnten uns zu nichts entschließen.
Vater schnauzte uns an, weil der Schlüssel zum Bootshaus nicht in seinem gewohnten Versteck lag, einem verlassenen Schwalbennest unter dem niedrigen Dach. Vera stieß mich an. »Daran ist nur die blöde Didi schuld«, flüsterte sie mir zu. Schließlich machten wir uns wieder auf den Heimweg.
Die nächsten Tage verliefen erstaunlich friedlich. Es hätte uns warnen müssen, dass unsere Kusine sich jetzt so gut mit Vater verstand. Sie war dauernd um ihn herum, half ihm beim Einschlagen junger Baumpflanzen im Garten und wickelte unter seiner Anleitung mit großer Sorgfalt meterweise Angelschnur für Aalpuppen um Binsenbündel. Als sie sich genügend an ihn rangeschmissen hatte, ließ sie die Katze aus dem Sack.
»Onkel Alfred«, flötete sie, während sie ihm half, die Klematis an der Veranda hochzubinden.
»Ja, mein Kind?« Vater war prächtiger Laune.
»Du hast gesagt, ich darf mir was wünschen, weil ich dir so viel geholfen habe.«
»Wenn ich’s bezahlen kann.« Vater summte: »Seht, dort schwebt die schöne Kunigunde, eben von des Henkers Hand erbleicht.«
»Ich hätt so gern ein Tier.«
»Vera wird dir sicher gern eines von ihren jungen Meerschweinchen geben.«
»Hab sie schon Bruno versprochen«, sagte Vera ablehnend, die mit mir auf der Veranda saß und Mühle spielte.
»Kein Meerschweinchen.« Didi senkte die Stimme, damit wir sie nicht verstehen sollten. Wir sprangen so hastig auf, dass die Steine durcheinander flogen, und beugten uns über die Brüstung. »Ich möcht so gern Küki.«
»Meinst du das dumme Huhn in der Küche? Das kannst du haben.«
»Vater«, riefen wir empört, »Küki gehört uns!«
»Euch gehört überhaupt nichts«, sagte Vater.
Küki war nicht irgendein beliebiges Huhn. Seine Mutter hatte es noch im Spätherbst nach beharrlichem wochenlangen Brüten einem Nestei entlockt, das wir schon für halb verfault gehalten hatten. Die Glucke war mit ihrem Küken plötzlich auf dem Hof erschienen, als bereits der erste Schnee vom Himmel stäubte. So war uns nichts anderes übrig geblieben, als es in einem Schuhkarton in der Küche großzuziehen. Küki entwickelte sich zu einem hysterisch gackernden, aber hochintelligenten Huhn. Sogar hypnotisieren konnte man es. Man brauchte nur einen Kreidestrich auf dem Küchenfußboden zu ziehen und seinen Kopf darauf zu drücken. Dann blieb es unbeweglich liegen, die Augen starr auf den Strich gerichtet. Später genügte es bereits, ihm einen Finger unter den Schnabel zu halten, um es in Trance zu versetzen. Und auf dieses Wundertier hatte Didi es abgesehen.
Mit Vater war nicht zu reden, so steckten wir uns hinter Mamsell. Aber die hatte gerade ihren mürrischen Tag und sagte: »Mir ist’s nur recht, dann kommt dieses dumme Tier endlich aus meiner Küche. Macht sowieso ’n Haufen Dreck, und tu ich’s in den Hühnerstall zu den andern, wird es totgehackt.«
Und dann verließ uns Tante Sofie mit Wilhelma Hals über Kopf, weil die Kleine mit einem vereiterten Backenzahn zum Zahnarzt musste. Einen Tag darauf gab der Nachbar Onkel Karl endlich einen kapitalen Bock zum Abschuss frei, worauf er schon die ganze Zeit bei uns gejippert hatte, und lud ihn zu sich ein. So sollte uns nur Didi erhalten bleiben. Das wollte sie natürlich auf keinen Fall. Sie ließ ihre raffiniertesten Hexenkünste spielen, damit sich Onkel Karl von ihr einwickeln ließ und sie auf das nur einige Kilometer entfernte Gut mitnahm. Sie küsste ihn und weinte, nicht eine Sekunde werde sie sich von ihrem geliebten Paps trennen.
Aber Onkel Karl hatte nur seinen Bock im Sinn und meinte ziemlich roh: »Dich, liebes Kind, habe ich ja Gott sei Dank noch ein ganzes Leben, aber den Bock, den schießt mir bestimmt ein andrer vor der Nase weg, wenn ich mich nicht beeile. Du bleibst hier und basta.«
Die verlassene und verlorene Didi zeigte sich denn auch gleich von ihrer Schokoladenseite und aß, ohne zu mucksen, einen großen Teller voll Kartoffeln mit Stippe, eine Mahlzeit, die sie sonst verächtlich als etwas für »pauvre Leute« bezeichnet hatte. Vater musterte uns mit seinem Habichtblick und drohte: »Wenn mir das Geringste zu Ohren kommt, könnt ihr was erleben.« Und das wollten wir nicht. Da gingen wir lieber friedlich ins Bett, anstatt Didi vorher noch einmal genüsslich an den Haaren zu ziehen oder das Stecknadelspiel mit ihr zu spielen, nämlich ihr mit den Borsten der Haarbürste kräftig so lange auf den bloßen Oberarm zu schlagen, bis sich rote Punkte zeigten.
Kaum waren wir jedoch eingeschlafen, wurden wir schon wieder von lauten Stimmen wach. Ich hörte Mutter im Hause herumrennen, mit den Türen klappen und rufen: »Alfred, das Kind ist weg! Sie scheint auch das Huhn mitgenommen zu haben. Sicher will sie zu ihrem Vater. Wie unangenehm!« Darauf hörte man Vater voller Selbstmitleid klagend gähnen. »Weit kann dieses verfluchte Gör ja nicht sein«, beruhigte er Mutter. »Ich mach mich gleich auf den Weg.«
Wir zogen uns an wie der Blitz und hatten das Haus verlassen, ehe man uns bemerkte. Wir holten unsere Fahrräder aus dem Schuppen und radelten die Dorfstraße entlang an Brunos Haus vorbei. Der kam gerade, nur mit einer Unterhose bekleidet, vom Klo hinter dem Misthaufen und fragte: »Seid ihr vom Affen gebissen? Oder was macht ihr sonst hier mitten in der Nacht?«
Wir sagten es ihm, und Bruno flüsterte mit glitzernden Augen: »Momang, da muss ich mit.«
Bruno setzte sich an die Spitze, und wir traten in die Pedale, dass die Fahrradketten quietschten. Die Grillen zirpten wie verrückt, und eine Himmelziege zog über unseren Köpfen meckernd ihre Kreise, als wir das Koppeltor öffneten. Wir radelten an den glotzenden Kühen und den grasenden Pferden vorbei, und die laue Nachtluft strich uns um die nackten Beine. Auf der Heubrücke machten wir Halt und lauschten. Weit dehnte sich das Luch vor uns, durchschnitten von dem havelländischen Hauptkanal, und es war voller merkwürdiger und unheimlicher Geräusche. Dann hörten wir ein Huhn gackern und sahen im Mondlicht eine kleine Gestalt den Trampelpfad am Ufer entlanghüpfen. Wir warfen die Räder auf die Bohlen, dass die Klingeln schepperten.
Und dann jagten wir sie …
2Das ewige Kind
Während Vater mehr ein Auge darauf hatte, dass uns nicht einfiel, die Lilien auf dem Felde zu spielen und müßig im Dorf herumzustreunen, anstatt Nützliches zu tun, wie Kartoffeln zu klauben, Laub zu harken, Reusen zu flicken und endlich einmal wieder unsere Karnickelställe auszumisten – »Die armen Tiere können ja nur noch auf dem Bauch liegen, sonst stoßen sie gegen die Decke!« –, legte Mutter großen Wert darauf, dass wir wussten, »woher wir kamen«.
»Hundertmal habe ich nun schon erklärt, wie ihr mit Onkel Adalbert verwandt seid«, seufzte sie, als wir verständnislos fragten: »Was is’n das schon wieder für’n Onkel?«
»Könnt ihr euch denn nichts merken?«
Nur unser Freund Bruno war auf Draht. Er wusste sogar Onkels Spitznamen. »Adalbert, der Puffbiber«, warf er stolz dazwischen. Mutter runzelte die Stirn: »Schon gut, Bruno, kann man nicht einmal unter sich sein.« Dann warf sie uns mangelnden Familiensinn vor und prophezeite, dass wir es schon noch bereuen würden. »Freundschaft hält einen Tag, Verwandtschaft aber ewiglich.«
»Leider«, bemerkte Vater.
»Erlaube mal«, sagte Mutter.
»Ich brauch nur an deine arme Schwester Lilli zu denken«, fuhr Vater fort, »die hätt’s auch besser ohne ihre Sippe.«
»Bezeichnest du mich als Sippe?« Mutters Stimme stieg. »Und das, wo ich mir so viel Gedanken um sie mache!«
»Drum«, sagte Vater.
Lilli-Gespräche gehörten zum Alltag. Wenn Mutter von diesem Thema gar nicht mehr wegzukriegen war, verzog sich Vater ins Arbeitszimmer.
Nach Mutters Schilderungen musste Lilli in ihrer Kindheit eine interessante Mischung aus Unglücksrabe und verzogenem Fratz gewesen sein.
Als Baby war sie von der Wickelkommode gefallen. Als Fünfjährige erlitt sie einen Anfall von Gelenkrheumatismus, weil sie zu lange in einem Kahn voller Wasser gespielt hatte. Mit acht war sie die Kellertreppe heruntergestürzt und mit gebrochenem Knöchel liegen geblieben. Ein Jahr später jagte man ihr bei einer Treibjagd eine Ladung Schrot ins Bein. Und außerdem war Klein-Lilli hin und wieder Opfer eines »Zustandes«.
Dieses von Mutter so bedeutungsvoll ausgesprochene Wort weckte unsere Phantasie. »War sie dann wie Bruno?« fragten wir. »Kriegte sie Schaum vorm Mund und so?« – »Unsinn«, sagte Mutter. Auf jeden Fall hatten Lillis Zustände die Familie gehörig erschreckt. Sie musste ins Bett, und niemand durfte zu ihr.