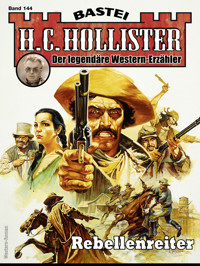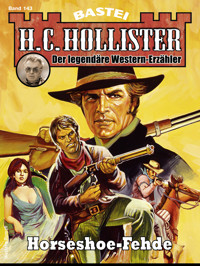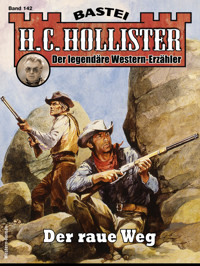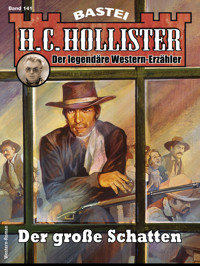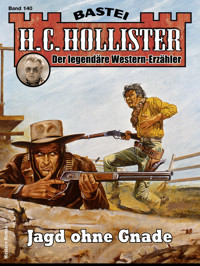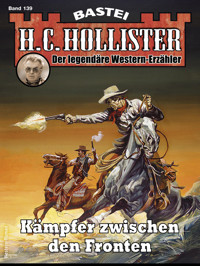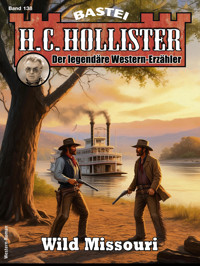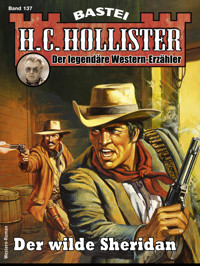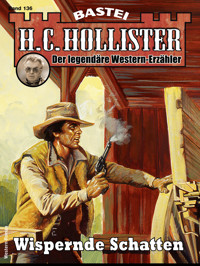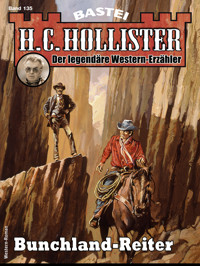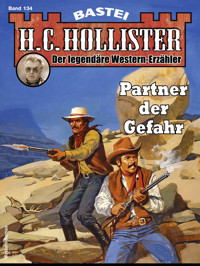1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: H.C. Hollister
- Sprache: Deutsch
Zusammen mit seinem kleinen Bruder reitet Clint Yale hinauf nach Oregon. Die einzige Möglichkeit, dem Jungen nach dem Tod ihrer Mutter zu einem neuen Heim zu verhelfen, sieht er in der Heugabel-Ranch ihres Onkels. Er ahnt nicht, dass dieser Ritt gleichsam in eine Vergangenheit führt, die schon mehr als zwanzig Jahre zurückliegt. Ungewollt stößt er am Crazy Woman Lake zum ersten Mal mit einem Vertreter der Fairlaine-Sippe zusammen und trifft auf jene geheimnisvolle Indianerin, der das Schicksal trotz ihrer Geisterverwirrung eine besondere Rolle zugedacht hat.
Noch ahnt Clint nicht, dass die Heugabel-Ranch bereits seit vielen Jahren von den Fairlaines besetzt ist und dass sich eben jener Tony Fairlaine anschickt, durch ein infames Intrigenspiel die Macht der großen Zwei-Flaggen-Ranch noch weiter zu vergrößern. Als er erfährt, dass sein Vater einmal der Reitboss dieses Weidereichs gewesen ist, kann er sich schon nicht mehr aus der Verstrickung lösen. Die schwelenden Gegensätze führen zu einer offenen Fehde, in der Clint seinem härtesten Gegner hilflos ausgeliefert scheint ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
DIE EHRE DER FAIRLAINES
Vorschau
Impressum
DIE EHRE DER FAIRLAINES
Zusammen mit seinem kleinen Bruder reitet Clint Yale hinauf nach Oregon. Die einzige Möglichkeit, dem Jungen nach dem Tod ihrer Mutter zu einem neuen Heim zu verhelfen, sieht er in der Heugabel-Ranch ihres Onkels. Er ahnt nicht, dass dieser Ritt gleichsam in eine Vergangenheit führt, die schon mehr als zwanzig Jahre zurückliegt. Ungewollt stößt er am Crazy Woman Lake zum ersten Mal mit einem Vertreter der Fairlaine-Sippe zusammen und trifft auf jene geheimnisvolle Indianerin, der das Schicksal trotz ihrer Geisterverwirrung eine besondere Rolle zugedacht hat.
Noch ahnt Clint nicht, dass die Heugabel-Ranch bereits seit vielen Jahren von den Fairlaines besetzt ist und dass sich eben jener Tony Fairlaine anschickt, durch ein infames Intrigenspiel die Macht der großen Zwei-Flaggen-Ranch noch weiter zu vergrößern. Als er erfährt, dass sein Vater einmal der Reitboss dieses Weidereichs gewesen ist, kann er sich schon nicht mehr aus der Verstrickung lösen. Die schwelenden Gegensätze führen zu einer offenen Fehde, in der Clint seinem härtesten Gegner hilflos ausgeliefert scheint ...
Hinter einer flachen Hügelkuppe, irgendwo am Ufer des Sees, war ein erstickter Schrei zu hören, der zweifellos aus einer weiblichen Kehle stammte.
Clint Yale brauchte nur eine einzige Sekunde, dann genügte ein harter Schenkeldruck, um den prächtigen Wallach aus dem Stand sofort in vollen Galopp springen zu lassen. In gestreckten Sätzen fegte er die sanft geneigte Kuppe empor, sprang über einen Busch und brauste dann wieder den Hang zum Ufer hinab.
Die Szene war eindeutig. Neben einer alten, verfallenen Blockhütte war eine hochbeinige Fuchsstute angebunden. Ein Stück entfernt graste unter den Espen ein Rappe, dessen Zügel am Boden schleiften. Unmittelbar bei dem von Unkraut überwucherten Korral entsprang eine kleine Quelle und schickte ein murmelndes Rinnsal in den See, der im Schein des Abendrots zu glühen schien. Dort, bei der Quelle, standen sie, der Mann und die junge Frau – oder besser, sie rangen miteinander.
Der Mann schien daran ein großes Vergnügen zu empfinden, denn er lachte laut und auf anmaßende Weise. Dennoch war dies alles kein Spaß. Es gelang der Frau, eine Hand seinem Griff zu entwinden. Klatschend schlug sie ihm ins Gesicht. Das Lachen brach ab. Die Frau riss sich vollends los und stürzte davon. Die zupackende Rechte des Mannes erwischte nur noch den Ärmel ihrer Bluse, der bis hinauf zur Schulter knirschend in Fetzen hing. Die Frau strauchelte, stürzte zu Boden und raffte sich gewandt wieder auf. Gehetzt rannte sie am Seeufer entlang, weil ihr der Weg zu ihrem Pferd versperrt war. Der Mann stimmte wieder sein Lachen an. Und dann stürmte er ebenfalls in geschmeidigen Sätzen los.
In diesem Moment wurde er von dem Wallach eingeholt. Clint Yale sah das Gesicht der Burschen, das in jähem Erschrecken herumfuhr. Aber da hechtete er bereits aus dem Sattel auf den Gegner hinab und riss ihn im Sturz mit sich in das feuchte Schilf.
Keuchend kamen sie wieder auf die Beine. Doch Yale hatte den Vorteil der Überraschung auf seiner Seite. Zwar rammte der andere ihm die Faust entgegen und traf ihn oberhalb der Gürtelschnalle, aber die Wirkung blieb aus, weil Yale diesem Hieb durch lockeres Zurückweichen die Wucht nahm. Dann hatte er die richtige Distanz gewonnen. Seine Linke traf den anderen vernichtend in die Magenpartie. Der dunkelhaarige Mann knickte ein und gab einen würgenden Laut von sich. Genau in diesem Augenblick kam Yales Rechte zu seiner Kinnspitze und warf ihn zurück über den Schilfsaum bis in das seichte Wasser hinein.
Feurige Kreise verbreiteten sich über den See. Sie liefen immer weiter gegen die untergehende Sonne und verwandelten die Fläche in einen gleißenden Spiegel aus rotem, glutflüssigem Metall, sodass Clint Yale gegen dieses Gefunkel die Augen zusammenkneifen musste.
Yale wandte sich keuchend um und sah das Mädchen, das nun in panischer Flucht zu der Fuchsstute bei der Hütte stürzte. Gleichzeitig erschien weiter oben in der Hügellücke Happy auf seinem galoppierenden Maultier. Der zwölfjährige Hapgood Yale hatte ein sommersprossiges Gesicht und war der Bruder und Begleiter des Revolvermanns.
Zumindest einen Teil der Szene musste er noch beobachtet haben.
»Miss«, rief Yale krächzend aus. »Hey, Lady, so warten Sie doch!«
Die junge Frau schien taub zu sein. Mit erstaunlicher Gewandtheit schwang sie sich auf das Pferd und jagte davon. Der Hut war ihr an der Fangschnur auf den Rücken gerutscht. Ihr Haar flatterte und glänzte im Licht der schneidenden Sonne wie rotes Gold. Wenige Augenblicke später verschwand sie bereits hinter den lichten Espenbeständen, deren Laub sich in flimmernder Bewegung befand.
Happy trieb seine Maultierstute bereits zu dem Apfelschimmel, ergriff die schleifenden Zügel und zog den Wallach herum. Im selben Moment, da er dann seinem Bruder wieder das Gesicht zuwandte, rief er mit schriller, überschnappender Jungenstimme: »Achtung, Clint!«
Wie ein Schemen wirbelte Yale herum. Scheinbar ganz von selbst schien ihm dabei sein blauschimmernder 45er Revolver in die Hand zu springen. Doch er kam zu spät. Die triefende Gestalt, die dort drüben bis zu den Knien im Wasser stand, hatte die Waffe bereits auf ihn gerichtet. Das Gesicht von grenzenlosem Hass verzerrt, drückte der Bursche ab.
»Klick!«, machte es, als der Hammer seines Colts zuschnappte. Nur der Bruchteil einer Sekunde blieb Clint Yale zum Überlegen. Er durfte sich nicht darauf verlassen, dass auch die nächste Patrone jenes hochgewachsenen, dunkelhaarigen Kerls dort drüben versagen würde. Ein skrupelloser Mann in seiner Situation hätte nun blindlings geschossen. Aber gerade diese innere Schwelle war es, die Clint Yale von bedenkenlosen Revolverhelden und Schießern unterschied – und der sichere Blick eines wirklichen Kämpfers.
Er sah nicht nur die Waffe in der Hand des anderen und dessen fanatisches Gesicht, er bemerkte auch die seltsam glasigen Augen, die ihm entgegenstarrten. Deshalb behielt er seine Kugel im Lauf und hetzte mit zwei langen Zickzacksprüngen durch das Schilf.
Der Dunkelhaarige vergaß seinen Revolver. Er schwankte und warf sich dem Angreifer entgegen. Sein Ächzen klang wie ein hassvoller Seufzer. Aber diesmal gab Yale ihm keine Chance, einen Schlag anzubringen. Es war im Grund genommen nur eine Maulschelle, die er dem Burschen versetzte, aber dieser Schlag war derart kraftvoll geführt, dass der Kopf des Mannes davon herumgerissen wurde. Und sofort klatschte Yales Hand von der anderen Seite her wieder zurück. Als der Dunkelhaarige zur Seite kippte, entriss ihm Yale die Waffe und kehrte mit grimmig verkniffenem Mund ans Ufer zurück. Er schob den eigenen Revolver ins Halfter, öffnete die Trommel der fremden Waffe und schüttelte die Patronen heraus.
»Komm her!«, befahl er dann rau. »Komm aus dem Wasser, bevor ich es mir anders überlege und dich darin ersäufe wie eine Katze, du hinterhältiger Lump!«
Der Dunkelhaarige machte einen Versuch, sich aufzurichten, doch er sank wieder zurück. So kroch er dann auf allen vieren durch das Schilf an Land. Eigentlich hätte das ein jämmerlicher Anblick sein müssen, aber der Eindruck, den Yale dabei gewann, sah ganz anders aus. Ihm erschien es so, als bewege sich da eine unheimliche Bedrohung auf ihn zu, als käme ihm da ein hasserfülltes, gefräßiges Ungeheuer entgegengekrochen. Es waren wohl die dunklen, glühenden und dabei noch immer getrübten Augen des Mannes, die dieses Empfinden in ihm hervorriefen. Nach der ersten schweren Rechten ans Kinn konnte dieser Pilger unmöglich schon wieder völlig klar sein. Doch wie tief und grenzenlos musste der Hass eines Mannes sein, wenn er sogar aus dem Unterbewusstsein keimte.
Endlich am Ufer angelangt, richtete der Dunkelhaarige sich mühsam auf und kam schwankend auf die Beine. Er leckte sich das Blut von der aufgeschlagenen Lippe und krächzte: »Hölle auch, es war doch nur ein Spaß – nichts weiter als ein Spaß ...«
Angespannt maß ihn Yale von Kopf bis Fuß. Die Kleidung dieses Burschen, sein silberbeschlagener Gurt, seine teuren Maßstiefel – nein, das war weder ein Satteltramp noch ein herumstreifender Weidereiter.
»Pack dich, du Hundefloh! Los, verschwinde hier, sonst tut es mir vielleicht noch leid, dich so davonkommen zu lassen.«
Clint Yale warf dem Dunkelhaarigen den Revolver mit dem Elfenbeinkolben vor die Füße – dorthin, wo auch der schwarze Zwanzig-Dollar-Hut des Burschen lag.
»Er hätte dich erschossen, Clint!«, rief Happy mit seiner hellen, fast überschnappenden Stimme. »Er hätte dich glatt erschossen, wenn seine Patronen nicht nass geworden wären. Warum verprügelst du ihn nicht und bringst ihn ins Gefängnis?«
Ein tückischer Blick des Mannes streifte auch Happy, während er mit unterdrücktem Ächzen Hut und Revolver vom Boden auflas. Er sagte nichts mehr, als er mit unsicheren Schritten zu seinem hochbeinigen Rappen ging und sich in den Sattel zog. Zweimal versuchte er es vergebens, ehe er endlich oben saß.
In diesem Moment hörte Yale das blecherne Kichern und sah die Gestalt unter den Bäumen. Es war eine alte Indianerin, deren runzliges Gesicht noch den Schimmer einer einstigen Schönheit widerspiegelte. Ihr Fransenkleid aus ehemals hellem, weichgegerbtem Elchleder war verschmutzt und speckig. Wie Wurzelstöcke ragten darunter ihre knorrigen, schwielenbedeckten Füße hervor. Ihr Haar hing in langen grauen Strähnen herab und wurde nur von einem perlenbestickten Stirnband gehalten. Ihre braunen Zähne waren lückenhaft, und ihre funkelnden Augen zeigten einen geradezu irren Blick. An einer Lederschlinge, die sie sich ebenfalls über die Stirn gestreift hatte, trug sie auf dem Rücken eine riesige Holzlast, die ihre kleine, fast zierliche Gestalt weit überragte.
Noch immer hielt ihr Kichern an. Es wirkte gehässig und wie triefender Hohn, und es galt zweifellos dem Mann, der schwankend und verkrümmt im Sattel des Rappen hockte.
Der Reiter drehte den Kopf herum und stieß einen Fluch aus. Ebenso wie Clint Yale und der Junge sah er, dass die alte Indianerin trotz ihrer schweren Traglast nun ein paar groteske Tanzschritte vollführte, unter den Bäumen hervorkam und dabei in quiekenden nasalen Tönen einen Gesang anstimmte. Der Dunkelhaarige zerrte am Zügel und stieß dem Rappen die Sporen in die Flanken. Das Pferd schnellte vorwärts, genau auf die Indianerin zu, die unbeirrt in ihrem Singsang fortfuhr und ihm sogar noch entgegentänzelte, so als ob sie die Gefahr gar nicht sähe.
»Clint!«, heulte der Junge auf.
Es war nicht ganz klar, ob der Schrei diese Wirkung hervorbrachte oder ob die groteske, tanzende Gestalt die Ursache der Panik war. Wenige Schritte vor der Indianerin brach der Rappe zur Seite aus und bäumte sich mit schrillem Wiehern auf, sodass der Reiter sich nur mit Mühe im Sattel halten konnte. Dann jagte das Pferd davon, und die Alte schickte ihm ein hohnvolles Kichern nach.
Happy Yale schluckte und zog den Apfelschimmel näher zu sich heran.
»Mein Gott«, seufzte er, »morgen werde ich glauben, ich hätte das alles nur geträumt. Clint, kannst du mich nicht mal an den Ohren ziehen, damit ich merke, ob ich wach bin?«
Yale gab darauf keine Antwort. Er starrte noch immer auf die Indianerin, die sich in ihren grotesken Tanzschritten näherte, und wusste plötzlich, dass er fast am Ziel war. Die Erscheinung der Alten bewies, dass es sich bei dem See hier um den Crazy Woman Lake handelte, denn man hatte ihn nach einer wahnsinnigen Nez-Percé-Squaw benannt. Das heißt, eine Squaw im üblichen Sinne war die Alte nicht, vielmehr eine Art Priesterin, die im Auftrag ihres Volkes ein Heiligtum zu bewachen hatte. Sie war eine von jenen »unberührbaren Frauen«, für die es in der Geschichte des Nez-Percé-Stammes eine ganze Reihe von Beispielen gab. Und das Heiligtum ihres Volkes war der aufragende graue Felsen jenseits des Sees, der Medicine Rock, wie er von den Weißen genannt wurde.
Früher hatten die Nez-Percés in diesem Gebiet gelebt. Inzwischen hatte man sie in die nahegelegene Reservation gedrängt. Die Priesterin war als einzige im Land ihrer Väter zurückgeblieben, und es hieß, dass sie aus irgendeinem Grund von ihrem Stamm verstoßen worden sei. Nur im Juni, zur Zeit der Sonnenwende, bekamen die Krieger und Jünglinge der Nez-Percés von ihrer Agentur widerstrebend die Genehmigung, zum alten Stammheiligtum zu ziehen, um dort den Söhnen die Waffen zu verleihen und den Büffelgott durch nächtelange Jagdtänze gnädig zu stimmen. Clint Yale hatte die Geschichte einmal von einem Halbblut gehört, und obwohl dieser Mann bereits in der Zivilisation aufgewachsen war, hatte man noch spüren können, welche Bedeutung er diesen religiösen Bräuchen der Indianer beimaß.
In jeder Einzelheit stand Clint Yale der Bericht wieder vor Augen, als die Alte herangetanzt kam, ohne unter ihrer Last zu ermüden. Ein Wort kam in ihrem misstönigen Gesang immer wieder vor. Es lautete »Umpquahanna«, und Yale erinnerte sich, dass es der Name der wahnsinnigen Priesterin war.
Er blickte nur für einen Moment auf, als er bemerkte, dass sich sein Bruder unwillkürlich mit den beiden Tieren näher an ihn herandrängte, als ob er vor der unheimlichen Erscheinung Schutz suchte. Umpquahanna jedoch schien sie überhaupt nicht zu sehen. In seltsam feierlichen Tanzschritten wandelte sie mit ihrem großen Holz- und Reisigbündel an ihnen vorüber zu der alten Trapperhütte.
Clint Yale wäre kaum auf den Gedanken gekommen, dass dieses morsche Blockhaus mit dem zur Hälfte eingesunkenen Dach und den dunklen Fensterhöhlen noch einem Menschen als Obdach dienen könnte. Jetzt erst bemerkte er den Trampelpfad, der von der schief in den Angeln hängenden Tür zur nahegelegenen Quelle und zum Ufer des Sees verlief. Und dann sah er auch den Korb, der neben der Tür im Gras stand und mit einem hellen Tuch zugedeckt war.
Der nasale Gesang der Alten brach plötzlich ab. Umpquahanna warf ihre Traglast zu Boden, stieß einen Schrei des Entzückens aus und stürzte auf den Korb zu. Schon während sie damit in die verfallene Hütte eilte, begann sie mit ihren braunen Klauenhänden gierig den Inhalt zu durchwühlen, so als ob sie nach etwas Bestimmtem suchte. Yale konnte gerade noch erkennen, wie sie eine bunte Candystange hervorkramte und sofort in den Mund steckte. Die Vorliebe der Indianer – auch der Krieger – für Süßigkeiten aller Art war allgemein bekannt. Der Can hanpi des Weißen Mannes – der Zucker – hatte es ihnen angetan, und Umpquahanna machte darin keine Ausnahme. Dass sie aber sofort nach der Candystange zu suchen begann, ließ den Schluss zu, dass es sich bei dem Inhalt des Korbs um regelmäßig wiederkehrende Liebesgaben handelte, die vermutlich von jenem blondhaarigen Mädchen hergebracht worden waren.
»Clint«, wurde Yale von Happy aus seinen Gedanken aufgeschreckt, »lass uns sehen, dass wir weiterkommen. Es ist so unheimlich hier.«
»Angst, Krümel?«, fragte Yale. Er brauchte den Jungen nur anzuschauen, um diese Vermutung bestätigt zu sehen. Happy nickte verkrampft und murmelte flehend: »Lass uns reiten, Clint. Die Alte – sie sieht genauso aus wie die Hexe in dem Märchenbuch, das du mir einmal mitgebracht hast. Als ich ihr Kichern hörte, lief es mir ganz kalt über den Rücken. Hast du nicht gesehen, wie sie mit ihrem Zaubergesang den Rappen ganz wild gemacht hat?«
Clint Yale nahm die Zügel seines Apfelschimmels und saß auf. Einen Moment lang hatte er mit dem Gedanken gespielt, hier an der Quelle zu kampieren. Aber der Wiesengrund war feucht, und zudem hätte Happy in unmittelbarer Nähe der Hütte wahrscheinlich die ganze Nacht kein Auge zugetan. Es schien ihm also geraten, vor Einbruch der Dunkelheit noch rasch nach einem geeigneten Lagerplatz für die Nacht Ausschau zu halten.
✰✰✰
Sie fanden den Lagerplatz kaum zwei Meilen vom Crazy Woman Lake entfernt am Oberlauf des gleichnamigen Creeks, der aus den bewaldeten Hügeln kam.
Der Junge war nach dem Abendessen bald eingeschlafen. Clint Yale saß noch am verglimmenden Feuer, rauchte und lauschte den ruhigen Atemzügen des Jungen. Natürlich gefiel Happy dieses Leben in scheinbar ungebundener Freiheit, das für ihn zudem noch von einem Hauch Romantik umwittert war. Aber in diesem Alter brauchte man noch ein Dach über dem Kopf, einen geregelten Tagesablauf und vor allen Dingen ein anderes Vorbild als einen Revolvermann und Satteltramp.
Yale gab sich darüber keinen Illusionen hin. Er selbst hatte sich sein Leben ganz anders vorgestellt. Er hatte von einer kleinen Ranch geträumt und diese Träume auch jetzt noch nicht endgültig begraben. Aber die Verhältnisse waren stärker gewesen als seine Wünsche. Er hatte Hapgood Yale, seinen Vater, zum ersten Mal gesehen, als er ungefähr so alt war wie Happy jetzt. Zu diesem Zeitpunkt war Hapgood Yale aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er fast vierzehn Jahre seines Lebens zugebracht hatte, ehe man ihm den Rest seiner zwanzigjährigen Strafe wegen guter Führung erließ.
Er war ein großer, starkknochiger Mann mit einem stillen Gesicht und ruhigen Augen. Vielleicht war er nicht immer so gewesen, aber früher hatte Clint Yale ihn ja gar nicht gekannt. Vierzehn Jahre hinter Gittern und in einem Steinbruch hatten seine Lebenskraft gebrochen und den Keim jener schlimmen Krankheit in ihn gesenkt. Mit all ihrer Liebe hatte Celia Yale versucht, ihn jene schlimme Zeit vergessen zu lassen. Doch der Verfall war nicht mehr aufzuhalten. Hapgood Yale hatte noch die Geburt seines zweiten Sohnes erlebt, der nach ihm benannt wurde. Etwa ein Jahr später hatte er die Seinen allein zurückgelassen. Happy hatte nie erfahren, dass er der Sohn eines Mannes war, der wegen eines versuchten Raubes verurteilt worden war und bei seiner Straftat um ein Haar noch zum Mörder geworden wäre. Ihrem ältesten Sohn hingegen hatte Celia Yale diese Tatsachen nicht verheimlichen können, aber sie hatte ihm immer wieder eingehämmert, dass diese Verurteilung zu Unrecht erfolgt sei und dass auch ein ehrenhafter Mann durch die Gerechtigkeit eines harten Schicksals ins Gefängnis kommen könne.
Clint Yale hatte gespürt, welch unsagbare Qual ihr diese Dinge bereiteten, und das Thema von sich aus nie wieder berührt. Auch sein Vater hatte nur ein einziges Mal davon gesprochen. Unfreiwillig hatte der damals fünfzehnjährige Clint gehört, wie Hapgood Yale seiner Frau wenige Tage vor seinem Tod sagte, er bedauere nur, jenen Mann lediglich angeschossen und nicht getötet zu haben. Diese Worte hatten Clint Yale in einen tiefen Zwiespalt gestürzt, besagten sie doch nichts anderes, als dass sein Vater die Tat, für die man ihn ins Gefängnis steckte, auch wirklich begangen hatte. So blieb Clint nur der Schluss, dass seine Mutter ihm gewissermaßen die »Kinderwahrheit« gesagt hatte, um ihm die Achtung vor dem Vater zu erhalten. Er hatte lange gebraucht, um mit dieser Erkenntnis fertigzuwerden und sich dabei nichts von seiner Ahnung um die wahren Zusammenhänge anmerken zu lassen.
Schon damals hatte er sich für seine Mutter und den kleinen Happy verantwortlich gefühlt. Er war darüber hart geworden – härter als andere Halbwüchsige seines Alters und weitaus ernster als sie. Seine Mutter hatte sich aufgeopfert und sich ein Leben lang geschunden, um ihre Söhne auf anständige Weise durchs Leben zu bringen. Clint Yale war stolz gewesen, als er ihr seinen ersten Lohn als Pferdejunge und später als jüngster Reiter einer großen Ranch nach Hause bringen konnte. Zwanzig Dollar im Monat hatte er verdient und sich eingebildet, dass damit nun alle Not und alle Einschränkungen ein Ende hätten. Aber bald hatte er einsehen müssen, dass nicht einmal der Spitzenlohn eines erfahrenen Weidereiters ausreichen würde, um eine Familie zu sichern.