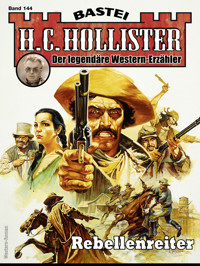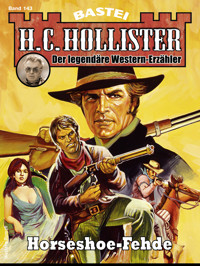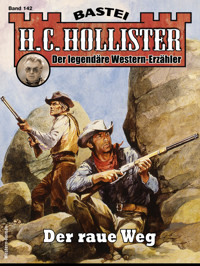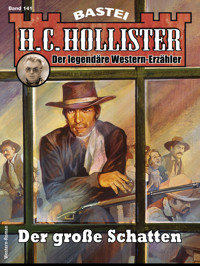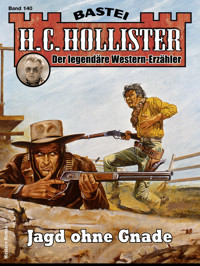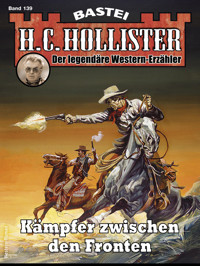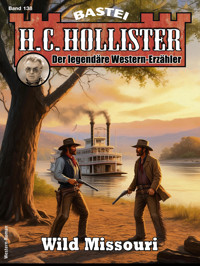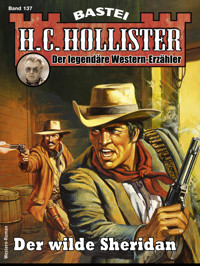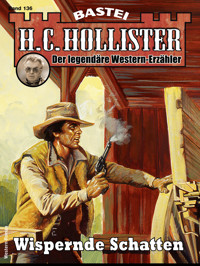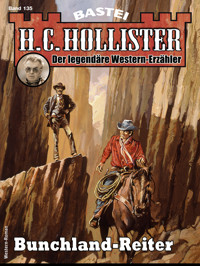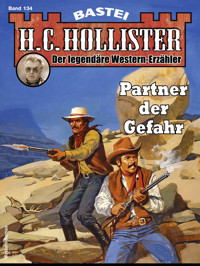1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: H.C. Hollister
- Sprache: Deutsch
Die Herkunft Youngblood Shrivers ist äußerst zweifelhaft. Seine Gegner betrachten ihn als ein Pawnee-Halbblut, und er selbst ist zu stolz, um ihnen das Gegenteil zu beweisen. Für seine Freunde aber ist er der beste Scout der 4. Kavallerie. Kein Wunder also, dass er und sein Partner Jacques Lafitte dem Expeditionskorps zugeteilt werden, das zum Schutze des Virginia-City-Weges weiter im Norden ein Fort errichten soll, obgleich alle Anzeichen im Indianerland auf Sturm stehen.
Senator Jason D. Winter ist im Begriff, eine Erzmühle nach Virginia City hinaufzuschaffen, um die Zukunft des gigantischen Goldgräbercamps zu sichern. Mit seinen Frachtwagen schließt er sich dem Expeditionskorps an. Und nur wenige Männer wissen, welche verderbenbringende Ladung im letzten Wagen dieses Trecks untergebracht ist, Männer wie der zwielichtige Frachtboss Wade Slattery und der ehemalige Pelzjäger Lars Fedderspiel. Für sie soll der Weg am Abgrund zum größten Geschäftserfolgs ihres Lebens werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
DER LETZTE KÄMPFER
Vorschau
Impressum
DER LETZTE KÄMPFER
Die Herkunft Youngblood Shrivers ist äußerst zweifelhaft. Seine Gegner betrachten ihn als ein Pawnee-Halbblut, und er selbst ist zu stolz, um ihnen das Gegenteil zu beweisen. Für seine Freunde aber ist er der beste Scout der 4. Kavallerie. Kein Wunder also, dass er und sein Partner Jacques Lafitte dem Expeditionskorps zugeteilt werden, das zum Schutz des Virginia-City-Wegs weiter im Norden ein Fort errichten soll, obgleich alle Anzeichen im Indianerland auf Sturm stehen.
Senator Jason D. Winter ist im Begriff, eine Erzmühle nach Virginia City hinaufzuschaffen, um die Zukunft des gigantischen Goldgräbercamps zu sichern. Mit seinen Frachtwagen schließt er sich dem Expeditionskorps an. Und nur wenige Männer wissen, welche verderbenbringende Ladung im letzten Wagen dieses Trecks untergebracht ist, Männer wie der zwielichtige Frachtboss Wade Slattery und der ehemalige Pelzjäger Lars Fedderspiel. Für sie soll der Weg am Abgrund zum größten Geschäftserfolgs ihres Lebens werden.
Youngblood Shriver wachte auf, als der Hund neben ihm ein Schnaufen ausstieß, das einem Niesen nicht unähnlich war. Er tastete mit der Hand zu dem grauen Halbwolf hinüber, bis er ihn beim zottigen Fell packen konnte, blieb jedoch reglos liegen und lauschte in die Nacht. Die Hochprärie am Warrior Creek hatte ihre eigenen Geräusche. Nur dem Umstand, dass er sie alle kannte, hatte Youngblood Shriver sein Leben und seinen Skalp zu verdanken.
Seit zwei Tagen schon wartete er hier auf Jacques Lafitte. Der kleine, kauzige Prärieläufer französischer Abstammung war ein ebenso erfahrener Scout wie er selbst. Zeit spielte hier im Indianerland nur eine untergeordnete Rolle. Es konnte schon einmal vorkommen, dass sich ein Mann um mehrere Wochen verspätete, wenn er Indianer auf seiner Fährte hatte und sie nicht geraden Weges zum vereinbarten Treffpunkt führen wollte. In letztem Fall wartete dann irgendwo ein Freund vergebens auf den anderen. Oder er bekam sogar nächtlichen Besuch, auf den er nicht vorbereitet war. Diese Möglichkeit musste man hier am Warrior Creek jederzeit ins Auge fassen. Deshalb zog Youngblood Shriver nun den schweren Revolver unter dem Sattel hervor, der ihm als Kopfkissen diente, streifte die raue Decke zurück und erhob sich so lautlos wie ein Schatten.
Die Morgendämmerung war nicht mehr fern. Eine schwache Brise wisperte im Laub der Espen und Cottonwoods drüben am Creek. Die Mulde hier zwischen den Hügeln bot eine ausgezeichnete Deckung. Aber der Nase eines Oglala-Räubers genügte schon eine winzige Spur verwehrten Holzrauchs in der Luft, um dieser Witterung zu folgen und nicht eher zu ruhen, bis der Ursprung dieses Geruchs ergründet war. Selbst für einen ausgekochten, mit allen indianischen Listen vertrauten Scout wie Youngblood Shriver gab es im Land der Dakota-Sioux keine Sicherheit.
Er verharrte in geduckter Haltung und zog nun auch sein Gewehr unter der Plane hervor, die er zum Schutz gegen den Tau darübergebreitet hatte. Das leise Rascheln machte ihn wütend auf sich selbst. Mit einem fast unhörbaren Zischen rief er den Hund an seine Seite. Der Wolfsbastard drängte sich an seine Schenkel, seine bernsteingelben Lichter jedoch blickten dabei ständig in dieselbe Richtung – dorthin nämlich, woher der leichte Nachtwind heranstrich. Youngblood Shriver brauchte nicht erst auf ihn hinabzuschauen. Er wusste auch so, dass Lobo nun die Reißzähne entblößt hatte und dass sein zottiges graues Haar vom Nacken bis zur Schwanzwurzel wie eine dunkle, gesträubte Bürste aufgerichtet war.
Lobo war ein eigenwilliger Einzelgänger. Es geschah nicht oft, dass er sich die Zuneigung zu seinem Herrn anmerken ließ, es war sogar fraglich, ob er diesen wortkargen, spröden Zweibeiner überhaupt als Herrn anerkannte. Sie hatten sich ganz einfach zu einer gleichberechtigten Lebensgemeinschaft – oder besser: Überlebensgemeinschaft – zusammengeschlossen, ohne darum viel Aufhebens zu machen. Wenn das wilde Blut seiner Wolfsahnen in Lobo revoltierte, dann konnte es geschehen, dass er für Tage aus dem Gesichtskreis des Scouts verschwand und irgendwo in der Wildnis seine eigenen Wege ging. Aber mit tödlicher Sicherheit tauchte er immer dann wieder auf, wenn Gefahr im Verzug war, selbst wenn Youngblood Shriver in der Zwischenzeit hundert Meilen zurückgelegt hatte. Es war ein unsichtbares Band zwischen ihnen, das sogar dem Scout zuweilen Rätsel aufgab.
Im Augenblick jedoch versuchte er ein Rätsel anderer Art zu lösen. Lobo witterte gegen den Wind. Aber kein Sioux hätte je den Fehler begangen, sich mit dem Wind im Rücken an einen Gegner heranzuschleichen, es sei denn, dass es sich dabei um eine List handelte. Youngblood Shriver schnallte seinen Gurt um und schob den Revolver ins Halfter. Dann drückte er den Kolben seines Karabiners gegen die Rippen und glitt zu den Büschen, die vor der nächsten Hügelfalte eine dunkle Kulisse bildeten. Trotz seiner Größe von sechs Fuß und einem Zoll war sein Schritt weich und geschmeidig. Seine Füße steckten in Wolfsfellstiefeln, die wie hochschäftige Mokassins gearbeitet waren und deren biegsame Rauledersohle jede Unebenheit des Bodens spüren ließ.
Zwischen den ersten Büschen hielt der Mann inne. Der Wolfsbastard war nicht von seiner Seite gewichen und fuhr sich schlappend mit der Zunge über die emporgezogenen Lefzen. Ein leises Prusten und Schnauben waren nun zu hören. Irgendwo hinter den Büschen befanden sich das Pferd und das Maultier. Beide waren an den Vorderbeinen angehobbelt, sodass sie nur kleine Schritte vollführen konnten. Jeder erfahrene Indianerkämpfer brachte die Tiere bei Nacht so unter, dass der Wind von ihnen zu seinem Camp hinüberwehte. Sie waren also noch da. Außerdem gab es jenseits der Büsche eine Gefahr. Mehr als dieser Umstand beschäftige Youngblood Shriver im Moment die Frage, wieso sie entgegen jeder Wahrscheinlichkeit aus dieser Richtung kam.
Die beste Tarnung in der Nacht war die Reglosigkeit. Wer am selben Fleck verharrte, der war gegenüber einem sich bewegenden Gegner immer im Vorteil, solange dieser Gegner seine Stellung noch nicht erkannt hatte. Im Endeffekt lief es auf die besseren Nerven hinaus. Und in diesem Punkt konnte es der Pawnee-Zögling Youngblood Shriver mit jedem Dakota-Sioux aufnehmen.
Im Osten färbte sich der Himmel allmählich grau und ließ die Konturen der Hügelkuppen am Horizont hervortreten. Der Scout rührte sich minutenlang nicht vom Fleck und spannte all seine Sinne. Dies war die Sioux-Stunde. Wenn die Dakota-Stämme der nördlichen Hochprärie angriffen, dann taten sie es mit Vorliebe im Morgengrauen. Alles stimmte. Nur die Sache mit der Windrichtung nicht.
Von Minute zu Minute wurde es heller. Büsche und Bäume verloren ihre gespenstischen Formen, und auf dreißig Yards konnte der Scout jenen grauen Flecken erkennen, der von der Asche seines erloschenen Campfeuers gebildet wurde. Ein weniger erfahrener Mann wäre vielleicht zu dem Schluss gelangt, dass er sich geirrt hätte. Aber Youngblood Shriver hatte schon einmal zwei Nächte und einen Tag ausgeharrt, um dann festzustellen, dass es kein Irrtum gewesen war. Eine Narbe am Haaransatz seiner linken Schläfe zeugte davon, was bei geringer Wachsamkeit hätte geschehen können. Und wie gesagt, Zeit spielte im Siouxland eine untergeordnete Rolle.
Wieder war ein nervöses Schnauben zu hören, und dann vernahm der Scout ein anderes Geräusch, das nicht lauter war als ein Hauch. Es handelte sich um ein Rascheln, das ausnahmsweise nicht dem Wind zuzuschreiben war. Es kam von rechts, ungefähr von der Basis des Hügels. Mit einem Schlag wurde Youngblood Shriver die Falle klar. Die Gegner mussten gewusst haben, wen sie hier beschlichen, auch wenn ihnen die genaue Lage des Camps unbekannt war. Vermutlich hatten sie im Laufe der vorangegangenen Tage seine Fährte gefunden und auch die Spur des Hundes entdeckt. Deshalb entschlossen sie sich zu einer List.
Es war ihnen klar, dass die Suche nach dem Camp trotz der Dunkelheit nicht unbemerkt vonstattengehen konnte, solange der Hund in der Nähe war. Deshalb näherte sich ein Teil des Rudels mit dem Wind, zweifellos in der Hoffnung, dass der Hund durch sein Bellen die Lage des Camps verraten und gleichzeitig die Aufmerksamkeit ihres Opfers in die falsche Richtung lenken würde. Zur selben Zeit schlich sich der größere Teil des Kriegstrupps gegen den Wind oder von der Seite heran. Kein Zweifel, wenn der Scout durch die Büsche weiter vorgedrungen wäre, um nach den Tieren zu sehen, dann wäre er von links und rechts in die Zange genommen worden und hätte seine Unvorsichtigkeit mit dem Leben bezahlt. So aber schienen die Rothäute über seinen gegenwärtigen Aufenthalt immer noch im Unklaren zu sein.
Durch die lange Wartezeit unruhig geworden, pirschte sich einer von ihnen an den Büschen entlang. Selbst der schwache Geruch der erkalteten Holzasche würde ihm genügen, um sich zu orientieren. Er ebenso wie seine Vettern mussten wissen, dass sie ihr Opfer irgendwo auf der Linie zwischen dem vermuteten oder auch schon erkannten Ort des Campfeuers und den beiden Tieren zu suchen hatten.
Youngblood Shriver packte mit der Linken das Nackenfell des Wolfsbastards und beugte sich tief zu ihm hinab. Lobo kauerte sich sprungbereit zu Boden, gab aber keinen Laut von sich. Ein hüfthoher Strauch, zwei Schritte von der geschlossenen Buschkulisse entfernt, gab ihnen genügend Deckung, solange sie sich reglos verhielten.
Und dann sah der Scout die bronzehäutige, untersetzte Gestalt, die schemenhaft an den Büschen entlangglitt. Es handelte sich um einen Oglala, wie die ockerfarbene Gesichtsbemalung bewies. Die vollkommene Lautlosigkeit des Geschehens ließ die Szene im Morgengrauen geradezu gespensterhaft erscheinen. Aber die blitzende Spitze der polierten Kriegslanze, die der Sioux in der Faust hielt, war tödliche Wirklichkeit, ebenso wie jenes Fransenbüschel unterhalb dieser Spitze, dessen Bedeutung keinem Eingeweihten zweifelhaft sein konnte. In geduckter Haltung stemmte Youngblood Shriver den Kolben seines Karabiners auf den Schenkel und umschloss den Kolbenhals mit stählernem Griff.
Zehn Yards war der Oglala noch entfernt. Sein bronzehäutiger, muskulöser Oberkörper war nackt. Hinter seiner Schulter ragten die gefiederten Enden eines ganzen Bündels Kriegspfeile aus seinem Köcher, während in seinem Haarschopf nur eine einzelne, mehrfach gekerbte Feder steckte. Youngblood Shriver war sich bereits sicher, wen er hier vor sich hatte. Es war »Mann-der-Knochen-bricht«, ein Unterhäuptling und gleichzeitig einer der gefürchtetsten Kämpfer der Oglala.
Ein Zittern lief durch den Körper des Wolfsbastards. Der Scout verstärkte seinen Griff und hielt ihn nieder. Es wäre pure Narrheit gewesen, den Indianer mit einem Schuss zu erledigen, solange man noch nicht wusste, wie viele seiner Vettern noch in den Büschen oder am Fuße des Hügels steckten. Die Unscheinbarkeit des Buschs, hinter dem Youngblood Shriver und sein Wolfshund Deckung gefunden hatten, war im Moment ihre stärkste Waffe. Offenbar kam der Oglala gar nicht auf die Idee, hinter ihm einen Gegner zu suchen, und wandte sich ausschließlich dem größeren und dichten Gebüschstreifen zu.
Vier Yards war er noch entfernt, als der Scout emporschnellte und die Entfernung mit einem geduckten Satz überwand. Der Oglala riss die Spitze seiner Lanze herum, aber er kam damit schon zu spät. Nur der Schaft klatschte Youngblood Shriver gegen die Hüfte und brachte ihn fast aus dem Gleichgewicht. Ein Sekundenbruchteil ging dadurch verloren.
»Pawnee!«, heulte der Oglala schrill. Dann traf ihn der Hieb mit dem Gewehrlauf am Kopf und ließ ihn stumm zu Boden sinken.
Im selben Moment war die Hölle los. Ungefähr an jener Stelle, wo der Scout seinen Gegner zuerst entdeckt hatte, erschien eine weitere Gestalt. Das Schwirren einer Bogensehne ging unter in einem hohen, tremolierenden Schrei aus einer Siouxkehle. Der Pfeil zischte dicht an Shrivers Schulter vorüber. Aber der Krieger kam nicht mehr dazu, einen zweiten aufzulegen. Ein Schuss aus dem Spencer-Karabiner warf ihn zurück, sodass er taumelnd in den Büschen verschwand.
Der Scout fuhr augenblicklich herum und betätigte den Repetierhebel des Gewehrs. Die Waffe immer noch im Seitenanschlag, feuerte er auf zwei heranstürmende Gestalten, die sich offenbar aus der dunstigen Niederung jenseits der Campmulde bis an die Büsche vorgearbeitet hatten. Einer der Oglala-Krieger stürzte. Der andere warf sich auf Youngblood Shriver, stieß ein kehliges Geheul aus und schwang seine Streitaxt. Und diesmal trat das ein, was der Scout insgeheim befürchtet hatte: Der Verschluss des Gewehrs klemmte beim Repetieren. Er fand keine Zeit mehr, den Revolver zu ziehen und riss den Gewehrlauf hoch, um den Hieb mit dem Tomahawk abzuwehren.
In diesem Moment brach das Geheul des Oglala plötzlich ab. Ein grauer Schatten war ihm mit einem geifernden Winseln entgegengeschnellt, sprang hoch und grub seine gelben Reißzähne in den Unterarm des Mannes.
Von irgendwo fuhr eine Kriegslanze heran und bohrte sich unmittelbar vor Youngblood Shriver in den Boden, noch ehe er den oder die neuen Gegner ausgemacht hatte. Zudem hatte der keuchende Oglala mit der freien Hand sein Skalpiermesser herausgerissen, um sich des Hundes zu erwehren. Hier lag für den Scout die vordringlichste Aufgabe. Er drehte im Sprung sein Gewehr um und schlug mit dem Kolben zu. Lobo war gerettet, aber das Gewehr war zum Teufel. Dabei blieb es ziemlich gleichgültig, ob das an dem eisenharten Schädel des Oglala oder an der miserablen Qualität des Karabinerschafts lag, dass der Kolben glatt abbrach.
Geduckt wirbelte Shriver wieder herum. Noch bevor er die Drehung vollendet hatte, lag bereits der schwere Sechsschüsser in seiner Hand. Er wäre dennoch zu spät gekommen. Der neue Gegner, der schemenhaft zwischen dem Gestrüpp spürbar wurde, war höchstens zwanzig Yards entfernt. Er hatte den Bogen bereits gespannt und zog die Sehne mit nerviger Faust bis an seinen vorspringenden Wangenknochen zurück. Ein Fehlschuss auf diese Entfernung war bei einem Oglala auch in der Morgendämmerung undenkbar.
In diesem Moment ertönte unten am Creek zwischen den Espen ein dumpfer, dröhnender Krach. Die Bogensehne klang fast wie eine zerreißende Violinsaite. Nur die Befiederung des Pfeilschafts streifte Youngblood Shrivers Wange, aber selbst diese Berührung war wie ein brennender Peitschenhieb. Der Oglala hielt seinen Kriegsbogen noch immer in der Linken, die Rechte jedoch presste er gegen die Brust. Er gurgelte ein paar gutturale Worte, offenbar war es ein Versuch, seinen Sterbegesang anzustimmen. Doch der Tod war schneller und erstickte diesen Versuch im Keim.
Youngblood Shriver blieb keine Zeit, Betrachtungen über dieses Wunder anzustellen. Zweimal feuerte er auf eine Stelle in den Büschen, wo er eine schattenhafte Bewegung wahrzunehmen glaubte. Noch einmal dröhnte es am Creek, und der Einschlag eines schweren Kalibers ließ einen armdicken Cottonwoodast herabknicken. Dann stürmte der Scout ohne Besinnen vorwärts.
Nach zwanzig Yards hatte er den Buschgürtel durchquert. Der große Rappwallach stand halb verdeckt an dem Hügelvorsprung und ruckte unwillig mit dem Kopf. Dicht an seine Flanke drängte sich die graue Maultierstute. Aber da war noch etwas. Vor dem Pferd kauerte ein Schatten am Boden, offenbar im Begriff, die Fesseln zwischen den Vorderbeinen zu durchschneiden.
Es war im Grunde nicht mehr als ein Warnschuss, den Youngblood Shriver abfeuerte. Bei dieser Entfernung wäre die Gefahr zu groß gewesen, den Rappen zu treffen. Doch der Schuss tat auch so seine Wirkung. Der Schatten schnellte hoch und verschwand lautlos hinter der Hügelschulter.
»Lobo!«, rief Shriver scharf, als der Hund hechelnd zur Verfolgung ansetzen wollte. Nur widerwillig gab der Wolfsbastard seine Absicht auf und trottete mit gesenktem Kopf zu den beiden Tieren hinüber. Sein Verhalten bewies dem Mann, dass er ungefährdet die freie Fläche überqueren konnte. Wenig später hörte man den Hufschlag eines Pferderudels irgendwo hinten in der Hügelfalte.
Keuchend blieb Youngblood Shriver stehen, schaute sich noch einmal sichernd um und zog dann Patronen aus den Schlaufen seines Gurts, um den schweren Navy-Colt nachzuladen. Er wusste, dass nun hinter seinem Rücken kein Unheil mehr drohte. Wenn hier im Indianerland ein schweres Volcanic-Büffelgewehr mit dröhnender Stimme zu reden begann, dann konnte man sicher sein, dass hinter dieser doppelläufigen Donnerbüchse ein kleiner, kauziger und vollkommen kahlköpfiger Bursche steckte, der mit allen Wassern dieses gefährlichen Territoriums gewaschen war.
Zwei Minuten später kehrte der Scout mit den beiden Tieren durch den Buschgürtel zu seinem Camp zurück. Dort sah er die Gestalt bereits vor der erkalteten Asche des Feuers hocken. Jacques Lafitte grinste nur auf einem Mundwinkel, während er auf der anderen Seite seine unvermeidliche, grässlich stinkende Meerschaumpfeife zwischen die Zähne geklemmt hatte. Sein großes Büffelgewehr hatte er gegen seine Schulter gelehnt. Während er so dahockte, überragte es ihn um mehrere Spannen. Aber man durfte sich dadurch nicht täuschen lassen, auch im Stehen erreichte Jacques Lafitte nur knapp die Höhe dieses furchtbaren Schießprügels, von dem die Sage ging, dass seine schweren Hartbleigeschosse selbst auf sechshundert Yards Entfernung den Schädel eines Bisons glatt durchschlagen konnten.
Lobo umstrich einen der getöteten Oglalas, schnaufte dann und kam herangetrottet. Auch er schien die Lage als geklärt zu betrachten, setzte sich vor dem kleinen Franco-Kanadier auf die Hinterbacken und schaute ihn mit schiefgelegtem Kopf an.
»Na, du verlauster Strolch«, feixte Jacques Lafitte. »Das wäre ja noch einmal gutgegangen. Du hast Glück, dass unser Freund Huskey noch nicht in der Nähe zu sein scheint. Der würde dich darauf taxieren, wie viele Steaks bei einem ausgewachsenen Burschen wie dir herauskommen.«
Lobo schien diese Anspielung kalt zu lassen. Seine Zunge fuhr über Nase und Lefzen hin, und dann zeigte er bei einem ausgiebigen Gähnen seine gelben Wolfszähne.
»Hopo, Tahunsa«, sagte Jacques Lafitte darauf in schönstem, breitem Cheyenne-Dialekt zu Youngblood Shriver. »Beeilen wir uns, Vetter! Es wird dir vielleicht noch gar nicht aufgefallen sein, aber unser Freund ›Mann-der-Knochen-bricht‹, ist uns durch die Lappen gegangen. Du hättest ein bisschen härter zuschlagen müssen, schätze ich. Ich sah gerade noch, wie er sich in die Büsche schlug. Immerhin, er torkelte, als ob er den Bauch voller Feuerwasser oder zu viel Peyote gekaut hätte. Was glaubst du, was er tun wird, wenn er seinen Verstand erst wieder richtig gebrauchen kann?«
Youngblood Shriver runzelte die Brauen. Er hatte tatsächlich noch nicht bemerkt, dass der Oglala-Unterhäuptling entkommen war. Bei jedem anderen Indianer hätte der Hieb mit dem Gewehrlauf genügt, um ihn zu töten oder wenigstens für Stunden oder Tage ins Reich der Träume zu befördern. »Mann-der-Knochen-bricht« schien allerdings über jene Konstitution zu verfügen, die schon sein Name verhieß.
»Nun«, beantwortete Shriver schleppend die Frage, »ich nehme an, in zwei Stunden können wir hundert heulende Oglala-Teufel auf dem Hals haben. Macht es dir unter diesen Umständen etwas aus, wenn ich dich nur zu einem kargen Frühstück einlade?«
Er ging zu der Packlast des Maultiers, die mitsamt dem Sattel am Boden lag, zog einen Beutel hervor und warf ihn dem Freund zu. Jacques Lafitte öffnete ihn ohne Zögern, entnahm ihm einen Streifen Pemmican und schob ihn zwischen die Zähne.
»Schönen Dank für die Einladung«, murmelte er kauend und schob seine Waschbärmütze ins Genick. »Aber bevor ich mir von einer Oglala-Streitaxt den Scheitel ziehen lasse, reite ich lieber mit leerem Magen oder betrüge meinen eigenen Bauch mit diesem Sohlenleder.«