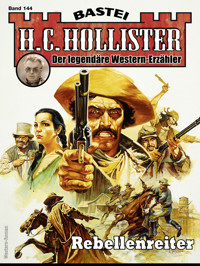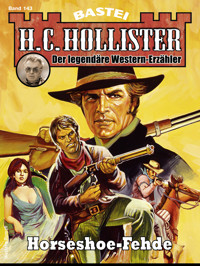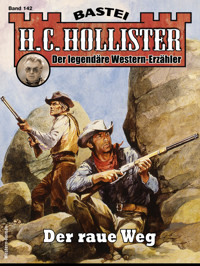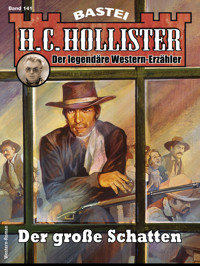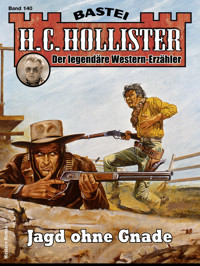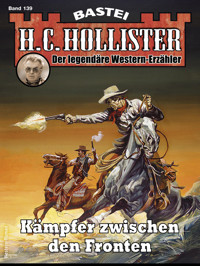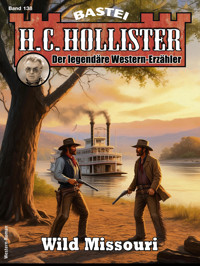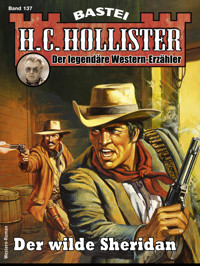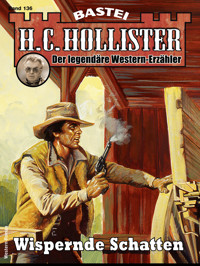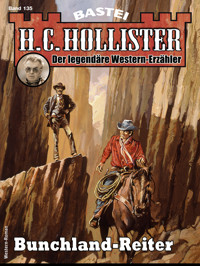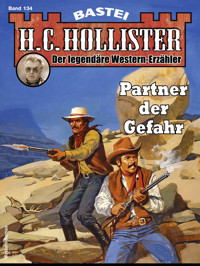1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sieben Jahre liegen die Auseinandersetzungen im Valle Verde zurück, aus denen Ambrose Donegal als mächtigster Mann der Stadt und des ganzen Beckens hervorgegangen ist. Nun ist er nicht nur ein angesehener Bürger und wohlhabender Bankier, sondern zugleich Eigentümer der Colina-Mine und der Star-D-Ranch. Die Vergangenheit glaubt er abgetan und vergessen. Da plötzlich taucht ein geheimnisvoller Reiter in Valle Verde auf und hinterlässt mehrere Anschläge, auf denen gegen den mächtigen Mann schwere Anklagen erhoben werden.
Ist dieser rätselhafte Reiter wirklich der Brigant, oder hat er nur die Rolle jenes mexikanischen Rebellen übernommen, von dem es heißt, er sei drüben in Mexiko während der Revolution hingerichtet worden? Mit seinen Anschlägen bringt er den Glauben an die Ehrenhaftigkeit Donegals ins Wanken und reißt einem skrupellosen Mörder und Betrüger die Maske vom Gesicht, bis er mit einem letzten entscheidenden Schlag den offenen Aufruhr entfesselt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
DER BRIGANT
Vorschau
Impressum
DER BRIGANT
Sieben Jahre liegen die Auseinandersetzungen im Valle Verde zurück, aus denen Ambrose Donegal als mächtigster Mann der Stadt und des ganzen Beckens hervorgegangen ist. Nun ist er nicht nur ein angesehener Bürger und wohlhabender Bankier, sondern zugleich Eigentümer der Colina-Mine und der Star-D-Ranch. Die Vergangenheit glaubt er abgetan und vergessen. Da plötzlich taucht ein geheimnisvoller Reiter in Valle Verde auf und hinterlässt mehrere Anschläge, auf denen gegen den mächtigen Mann schwere Anklagen erhoben werden.
Ist dieser rätselhafte Reiter wirklich der Brigant, oder hat er nur die Rolle jenes mexikanischen Rebellen übernommen, von dem es heißt, er sei drüben in Mexiko während der Revolution hingerichtet worden? Mit seinen Anschlägen bringt er den Glauben an die Ehrenhaftigkeit Donegals ins Wanken und reißt einem skrupellosen Mörder und Betrüger die Maske vom Gesicht, bis er mit einem letzten entscheidenden Schlag den offenen Aufruhr entfesselt ...
Für Valle Verde begann dieser Sonntag wie jeder andere mit dem Bimmeln der Missionsglocke. Es war ausschließlich der mexikanische Teil der Bevölkerung, der daraufhin jenen weißgetünchten Mauern zustrebte, die von einer kleinen Kuppel und einer langen Reihe dunkler Zypressen überragt wurden.
Sobald die kleine Glocke im Türmchen der Mission verstummte, wurde es auch für jene Bürger von Valle Verde Zeit, sich zum sonntäglichen Gottesdienst zu begeben, die sich aufgrund ihrer etwas helleren Hautfarbe als »echte« Amerikaner betrachteten.
Als auch die letzten Nachzügler im Schulgebäude verschwanden, wo der Gottesdienst abgehalten wurde, setzte das Harmonium zum Vorspiel eines Chorals an. Danach konnte man für die nächste Stunde ziemlich sicher sein, in den Straßen von Valle Verde keinem Menschen mehr zu begegnen.
Das schien auch der Mann zu wissen, der gerade zu diesem Zeitpunkt die weißen Mauern der Mission passierte und von Süden her in die Stadt ritt. Den Hut hatte er tief in die Stirn gezogen, so als ob er sich gegen die Strahlen der Sonne schützen wollte, die sich gerade über die felsigen Schroffen der Sierra Morena erhoben hatte.
Es handelte sich um einen mexikanischen Sombrero aus grauem Filz mit aufgebogenem Rand. Auch seine Kleidung war die eines Charros – die kurze knappsitzende Weste, die geschlitzte Hose und die Stiefel mit den großen Silbersporen. Die schwarzen, tief herabgezogenen Bartkoteletten des Reiters rahmten ein schmales, scharfgeschnittenes Gesicht ein, dessen dunkle Hautfarbe an Sattelleder erinnerte. Nur die graugrünen Augen, die wachsam die Straße entlangspähten, bildeten im Gesicht dieses hochgewachsenen Mexikaners einen merkwürdigen Kontrast. Und dann gab es da noch einen seltsamen Umstand: Die Kleidung des Reiters war ebenso grau wie das Fell seines hochbeinigen Wallachs.
Er lenkte den Grauen an den Holm des Alhambra Saloons. Swanky Calhoun, der Keeper des Saloons, saß an einem Tisch neben der Bar und nutzte die ruhige Stunde zu einem ausgiebigen Frühstück. Als die Schritte erklangen, schaute er zunächst gar nicht auf. Dann stand der Mann auch schon an der Bar und sagte mit hartem mexikanischem Akzent:
»Hola, amigo – geben Sie mir Tequila, por favor!«
Einen Moment lang war Swanky sprachlos. Ein Mexikaner war im Alhambra Saloon – das hatte es schon seit Jahren nicht mehr gegeben. In dieser Hinsicht waren Ambrose Donegals Anweisungen klar und unmissverständlich. Greaser hatten auf dieser Seite der Straße einfach nichts zu suchen. Für sie gab es im Mexikanerviertel zwei Cantinas und eine Bodega. Was führte dieser Vaquero im Schilde? Oder war er am Ende gar kein Vaquero? Es gab an der Grenze ziemlich viele Desperados.
Noch nie in seinem Leben hatte Swanky Calhoun einen mexikanischen Rinderhirten gesehen, der sich ganz in unauffälliges Grau kleidete. Also erhob er sich und schob sich hinter die Bar, zu jener Stelle, wo unter der Kasse die abgesägte Schrotflinte lag.
»Señor«, klang wieder die höfliche, aber sehr bestimmte Baritonstimme des Fremden, »der Tequila steht dort, soviel ich sehe.«
Swanky erstarrte und setzte ein leeres Grinsen auf. Während er dann nach der Flasche und einem Glas langte, schielte er über die Bar auf den Schenkel des Fremden, wo der mit Perlmutt eingelegte Kolben eines mattschimmernden Revolvers aus dem Halfter ragte.
»Natürlich, Caballero«, murmelte er vorsichtig. Dann nickte er und setzte hinzu: »Sie dürfen mich nicht falsch verstehen, Freund, ich selbst habe gar nichts gegen Mexikaner. Aber es hat sich hier nun mal so eingebürgert, dass diese Straßenseite den Americanos vorbehalten ist. Und ich habe keine Lust, von Ambrose Donegal hinausgefeuert zu werden. Deshalb schlage ich vor, Sie trinken Ihren Tequila und reiten dann ein Haus weiter, ehe Reverend McKeefe den Gottesdienst im Schulhaus beendet hat.
Der Fremde zeigte in einem blitzenden Lächeln die Zähne.
»Pardon, Señor«, murmelte er freundlich, »Ich wusste nicht, dass es in Valle Verde zwei verschiedene Arten von Americanos gibt. Aber warum sollte ich Ihnen Ungelegenheiten bereiten ...«
»Nicht wahr«, sagte Swanky Calhoun erleichtert. Dann starrte er den Fremden an und setzte grübelnd hinzu. »Kann es sein, dass wir uns schon einmal begegnet sind, amigo?«
»Quien sabe?« Der Fremde hob die Schultern und hielt seinem forschenden Blick gelassen stand. »Vielleicht – wenn Sie in den letzten Jahren einmal drüben in Mexiko waren, in Sonora.«
Der Name dieser mexikanischen Nordprovinz schien Swanky Calhoun zu faszinieren. Er presste betroffen die Lippen aufeinander und sein Blick wurde noch starrer als zuvor, als er erwiderte:
»In Sonora? Ich bin nur ein einziges Mal drüben gewesen, und das war noch vor der Revolution.«
»Das ist dann viele Jahre her«, sagte der Fremde mit undurchschaubarem Lächeln. »Gegen Ende der Revolution war es doch, als Señor Ambrose Donegal hier in Valle Verde auftauchte, nicht wahr?«
»Jetzt weiß ich es«, stieß der Keeper mit einem scharfen Atemzug hervor. »Sie sind ...«
Mit einer herrischen Geste schnitt der Fremde ihm das Wort ab.
»Wenn Sie es wissen, dann behalten Sie es besser für sich, amigo«, erwiderte er mit gefährlicher Sanftheit. »Señor Ambrose Donegal liebt es nicht, wenn seine Leute zu viel reden. Oder irre ich mich?«
Swanky Calhoun blieb die Antwort auf diese Frage schuldig.
Der Mann mit dem braunen, scharfgeschnittenen Gesicht zog einen Goldpeso aus der Tasche, aber der Keeper wehrte ab:
»Schon gut, Don José. Halten Sie sich damit nicht auf. Sie waren mein Gast.«
»Gracias.«
»Und Sie bekommen sogar noch etwas kostenlos, Señor – einen guten Rat: Verschwinden Sie aus Valle Verde, ehe es zu spät ist. Gewöhnlich kommen ungefähr um diese Zeit die Burschen von der Star-D-Ranch in die Stadt. Ich bin sicher, Brian Marvin und Ringo Healy würden bei einigem Nachdenken das Gesicht vom Steckbrief ebenso wiedererkennen wie ich, auch wenn es damals hieß, Sie wären von einem Erschießungspeloton der Juaristas an die Wand gestellt worden, Don José de Rochas. Um mich brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Ich habe den Briganten nicht gesehen und erst recht nicht erkannt.«
Die Bezeichnung »Brigant« rief auf dem schmalen, gebräunten Gesicht des Fremden ein Lächeln hervor. Ein Brigant war ein Rebell, ein Aufrührer und ein Räuber zugleich. Es hatte an den Zeitumständen gelegen, dass man Don José de Rochas damals diesen Namen gegeben hatte. Denn als Rebellen betrachtete man zu dieser Zeit alle Mexikaner, die sich auf die Seite des Präsidenten Benito Juarez gestellt hatten, aber auch jene Banditen und Desperados, welche die Revolution nur als willkommene Gelegenheit betrachteten, um unter dem Deckmantel des Patriotismus eine althergebrachte Ordnung zu stürzen und sich selbst zu bereichern.
Man brauchte nicht unbedingt ein Gegner der Revolution zu sein, um damals den Horden des »Generals« Manolo Villafranca entgegenzutreten. Wie aber hätte man einen Mann nennen sollen, der in der Nähe der Grenze den aussichtslosen Kampf gegen diese angeblichen Rebellen aufnahm? Der Name »Brigant« war ganz einfach ein Genieblitz. Niemand wusste, wer ihn zuerst gebraucht hatte. Es war der Name, unter welchem Don José de Rochas weit über die Grenzen von Sonora hinaus bekannt wurde.
Er selbst und seine Bravos hatten sich nicht immer an diese Grenze gehalten und zuweilen auch auf dem Boden der Staaten operiert, wenn es darum ging, illegale Waffentransporte und andere Versorgungsgüter für die Horden des »Generals« Manolo Villafranca abzufangen. Es war dabei nicht immer ganz harmlos zugegangen, und so war eines Tages auch in den Staaten ein Steckbrief gegen jenen Mann erlassen worden, der gegen die Horden Villafrancas einen verzweifelten und aussichtslosen Kampf führte.
Lange Zeit hatte er sich jeder Verfolgung entziehen können. Der Brigant war wie ein Schemen und tauchte mit seinen wenigen Getreuen immer dort auf, wo ihn seine Gegner am wenigsten erwarteten. Bei der mexikanischen Bevölkerung wurde er zum Helden ungezählter Legenden, und zweifellos war es auch der Unterstützung durch diese Menschen zu verdanken, dass er seinen Verfolgern immer wieder entschlüpfte. Der »General« Manolo Villafranca hatte geschäumt, weil er in Don José de Rochas ganz richtig ein Symbol des Widerstands gegen seine Banditenherrschaft in Sonora sah. Und irgendwann, so hieß es, war ihm der Brigant dann wirklich ins Netz gegangen. Gerüchteweise verlautete, dass er von den »Truppen« Villafrancas überrascht und in der Nähe der Grenze zusammen mit einigen seiner Männer erschossen worden sei. Bei den Mexikanern aber blieb das Gerücht im Umlauf, dass Villafranca den Falschen erwischt hätte und dass der echte Don José de Rochas immer noch am Leben sei.
Angeblich hätte er die Nachricht von seiner Erschießung nur benutzt, um zeitweise von der Bildfläche zu verschwinden. Doch auch das lag nun bereits Jahre zurück.
Der Fremde beruhigte den Keeper: »Sie dürfen mich getrost gesehen und erkannt haben, denn das wird in den nächsten Tagen noch manchem anderen so ergehen. – Hasta la vista, Señor.«
Swanky Calhoun wollte den Abschiedsgruß erwidern, doch das Wort blieb ihm in der Kehle stecken. Er starrte dem schlanken Mexikaner sprachlos nach, als jener sich draußen in den Sattel eines hochbeinigen grauen Wallachs schwang. Am Zaun des Schulhauses hielt der graue Reiter einen Moment an. Er öffnete eine seiner Satteltaschen, brachte ein zusammengefaltetes Papier zum Vorschein und glättete es auf seinem Schenkel. Geschmeidig beugte er sich aus dem Sattel. Sekunden später jagte der Grauschimmel in schwingendem Galopp nach Osten, hinüber zu den Vorhügeln der Sierra Morena. Am Zaun vor dem Schulhaus blieb ein auffallendes Plakat zurück.
Der Keeper des Alhambra Saloons rannte hinüber und las:
KEINE NOCH SO EHRENWERTE MASKE WIRD DEN VERRÄTER VOR SEINER STRAFE SCHÜTZEN. AUCH SAUL SAXON UND CARLOS PEREZ WAREN EHRENWERTE MÄNNER. IHRE MÖRDER HAT DAS NICHT GEKÜMMERT. UND DARUM WIRD AUCH ER KEINE GNADE FINDEN! – AMBROSE DONEGAL – FÜRCHTE DIE GERECHTIGKEIT!
DER BRIGANT
Der Keeper stand noch immer reglos am selben Fleck und starrte das Plakat an, als die Menschen aus dem Schulhaus kamen. Aber dann drängten die ersten heran, lasen das Plakat und bestürmten Swanky mit ihren Fragen. Immer größer wurde die Gruppe. Bis sich schließlich Morton Durkeye, der Marshal von Valle Verde, mit rudernden Armbewegungen Platz verschaffte und sich bis an den Zaun durchkämpfte.
Morton Durkeye war ein großer, starkknochiger Mann mit einem sandfarbenen Robbenbart. Sein stumpfer Gesichtsausdruck und die Schwerfälligkeit seiner Bewegungen täuschten leicht darüber hinweg, dass er ein gefürchteter Revolvermann war. Unter den Besuchern des Gottesdienstes war er denn auch der Einzige, der seinen Waffengurt nicht abgelegt hatte. Denn bei dem Hüter des Gesetzes konnte nicht einmal Reverend Gilbert McKeefe umhin, ein Auge zuzudrücken, obwohl die beiden schweren Peacemaker-Colts des Marshals beim besten Willen nicht zu übersehen waren.
Vor dem Plakat allerdings löste sich die grimmige Miene Morton Durkeyes in Hilflosigkeit auf. Sein Gesicht lief dunkel an, und der steife Kragen seines Sonntagshemds schien ihm plötzlich zu eng zu werden. Als ob er Unterstützung suchte, wandte er den Kopf und schaute auf den Bankier Ambrose Donegal, der nun erst aus der Tür des Schulhauses trat, seine Handschuhe überstreifte und seinen grauen Bowler aufsetzte.
Donegal war im Begriff, noch ein paar Worte mit Reverend McKeefe zu wechseln, doch die plötzliche Stille machte ihn aufmerksam. Seine Lippen spannten sich. Achtlos ließ er McKeefe stehen und ging mit kurzen, ungeduldigen Schritten zum Zaun hinüber. Augenblicklich öffnete sich vor ihm eine Gasse.
Ambrose Donegal war nun etwas über mittelgroß. Im Verhältnis zu seinem gedrungenen Rumpf und den massigen Schultern wirkten seine Beine viel zu kurz. Seine Kleidung war von städtischem Zuschnitt und sollte offenbar das Bild eines erfolgreichen Selfmade-Mannes abrunden, aber in diesem Punkt hatte Ambrose Donegal etwas zu dick aufgetragen. Was seiner Erscheinung fehlte, war die Solidarität. Ambrose Donegal nahm es wie selbstverständlich hin, dass man ihm Platz machte, und trat neben den Marshal.
Die Auffassungsgabe des mächtigsten Mannes im Valle Verde war zweifellos ausgeprägter als die von Morton Durkeye. Wenige Sekunden genügten ihm, um das Plakat zu überfliegen. Es zeugte von einem erstaunlichen Grad von Selbstbeherrschung, dass kein Muskel in seinem Gesicht zuckte. Nur seine Lider senkten sich halb über die Augen, als er mit sanfter, beinahe schleimiger Stimme fragte:
»Was soll das, Durkeye?«
»Ein Witz«, stieß der Marshal rau hervor. »Das ist ein ganz verrückter Witz, wenn ich den Burschen erwische, der ...«
»Und wie ist das Ding dorthin gekommen?«, unterbrach ihn Ambrose Donegal gereizt.
Morton Durkeye richtete die Blicke drohend auf Swanky Calhoun.
»Du«, sagte er heiser. »Du warst nicht im Schulhaus. Hast du etwas gesehen?«
Der Keeper zog den Kopf ein.
»Ein Reiter«, erwiderte er nach einem Räuspern. »Ein graugekleideter Mexikaner auf einem grauen Pferd. Ich möchte schwören, dass es der Brigant gewesen ist. Wenn er es nicht war, dann muss es der Teufel selbst gewesen sein. Ich wollte sehen, wohin er ritt, aber er hat sich einfach in Luft aufgelöst.«
»Unsinn!«, fauchte Ambrose Donegal scharf. »Der Teufel war es nicht, und dieser Greaser-Desperado, den man Brigant nannte, ist seit mehr als sechs Jahren tot.«
Morton Durkeye nickte, doch dieses Nicken fiel nicht allzu überzeugend aus. Wie groß seine Zweifel tatsächlich waren, bewies seine nachfolgende Frage:
»Aber wer soll es dann gewesen sein?«
Die Gereiztheit Ambrose Donegals trat in seinem gekünstelten Lachen noch deutlicher hervor.
»Wer schon? Irgendein Greaser natürlich, der Unruhe stiften will. Jedermann in Valle Verde weiß doch, wie unbeliebt ich mich bei diesem Pack gemacht habe. Und nun möchte ein gerissener Bursche durch so lächerliche Anschuldigungen die Öffentlichkeit gegen mich aufbringen. Oder glaubt hier jemand im Ernst an einen solchen Unsinn?«
Auf eine derartige Frage konnte man keine Antwort befürchten, das war Ambrose Donegals Überzeugung. Deshalb war er überrascht, als plötzlich eine beherrschte Altstimme sagte:
»Wir wissen zu wenig, um etwas glauben zu können, Mr. Donegal. Tatsache ist jedenfalls, dass heute Sie der Besitzer der Colina-Mine sind, die einmal meinem Vater und Carlos Perez gehörte.«
Der Bankier starrte das Mädchen mit zusammengezogenen Brauen an.
»Allerdings«, sagte er gepresst. »Die Colina-Mine gehört jetzt mir. War das alles, Miss Saxon, oder haben Sie noch mehr zu sagen?«
Sein schneidender, bösartiger Tonfall prellte wirkungslos an Stella Saxons unbewegtem Gesicht ab.
»Nein«, versetzte sie kalt, »im Augenblick nicht, Mr. Donegal.«
»Dann wäre es besser gewesen, Sie hätten ganz geschwiegen, Miss«, schnaufte der Bankier. »Sie haben jene Zeiten hier an der Grenze nicht miterlebt. Aber vielleicht haben Sie seitdem wenigstens erfahren, dass nur durch meine Aktivität damals der Mörder Ihres Vaters zur Strecke gebracht wurde.«
Stella Saxon ordnete die Bänder ihres Schutenhuts, die unter ihrem Kinn zu einer Schleife geknüpft waren. Mit schmalen Lippen schaute sie den Bankier an, und dann ging sie davon, ohne noch ein Wort gesagt zu haben. In den Mienen der anderen ließ sich erkennen, dass dieser Abgang weit wirkungsvoller war, als wenn sie sich zu konkreten Anschuldigungen hätte hinreißen lassen. Auch Ambrose Donegal schien das zu begreifen, denn sein Gesicht lief dunkel an, während er dem schlanken Mädchen in einer hilflosen Zornesaufwallung nachblickte. Bei der Suche nach einem Sündenbock kam ihm Morton Durkeye gerade recht.
»Zum Teufel, wie lange willst du das Ding noch hängen lassen?«, fauchte er den Marshal an. Dann warf er ihm einen giftigen Blick zu und fuhr in mühsam bewahrter Selbstbeherrschung fort: »Wir werden später noch darüber reden.«
Morton Durkeye riss das Plakat vom Zaun und rollte es zusammen.
»Kein Grund zur Aufregung, Leute«, wandte er sich bärbeißig an die Umstehenden. »Wir werden diesem geheimnisvollen Greaser schon auf die Schliche kommen – viel schneller vielleicht, als er sich das vorgestellt hat.«
✰✰✰
Einer der Wagen, die unter den staubigen Cottonwoods neben dem Store abgestellt waren, gehörte Don Luis Velasco und seiner Schwester Elena. Als die Geschwister von der Mission die Straße heraufkamen, wurden sie von zwei Vaqueros der Hazienda Herradura begleitet. Am Rande der Plaza trafen sie mit Stella Saxon zusammen. Der junge Don Luis und die beiden Vaqueros zogen achtungsvoll die Hüte, während Dona Elena das Mädchen herzlich begrüßte. Noch immer war Stella Saxon ihrer Erregung nicht ganz Herr geworden. Ihre Augen blitzten, und auch das Zucken ihrer Lippen verriet ihre Gemütsbewegung, als sie rasch und ohne Zögern von dem Vorfall berichtete.
»Der Brigant?«, fragte Don Luis Velasco mit einem scharfen Atemzug. »Por Dios, wer ist dieser Mann? Ist er denn überhaupt gesehen worden?«
Stella Saxon maß ihn mit einem skeptischen Blick.
»Doch, Don Luis«, erwiderte sie. »Swanky Calhoun aus dem Alhambra Saloon sagte, dass er ihn gesehen hat, einen graugekleideten Reiter auf einem grauen Pferd. Und so viel ich darüber gehört habe, war das doch die Kleidung, die jener Don José de Rochas bevorzugte, nicht wahr?«
»Das stimmt, Señorita Stella«, gab der junge Haziendero mit unbewegter Miene zurück.
»Und?«, fragte das Mädchen. »Ist der Brigant damals von den Banditen in Sonora erschossen worden oder nicht?«
Auch Elena Velasco schaute nun ihren Bruder an, während sich die beiden Vaqueros mit steinernen Gesichtern im Hintergrund hielten.
»Luis«, sagte sie drängend, »was weißt du darüber?«
»Nicht mehr als jeder andere«, antwortete ihr Bruder und hob die Schultern. »Warum fragt ihr mich?«
Stella Saxon erwiderte impulsiv:
»Nun, das ist vielleicht auch gleichgültig. Wer immer dieser Mann sein mag, er hat meine volle Sympathie.«
In einer plötzlichen Aufwallung wandte sie sich an Elena Velasco und setzte hinzu: »Du weißt, dass ich noch nie an jene Geschichte geglaubt habe, dass mein Vater und Carlos Perez wirklich einem Anschlag eurer Leute zum Opfer gefallen sind. Und ich glaube schon gar nicht, dass dein Vater, Don Cristobal Velasco, etwas damit zu tun gehabt haben könnte, obwohl er später deswegen umgebracht wurde.«
Plötzlich schimmerte es feucht in den Augen Elena Velascos.
»Er war wirklich ein Edelmann, Stella«, erwiderte sie mit erstickter Stimme, »und der gütigste Mensch, den ich je gekannt habe. Das sage ich nicht nur, weil er mein Vater gewesen ist. Ich weiß, dass er damals Saul Saxon und Carlos Perez gegen eine Beteiligung von zehn Prozent die Erlaubnis erteilt hat, im ganzen Valle Verde nach Gold zu schürfen. Er hat den beiden Männern die Genehmigung sogar schriftlich gegeben, auch wenn dieses Dokument später nie mehr aufzufinden war. Er hatte also keinen Grund, die beiden Männer zu hassen. Wohl aber könnte Ambrose Donegal sie gehasst haben, denn dadurch, dass sie sich wegen der Schürfrechte an meinen Vater wandten, haben sie den Besitzanspruch der Velascos auf das ganze Valle Verde anerkannt.«