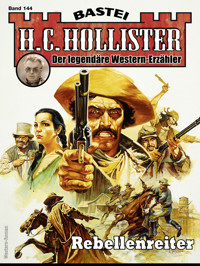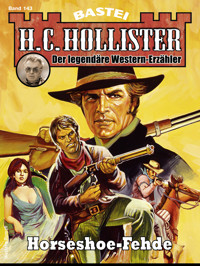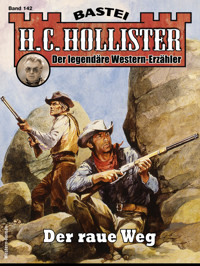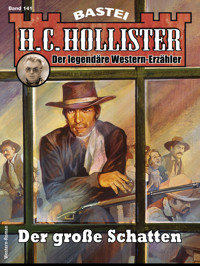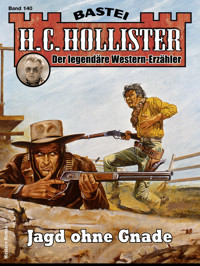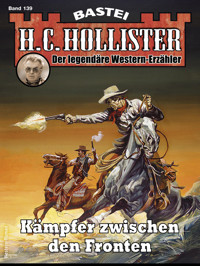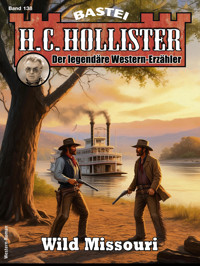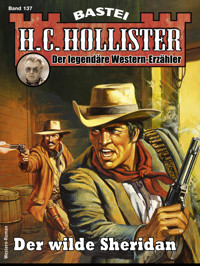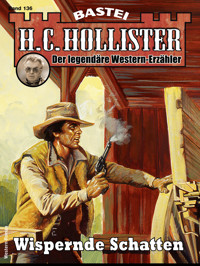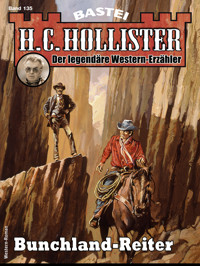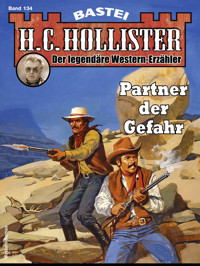1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Clyde Warwick gehört zur Brushdevil-Mannschaft, einem zusammengewürfelten Rudel hartgesottener Burschen, die unter Einsatz ihres Lebens wilde Ladino-Rinder jagen. Erst nach vier Monaten stellt sich heraus, dass ihn etwas anderes als nur der Wunsch nach einem gutbezahlten Job in das gesetzlose Land westlich des Pecos getrieben hat: Er forscht nach einem Mann, der ein Jahr zuvor denselben Weg gegangen ist.
Nur durch einen Zufall erfährt der Mannschaftsboss von diesen Nachforschungen. Vom selben Augenblick an ist Clyde Warwick seines Lebens nicht mehr sicher. Kurz nacheinander werden zwei Mordanschläge auf ihn verübt. Dem ersten entgeht er nur durch seine Gewandtheit. Dem zweiten fällt durch einen Irrtum sein junger Freund Sandy zum Opfer. Für Clyde gibt es keinen Zweifel mehr, dass er sich auf der richtigen Fährte befindet. Er nutzt die Verwechslung des Mordschützen, um von der Bildfläche zu verschwinden. Während seine geheimnisvollen Gegner glauben, sich seiner mit Erfolg entledigt zu haben, befindet er sich als angeworbener Revolverkämpfer der Barranca-Ranch auf dem Weg ins Guadalupe-Becken ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
DER REBELL AUS DEN LLANOS
Vorschau
Impressum
DER REBELL AUS DEN LLANOS
Clyde Warwick gehört zur Brushdevil-Mannschaft, einem zusammengewürfelten Rudel hartgesottener Burschen, die unter Einsatz ihres Lebens wilde Ladino-Rinder jagen. Erst nach vier Monaten stellt sich heraus, dass ihn etwas anderes als nur der Wunsch nach einem gutbezahlten Job in das gesetzlose Land westlich des Pecos getrieben hat: Er forscht nach einem Mann, der ein Jahr zuvor denselben Weg gegangen ist.
Nur durch einen Zufall erfährt der Mannschaftsboss von diesen Nachforschungen. Vom selben Augenblick an ist Clyde Warwick seines Lebens nicht mehr sicher. Kurz nacheinander werden zwei Mordanschläge auf ihn verübt. Dem ersten entgeht er nur durch seine Gewandtheit. Dem zweiten fällt durch einen Irrtum sein junger Freund Sandy zum Opfer. Für Clyde gibt es keinen Zweifel mehr, dass er sich auf der richtigen Fährte befindet. Er nutzt die Verwechslung des Mordschützen, um von der Bildfläche zu verschwinden. Während seine geheimnisvollen Gegner glauben, sich seiner mit Erfolg entledigt zu haben, befindet er sich als angeworbener Revolverkämpfer der Barranca-Ranch auf dem Weg ins Guadalupe-Becken ...
Clem Markey zahlte gut und knauserte nicht mit Prämien. Das war der Grund, weshalb er sich unter den rauen und hartgesottenen Reitern des Pedrera-Buschlands die härtesten heraussuchen konnte. Es schien ihn wenig zu stören, dass die meisten von ihnen darüber hinaus noch weiteren Anlass hatten, der Zivilisation zeitweilig den Rücken zu kehren. In der Big Bend nahm man solche Dinge mit einem Achselzucken hin. Wenn ein Mann dringend eine Luftveränderung brauchte, dann ging er über den Pecos. Das war seit undenklichen Zeiten so gewesen und würde auch noch eine Weile so bleiben.
Man nannte sie Ropers, Maverickers oder auch die Buschteufel-Mannschaft. Und sicherlich konnte man mit Recht behaupten, dass es die hartgesottenste Crew war, die sich jemals zwischen den Guadalupes, den Pedreras und dem Rio Bravo herumgetrieben hatte. Nur ein besonders zäher Typ von Männern überstand die Strapazen einer viermonatigen Maverickjagd im Dornbusch und in der felsigen, sonnendurchglühten Einöde. Möglicherweise lag es daran, dass die Mannschaft sogar von der berüchtigten Horde des Grenzbanditen Mariolo unbehelligt blieb, die irgendwo in diesem unwegsamen Gebiet ihren Schlupfwinkel haben sollte.
Vier Monate hatte auch Clyde Warwick dieses harte Leben durchgehalten, obwohl ihm anfänglich die Jagd auf Wildrinder im undurchdringlichen Dornengestrüpp Schwierigkeiten bereitet hatte. Es gab Burschen in der Mannschaft, die in der Nueces-Brasada aufgewachsen waren und behaupteten, zum Buschlandreiter müsse man geboren sein. Innerhalb der ersten sechs Wochen der Jagd hatte Clyde Warwick diese Ansicht widerlegt. Man wusste, dass er irgendwo aus dem Llano Estacado stammte, von einer Weide also, die sich mit dem Bosque Grande auch nicht im Entferntesten vergleichen ließ, und dass er im Gegensatz zu den meisten anderen am Krieg teilgenommen hatte. Das hatte ihm den Namen »Rebell aus den Llanos« eingetragen. Nach weiteren Einzelheiten fragte man nicht. Nicht westlich des Pecos und nicht in Clem Markeys Buschteufel-Mannschaft.
Siebzehn Männer waren mit Clem Markey von Fort Davis aufgebrochen. Jetzt waren noch dreizehn davon am Leben. Jeder Monat im Buschland hatte seinen Tribut gefordert.
Ein paarmal war das Camp in diesen Monaten verlegt worden, vom Rand des Bosque Grande hinüber an die steinigen Felshänge der Pedreras und schließlich zu den Schroffen der Horseshoe Ridge, die sich aus einer wildzerklüfteten Umgebung von Canyons, buschbedeckten Hügelflanken und heimtückischen Arroyos wie ein gigantisches Hufeisen erhob. Annähernd fünfhundert »Brushdevils« waren die Ausbeute. Buschteufel nannte man diese ungezähmten Rinder wegen ihrer Wildheit. Nicht nur die Stiere, sondern auch die Kühe legten eine Angriffslust an den Tag, die das Einfangen der Tiere zu einem riskanten Abenteuer machte.
Obwohl Clem Markey gute Löhne zahlte und mit Prämien nicht knauserig war, befand er sich stets in der Lage, die Preise der Viehzüchter zu unterbieten und den Lieferauftrag der Indianeragentur wegzuschnappen. Das ging nun schon seit Jahren so, und noch war nicht abzusehen, wann das Pedrera-Buschland endlich von Brushdevils leer sein würde. Aber selbst wenn dieser Zeitpunkt schon in wenigen Jahren kommen sollte, würde Clem Markey ein wohlhabender Mann sein, dessen Schecks schon jetzt in allen Saloons, Spielhöllen und Stores zwischen El Paso und dem Pecos River in Zahlung genommen wurden.
In der letzten Woche vor dem Abschluss der Brushdevil-Jagd gab es im Camp kein anderes Thema mehr als die Genüsse, mit denen Fort Davis aufwarten konnte – Whisky, ein scharfes Spiel und die Gesellschaft zweifelhafter Frauen, von denen jeder wusste, dass sie nur an solchen Verehrern interessiert waren, in deren Taschen Dollars klimperten oder Lohnschecks knisterten.
Clyde Warwick war einer der wenigen, die sich von so schwülstigen Gesprächen und Phantastereien fernhielt. Anfänglich war der Rebell aus den Llanos die Zielscheibe vielfältiger Spötteleien gewesen. Nach einigen Wochen jedoch war darin eine Wandlung eingetreten – genauer gesagt seit jenem Tag, da Clyde Warwick mit den beiden Sattelpartnern seiner Crew fünf Brushdevils, darunter zwei Stiere, eingebracht hatte. Diesen Rekord hatten sie danach nicht wieder erreicht, aber auch von den anderen Crews war er nicht geschafft worden, obwohl man den Burschen ihren Neid auf die Höchstprämie von den verwegenen Gesichtern ablesen konnte. So war aus dem mitleidigen Spott ein widerwilliger Respekt geworden, der sich noch steigerte, nachdem Clyde Warwick einen Faustkampf mit Lew Cabot bestanden hatte.
Lew Cabot war ein stiernackiger, muskulöser Kerl mit einer breiten, verunstalteten Nase und kleinen, glitzernden Knopfaugen, dessen Boshaftigkeit ihn zu einem Giftpilz stempelte. Obwohl Clem Markey keinen Whisky im Camp duldete, befand sich Lew Cabot zuweilen in einem Zustand, der gemeinhin nur durch den Genuss einer halben Flasche Brandy hervorgerufen wurde. Lange Zeit blieb sein Versteck geheim, bis endlich der Koch zuunterst in einer Kiste mit Dörrpflaumen eine Lage Flaschen entdeckte, von denen zwei noch gefüllt waren.
Clyde Warwick, der ausgerechnet an diesem Tag zum Küchendienst abgestellt war, hatte auf Befehl Clem Markeys diese beiden Flaschen an den Felsen hinter dem Camp zerschmettert. Das genügte, um ihm Lew Cabots unauslöschlichen Hass einzutragen. Von Stund an hatte der stiernackige Bursche keine Gelegenheit ausgelassen, ihm üble Streiche zu spielen. Die lebende Viper in seinen Decken hatte Clyde Warwick hingenommen. Eines Morgens, als er sein Pferd sattelte, hatte der weißgraue Percheron-Wallach sich aufgebäumt und gekeilt. So entdeckte Clyde Warwick in beiden Sattelpauschen messerscharfe Dolchdornen. Es handelte sich um eines der heimtückischsten Gewächse des Pedrera-Buschlands. Wenn diese Dornen einem Pferd durch das Fell ins Fleisch drangen, dann riefen sie schmerzende Wunden hervor, die nur sehr langsam verheilten und das Tier wochenlang peinigten.
Die Dolchdornen brachten Warwicks Galle zum Überlaufen, zumal die Niedertracht dieses Anschlags deutlich auf den Täter hinwies. Er hatte die Dornen entfernt, den Percheron-Wallach beruhigt und zu Ende gesattelt. Aber als dann Lew Cabot zum Korral kam, war er ihm mit steinerner Miene entgegengetreten und hatte ihn mit einem Fausthieb ohne jede Warnung in den Staub gestreckt. Fünf Sekunden später war Lew Cabot wieder auf den Beinen. Und dann begann der Faustkampf, der den rauen Burschen der Brushdevil-Mannschaft noch einen vollen Monat später Gesprächsstoff bot. Einen Sieger hatte es in diesem Kampf nicht gegeben. Nach dem letzten Schlagabtausch hatte Lew Cabot mit dem Gesicht im Staub gelegen und sich mühsam auf Knie und Ellenbogen emporgestemmt, während Clyde Warwick an einem Korralpfosten kauerte und mit hängenden Armen gierig die Luft einsog.
Dann hatte Clem Markey der Prügelei ein Ende gemacht – überflüssigerweise eigentlich, weil ohnehin keiner der beiden Gegner mehr in der Lage gewesen wäre, den Kampf fortzusetzen. Aber immerhin war Clyde Warwick eine halbe Stunde später aufgesessen und mit Sandy Rickett und Ezra Stevens, den beiden Sattelpartnern seiner Crew, davongeritten. Lew Cabot hingegen hatte die beiden nächsten Tage im Camp zugebracht. Niemand von den anderen erfuhr, dass auch Clyde Warwick den Vormittag nach dem Kampf an einem Wasserloch im Bosque Grande verschlief, während seine Partner allein auf die Jagd nach Brushdevils gingen. Der Rebell aus den Llanos hatte den Beweis seiner Zähigkeit und seiner Entschlossenheit erbracht und blieb fortan ungeschoren. Lew Cabot ging ihm aus dem Weg und hatte seither kein Wort mehr mit ihm gewechselt.
Für den schweigsamen, struppigen Hünen Ezra Stevens und den gerade erst zwanzigjährigen Youngster Sandy Rickett war diese Bewährung nicht überraschend gekommen. Sie, die zusammen mit Clyde Warwick eine Crew bildeten, hatten beobachten können, wie sich der Rebell aus den Llanos innerhalb weniger Wochen zu einem zähen Buschlandreiter entwickelte. Obwohl im Wesen grundverschieden, waren sie ohne viele Worte zu einer verschworenen Crew zusammengewachsen und hatten sich auf die Eigenheiten des anderen eingestellt.
Ezra Stevens war ein verschlossener Mann. Er war schwerfällig und bedachtsam, dabei jedoch von einer grimmigen Beharrlichkeit, soweit es ihre Aufgabe hier im Pedrera-Buschland betraf. Einem Risiko, zu dem der verwegene Sandy Rickett jederzeit aufgelegt war, ging er nach Möglichkeit aus dem Weg. Zwei Ladino-Stiere hatte er mit seinem alten Peacemaker-Colt erschossen, als es kritisch zu werden drohte, einen davon gerade in dem Moment, als Clyde Warwick den mooshornigen Burschen bereits in der Schlinge hatte und ihn mit einer raschen Schwenkung seines Wallachs zu Boden reißen wollte. Aber stattdessen war Clyde Warwick bei dem wilden Ruck der Sattelgurt gerissen. Er war gestürzt. Sein weißgrauer Percheron war dem Pferd Sandy Ricketts in die Flanke gekracht.
Bei dem jähen Sprung seines Rehbraunen war dann auch Sandy von dem knorrigen, überhängenden Ast einer Pechfichte aus dem Sattel gefegt worden. Sekunden später aber schnaubte der gereizte Brushdevil mit gesenktem Schädel heran. Welchen der beiden Männer er zuerst auf seine gefährlichen Hörner genommen hätte, ließ sich später nicht mehr entscheiden. Erst nach drei Schüssen aus Ezra Stevens schwerem Colt war der Bulle auf der Vorderhand eingebrochen und hatte eines seiner Hörner in den von der Sonne hartgebackenen Boden gebohrt. Trotz dieser Rettung aus höchster Not hatte der zungenfertige Sandy Rickett lästerlich geflucht, weil ihr Sattelpartner mit seinen Schüssen den Erfolg einer dreistündigen Jagd zunichte gemacht hatte.
So war Randy Rickett, schnodderig, unbekümmert und verwegen bis zum Wahnwitz. Man hätte sich keinen größeren Gegensatz vorstellen können als zwischen dem Youngster der Crew und Ezra Stevens. In einem Punkt allerdings, das hatte Clyde Warwick feststellen können, stimmten sie überein: Am Abend überfiel sie die Melancholie. Sandy Rickett hockte dann gewöhnlich in der Astgabel einer Steineiche nahe beim Creek und spielte auf seiner Mundharmonika, während sich Ezra Stevens beim Küchenwagen auf eine Kiste setzte und ein speckiges, abgegriffenes Buch hervorkramte. Beim Lesen trug er eine Brille. Mit ihr sah er aus wie ein alter Mann, und sein Gesichtsausdruck zeigte Gram und Zerknirschung, sobald er sich unbeobachtet fühlte. Clyde Warwick hatte ihn nie nach dem Buch gefragt, er nahm stillschweigend an, dass es sich um die Bibel handelte.
✰✰✰
Clem Markey stand neben dem Chuckwagon, als sie am Abend des letzten Jagdtages ins Camp zurückkehrten und die Pferde in den Korral entließen. Er kam herüber, als Clyde Warwick gerade seinen Sattel aufbockte, die dicken Lederchaps von seinen Hüften rutschen ließ und steifbeinig herausstieg.
»Wieviel?«, fragte der Mannschaftsboss gleichmütig und zog das Zählbuch aus der Tasche seiner abgewetzten Jacke.
Clyde Warwick hob den Kopf. Sein Gesicht war fast so dunkel wie das Sattelleder und bildete einen erstaunlichen Kontrast zu seinem Schläfenhaar, das die Sonne fahl gebleicht hatte. Sein Verhältnis zu Clem Markey war nie besonders herzlich gewesen, eher nüchtern und geschäftsmäßig. Er hatte Markey auch wenig Gelegenheit gegeben, ihm Befehle zu erteilen. Und Clem Markey wusste es zu schätzen, wenn ein Mann auch ohne Befehle wusste, was er zu tun und zu lassen hatte.
»Zwei«, sagte Clyde Warwick und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. »Eine Kuh und ein Jungrind. Das ist nicht viel. Wir haben zwei Stunden damit vergeudet, den dazugehörigen Stier zu jagen. Aber der Bursche war zu flink. Er ist uns in die Lavafelder entkommen.«
Ezra Stevens und Sandy Rickett kamen hinzu. Sie warfen die schweren Breeches aus Rohleder zu Boden, welche die Pferde im Dornbuschland als Brustpanzer trugen.
Der Mannschaftsboss leckte seinen Kopierstift an und machte eine Eintragung.
»Nicht viel, aber es reicht«, sagte er befriedigt. »Damit kommen wir auf vierhundertdreiundneunzig Häupter, und ihr behaltet die Spitze. Die nächste Crew liegt mit sechs Stück zurück.«
Sandy Rickett stieß einen schrillen, gellenden Schrei aus, der Clem Markey mit gerunzelten Brauen zusammenzucken ließ. Doch dann grinste der Mannschaftsboss über diesen Temperamentsausbruch, besagte doch seine Bemerkung, dass die Crew neben ihrem Anteil an der Gesamtprämie nicht nur die Prämie für die beste Tagesleistung, sondern auch jene für die erfolgreichste Crew erhalten würde. Nur die Wochenprämie war an Jason Starling, Lew Cabot und Jay Quigby gefallen. Insgesamt würde der Prämiensegen für Clyde Warwick und seine beiden Sattelgefährten noch einmal die Höhe des Lohnes erreichen.
Schwankend und mit glasigen Augen kam Jay Quigby vom Camp zu der langen Reihe aufgebockter Sättel herüber und hob seinen Becher.
»Cherio, ihr Glückspilze«, brabbelte er mit unsicherer Stimme. »Habt Schwein gehabt, sage ich euch.« Und dann brüllte er unvermittelt los: »Yiiiaaah, die lange Dürre ist vorbei!«
Wenn die Verfassung Quigbys noch Zweifel gelassen hätte, durch seinen Whiskyatem wurden sie beseitigt. Clyde Warwick warf dem Mannschaftsboss einen fragenden Blick zu.
»Eine Gallone auf Kosten des Hauses«, sagte Clem Markey. »Cocinero hat sie letztens mitgebracht – in der großen Ballonflasche für den Essig. Nicht einmal Cabot hätte darin nach Brandy gesucht. Ihr könnt eure Rationen bei Cocinero abholen.«
»Dieser schwarze Halunke!«, giftete Sandy Rickett. »Nicht eine Silbe hat er davon verlauten lassen.«
»Weil ich mir sonst aus seiner Haut Stiefelsohlen geschnitten hätte«, gab der Mannschaftsboss trocken zurück. »Nur nicht so eilig, mein Junge, du wirst noch früh genug voll sein.«
Ezra Stevens hatte die guten Nachrichten mit Gleichmut über sich ergehen lassen. Jetzt senkte er die Lider und murmelte: »Das hätten Sie nicht tun sollen, Markey. Von allen Erfindungen des Teufels ist der Brandy die schlimmste, denn unter seinem Einfluss kommen alle Sünden dieser Welt zustande. Warwick kann meine Ration haben.«
»He«, grunzte Jay Quigby, »ein Enthaltsamkeitsprediger. Das haben wir ja noch gar nicht gewusst. Waren es wenigstens interessante Sünden, zu denen dich das Feuerwasser angeregt hat?«
»Halt dein Maul!«, schrie Ezra Stevens. Mit der Linken packte er den Betrunkenen bei der Weste und zerrte ihn zu sich heran, während er mit der Rechten schon zum Schlag ausholte.
Clyde Warwick fiel ihm in den Arm. Er musste alle Kraft aufwenden, um den stämmigen Hünen zurückzuhalten, und sagte: »Ezra! Bist du verrückt geworden, Mister? Was kümmert dich sein Geschwätz? Er ist doch jetzt schon voll.«
Die Muskeln Ezras lockerten sich. Er ließ die Weste los und schluckte.
»Dieser Dreckskerl«, stieß er rau hervor. »Was gehen ihn meine Sünden an, wo doch seine eigene Seele noch schwärzer ist als seine Füße.«
Jay Quigby taumelte zurück. Ein Teil seines Brandys war übergeschwappt. Den Rest goss er sich in die Kehle, warf den Becher hinter sich und wischte sich den Mund ab. Von dort sank seine Hand langsam zur Hüfte hinab.
»Das machst du nicht noch einmal mit mir, Stevens«, knirschte er. »Nicht mit Jay Quigby. Zum Teufel, allmählich beginne ich zu ahnen, warum du dem Marshal in Fort Davis immer aus dem Weg gegangen bist. Was musst du auf dem Kerbholz haben, dass es dich noch jetzt durchschüttelt ...«
Sieben oder acht Burschen, fast der ganze Rest der Mannschaft, bildeten hinter Jay Quigby einen lockeren Halbkreis, unter ihnen auch Lew Cabot und Jason Starling, Quigbys Crew-Kameraden. Das Aussehen der Männer entsprach genau den Vorstellungen, die man sich nach vier Monaten Aufenthalt im Pedrera-Dornbusch machen konnte. Sie waren hohlwangig, stoppelbärtig und zerkratzt, ihre Kleidung zerfetzt und schmutzig. Der unbeschreibliche Geruch, der von jedem unter ihnen ausströmte, wurde in diesem Kreis überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Ihre funkelnden Augen und die mitleidlosen Mienen dieser Wölfe verrieten, dass sie nur nach einem gierten – nach einer Abwechslung, auch wenn diese in einem Kampf oder vielleicht sogar im Tod eines Mannes bestand.
In dieser Umgebung – und unter diesen Männern – konnte es nun zum Schlimmsten kommen. Clyde Warwick erkannte es und stieß Ezra Stevens zur Seite, sodass dieser gegen seinen aufgebockten Sattel stolperte.
»Hört auf!«, sagte er scharf. »Zum Teufel, was soll das? Morgen früh wird kein Mensch mehr wissen, worum der Streit überhaupt ging.«
✰✰✰
Clem Markey wartete ab, bis alle anderen außer Hörweite waren. Dann zog er eine zerknitterte, sehr dünne Virginia aus der Brusttasche, zündete sie an und sagte: »Warwick, wenn Sie in einem halben Jahr noch in dieser Gegend sind, würde ich Sie gern wieder dabeihaben – trotz Ihrer Spleenigkeit. Sie sind der erste Bursche, dem ich dieses Angebot mache, falls Sie das gern hören.«
Klappernd hantierte der Koch wieder mit seinem Blechgeschirr. Clyde Warwick sah den Mannschaftsboss nicht an.
»Spleenigkeit?«, fragte er mit gespannten Lippen. »Das müssten Sie mir näher erklären, Markey.«
Clem Markey versetzte gleichmütig: »Warum einen Tiger am Schwanz ziehen? Möglicherweise würde meine Erklärung Ihnen nicht gefallen, Warwick.«
»Das wäre dann mein Risiko.«
»Wenn Sie meinen, Freund. – Sie sind für meinen Geschmack ein bisschen zu viel im Dornbusch herumgeritten – auch an Stellen, wo es gar nichts zu jagen gab. Vom Tonto Rim aus habe ich Sie dabei zweimal durchs Glas beobachtet.«
»Ist das alles?«, entgegnete Clyde Warwick einsilbig.
»Sie haben sich nach den verlassenen Minen und den alten Wagentrails durch das Buschland erkundigt, und Ihr Interesse für unser Jagdgebiet im vergangenen Jahr war so harmlos und unauffällig, dass sich kein Mensch etwas dabei gedacht hat – außer mir.«
»Es gibt Leute, die erschrecken auch vor einer Klapperschlangenhaut vom vergangenen Jahr.«
»Nicht Clem Markey«, erwiderte der Mannschaftsboss. »Ich erkenne einen Burschen von der schnellen Gilde, wenn ich nur einen einzigen Blick auf ihn werfe.«
»Dann halten Sie mich für einen Revolvermann?«
»So ungefähr. Mich stört nur, dass Sie sich nie gescheut haben, bei der Lassoarbeit im Busch Ihre Hände zu ruinieren. Ein eingefleischter Pistolero hätte das nie getan.«
»Schütten Sie mir nur weiter Ihr kleines Herz aus«, bemerkte Clyde Warwick mit beißender Ironie. »Irgendetwas muss ja dabei herauskommen.«
»Bei dem Kampf mit Cabot haben Sie auch ganz hübsch zugeschlagen«, murmelte Clem Markey wie im Selbstgespräch. »Irgendwo liegt da ein Fehler. Sie sind ein harter Brocken, Warwick – aber nicht der Typ, der sich wie all diese haltlosen, entwurzelten Kerle für die Brushdevil-Jagd anwerben lässt. Da fällt mir übrigens ein, nicht ich habe Sie angeworben, sondern Sie sind zu mir in Pepes Cantina gekommen.«
»Wirklich? Ist das keine Verwechslung? Wir kannten uns damals noch nicht so gut.«
»Trotzdem«, beharrte Clem Markey. »Ich erinnere mich sehr gut. Sie hatten meinen Anschlag gelesen.«
Clyde Warwick schüttelte scheinbar verständnislos den Kopf.
»Warum wollen Sie mich wieder nehmen, wenn Sie so viel an mir auszusetzen haben?«
Der Mannschaftsboss setzte ein vieldeutiges Grinsen auf.
»Rätsel haben mich schon immer gereizt, Freund. Es bleibt bei meinem Angebot.«
»Vielen Dank«, erwiderte der hagere Buschlandreiter kühl. »Wenn es mich in einem halben Jahr noch interessiert, werde ich es Sie wissen lassen.«
Daraufhin ging er zum Küchenwagen, wo Sandy Rickett und Ezra Stevens bereits vor ihren dampfenden Blechtellern hockten.