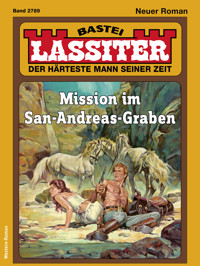1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lassiter
- Sprache: Deutsch
Der Zorn Gottes traf Miguel Código am Nachmittag des dritten März im Jahr 1887. Er kündigte sich als dumpfes Grollen in der Tiefe der Erdscholle an, die Miguel gerade pflügte, brachte das Brunnengerüst zum Wanken und riss den Acker auf einer Länge von fast vierhundert Fuß auseinander. Der klaffende Riss setzte sich bis in die Hügel fort und stank nach Schwefel.
Miguel wurde vom Pflug geworfen und landete kopfüber im Dreck.
Er blickte zu dem kleinen Steinhaus hinüber, in dem seine Frau Gracia gerade Mais kochte und seine Tochter Cesara mit der Katze spielte. Er sah die Mauern zu Bruch gehen, die er selbst gesetzt hatte, und kam mühsam auf die Beine.
Doch Miguel rannte vergebens ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Treu bis in den Tod
Vorschau
Impressum
Treu bis in den Tod
von Marthy J. Cannary
Der Zorn Gottes traf Miguel Código am Nachmittag des dritten März im Jahr 1887. Er kündigte sich als dumpfes Grollen in der Tiefe der Erdscholle an, die Miguel gerade pflügte, brachte das Brunnengerüst zum Wanken und riss den Acker auf einer Länge von fast vierhundert Fuß auseinander. Der klaffende Riss setzte sich bis in die Hügel fort und stank nach Schwefel.
Miguel wurde vom Pflug geworfen und landete kopfüber im Dreck.
Er blickte zu dem kleinen Steinhaus hinüber, in dem seine Frau Gracia gerade Mais kochte und seine Tochter Cesara mit der Katze spielte. Er sah die Mauern zu Bruch gehen, die er selbst gesetzt hatte, und kam mühsam auf die Beine.
Doch Miguel rannte vergebens...
Vier Stunden vor dem verheerenden Sonora-Erdbeben, das einen mehr als dreißig Meilen langen Graben in den Wüstenboden reißen und knapp über fünfzig Seelen kosten würde, lag Lassiter lang ausgestreckt auf dem Bett. Er hatte den rechten Stiefel auf dem Schemel abgelegt, hielt den Remington an den Bauch gedrückt und schob sich den Hut in die Stirn. Er döste und wartete geduldig darauf, dass Samantha zu ihm zurückkehrte.
Die junge Rednerin hatte ihn mit einem Blumenbouquet erwartet.
Sie hatte vor den Toren der Hazienda gestanden, in der am Abend die Friedensrichter von Douglas und El Tigre zusammenfinden sollten, um über gestohlenes Vieh und die Grenzüberfälle zu reden. Die Zusammenkunft war auf Betreiben des Gouverneurs im Arizona-Territorium einberufen worden, der auch Samantha Bley als Rednerin vorgeschlagen hatte.
»Du wartest noch?«, riss Samanthas glockenhelle Stimme Lassiter aus seinem Halbschlaf. Sie stürmte mit der ihr eigenen Hast herein, blickte sich im Spiegel an und setzte sich zu Lassiter aufs Bett. »Du musst mir sagen, ob ich passabel aussehe. Ich darf die beiden Männer nicht enttäuschen.« Sie machte eine ernste Miene. »Ich habe einen Ruf zu verlieren.«
Die American-Mexican Society of Membership Fellows, in deren Namen Samantha entsandt worden war, schlichtete in Grenzstreitigkeiten zwischen mexikanischen und amerikanischen Provinzen und hatte sich damit einen Namen gemacht. Sie unterhielt eine Niederlassung in Phoenix und hatte das Justizministerium gebeten, dass man ihr Schutz für die Rednerinnen und Redner stellte.
»Du siehst makellos aus«, erwiderte Lassiter und beließ den Hut im Gesicht. Er hatte inzwischen zwei Nächte mit Samantha verbracht und wusste, dass sie stets wie aus dem Ei gepellt erschien. »Sie werden vor Begeisterung nicht an sich halten können.«
Geschmeichelt wandte sich Samantha vom Spiegel ab und stieß Lassiter mit dem Ellbogen an. »Du!... Schlaf mir bloß nicht ein!... Ich brauche deinen Rat, Mr. Lassiter! Ich muss wissen, ob mich die Männer in diesem Aufzug ernstnehmen.« Sie rutschte ein Stück näher. »Wen sollte ich sonst um seine Meinung bitten?«
Der große Mann stöhnte gelangweilt. »Deinen Schneider? Ich verstehe nichts von Kindereien wie gefälliger Mode.«
»Daran habe ich nicht den mindesten Zweifel.« Samanthas Blick wanderte an der staubigen Hose entlang, die Lassiter trug. »Du könntest einen Schneider gut gebrauchen. Ich bin an Männer gewöhnt, die Gehrock oder Frack tragen.« Sie lächelte boshaft. »Einen groben Klotz wie dich hole ich mir höchstens ins Bett.«
Auf diese Weise stichelten sich fast eine geschlagene Stunde miteinander, bevor sie sich in den Hinterhof der Hazienda begaben. Sie schritten unter der Pergola mit den blühenden Rosen dahin, die in diesem Jahr außergewöhnlich früh aufgegangen waren. Als sie zum rückwärtigen Tor gelangten, ergriff Samantha Lassiters Hand.
»Niemand kommt an dich heran«, versprach der Mann der Brigade Sieben in ruhigem Ton. Er wollte Samantha die Angst davor nehmen, sich mit den mexikanischen Banditen anzulegen, von denen der Friedensrichter aus El Tigre bedroht wurde. »Außer mir ist keine Menschenseele in deiner Nähe.«
Der Wind griff in die blassroten Blüten und trug feinen Rosenduft herüber. Über die blendend weißen Mauern der Hazienda schallte ein Hundekläffen, das Samantha unwillkürlich zusammenzucken ließ. Sie strich ihr dunkles Haar hinter die Schultern, hob den Kopf und küsste Lassiter. »Wie könnte ich dir darin widersprechen? Ich... Ich muss nur daran denken, was Ochoa zugestoßen ist.«
Der Banditentrupp hatte Vincent Ochoa entführt und an einem Baum nahe der Stadt aufgehängt. Sie hatten ihm die Kleider vom Leib gerissen, ihm ein Kleid übergehängt und ein Schild darunter befestigt, auf dem er als Hurensohn beschimpft worden war. Er hatte ein so trauriges Bild abgegeben, dass man ihn gleich an Ort und Stelle beerdigt hatte.
Ochoas Witwe hatte Samantha vor den Mexikanern gewarnt.
Sie hatte ihren Mann über den grünen Klee gelobt und dabei unterschlagen, dass er selbst den Trupp angeheuert hatte, um die Streitigkeiten mit Douglas anzufachen und Bestechungsgeld einzustreichen. Das Hauptquartier in Washington hatte ein reichliches Dutzend Informantenberichte dazu gesammelt.
»Ochoa hat sich selbst geschadet«, sagte Lassiter und zog Samantha an sich. Er roch an ihrem Hals, der so verführerisch duftete wie die Rosenblüten über ihnen. »Du hast dir nichts zu Schulden kommen lassen. Sie werden dich in Frieden lassen.« Er küsste Samantha. »Ich werde dafür sorgen.«
Unter leidenschaftlichen Umarmungen schafften sie es bis in Samanthas Schlafkammer. Sie rissen einander die Kleider vom Leib, drückten sich wechselseitig an die Wand oder an ein Möbelstück, schoben eine Hand zwischen die Beine des anderen, stöhnten vor Lust. Sie hatten es bereits in der Nacht zuvor getrieben, davor auch und wiederum in der Nacht zuvor.
»O Lassiter!«, stöhnte Samantha und hielt seine Hand an ihrer Scham fest. Sie rieb sich an seinen rauen Fingern, schloss die Augen und gab sich den Liebkosungen ihres Beschützers hin. »Wärest du nur... Wärest du nur ein Mann wie jeder andere! Ich muss mich bezwingen! Ich muss... tugendhaft... sein!«
Eins ums andere Mal stammelte Samantha, dass die Lust sie fortreißen würde, dass sie die Besinnung verlieren würde. Sie und Lassiter schliefen auf dem Kanapee miteinander, dann auf dem Teppich, der davor lag, zum Schluss auf den blanken Dielen. Sie behielt das Miederhöschen an, das ihren runden Po nur noch dürftig bedeckte.
»Komm zu mir!«, hauchte Samantha und presste Lassiter an sich. Sie rieb ihre schweißnasse Haut an der seinen und stöhnte dabei. »Schone uns nicht! Gib mir, was -«
Ein tiefes Donnergrollen ließ Samantha auf der Stelle verstummen.
Es kroch unter den Dielen hervor, die langsam zu beben begannen, als würde ein Dutzend Männer daran rütteln. Der Donner schwoll an und wurde zu einem handfesten Beben, warf die Regale an der Wand um, brachte die Schränke zum Knacken.
Samantha klammerte sich ängstlich an Lassiter.
✰
Die trockene Erde rann Miguel Código durch die Finger, als wäre sie bloßer Staub. Er hatte am Boden gerochen, hatte die Hitze in den Wangen gespürt, die daraus aufstieg, und war umso stärker überzeugt, dass nichts die Dürre in diesem Sommer abwenden konnte. Die Trockenheit würde die Ernten dahinraffen wie die biblische Heuschreckenplage, würde den Dorfbewohnern jenen letzten Besitz nehmen, den ihnen das Erdbeben noch gelassen hatte.
Fast dreißig Meilen musste der Graben in der Länge messen.
Er war beim ersten Erdstoß aufgebrochen und hatte die Sonora zerschnitten wie eine Schere ein Baumwolltuch. Einige Männer in der Stadt behaupteten, dass es der Zorn Gottes gewesen sei, dass der Herrgott die Bauern für ihre Sünden strafen wolle, für die Trinkspiele, die Hurerei, die Flüche auf den Äckern. Der Hirte treibe seine Schäfchen zum Schlachter, hatte jemand gesagt, und nichts und niemand könne ihm entkommen.
Código hielt nichts von solchen Sermonen.
Vor einer Stunde hatte er seine Frau und seine Tochter verloren, hatte ihre leblosen Körper aus den Trümmern seines Hauses gezogen, und dennoch kam ihm nicht in den Sinn, dafür dem Allmächtigen die Schuld zu geben. Er war taub in seinem Inneren. Er konnte nichts essen und trinken, konnte kein Pferd besteigen, konnte nicht einmal hinüber zum Hoftor gehen.
Er stand nur da und ließ die Erde aus den Fingern rinnen.
Die Gegend müsse fruchtbar sein, hatte Gracia gesagt, als sie mit der Kutsche angekommen waren, die Mescalito-Agaven stünden hoch und prächtig. Sie hatte auf dem Kutschbock neben Miguel gesessen und gestrahlt dabei, wie nur sie es vermocht hatte. Die Mundwinkel hatten schmale Grübchen geformt; fast zu schön, um in einem Menschengesicht vorhanden zu sein.
»Miguel! Miguel!«
Gellend tönte der Ruf von Feliciano Arallo herüber, der eine Schmiede im Dorf besaß und sich sonst den ganzen Tag über Schweiß von den fleischigen Wangen wischte. Er kam quer durch das Feld herübergelaufen und schwenkte die Arme in die Luft.
Über Códigos Lippen kam kein Wort des Grußes.
Er war mit Feliciano seit Jahren befreundet, hatte dessen Sohn einen Pflug vermacht, als der sich am Fluss ein Stück Land gekauft hatte. Er trank mit Feliciano amerikanischen Whisky, war mit ihm beim Constable von Phoenix, als er um fünfzig Dollar betrogen worden war. Er mochte Feliciano wie einen Bruder und grüßte ihn trotzdem nicht.
»Miguel!«, wiederholte Arallo und blieb fünfzig Fuß vor Miguel stehen. Er hatte Tränen in den Augen. »Ich... Ich musste dich sehen. Das Dorf... Es sind viele verletzt. Sie brauchen unsere Hilfe... Du musst mir kommen, Amigo-.«
Die Worte rauschten an Miguel vorüber, mischten sich mit dem warmen Südwestwind, der von der Sierra Madre herabwehte, und verflog auch so rasch. Es waren leere Worte für Miguels Ohren, ausgehöhlte Floskeln, die keiner Erwähnung wert waren, bloße Gewohnheit irgendwie. Sie erreichten Miguel nicht.
»Verflucht, Miguel!«, wurde Arallo laut und kam auf seinen Freund zu. Er packte ihn bei den Schultern und schüttelte ihn. »Por dios, ich weiß, wie es dir gehen muss! Du hast sie verloren... Aber nicht du allein! Fast ein Dutzend Dorfbewohner sind tot.«
Das dunkle Brodeln im Erdboden hatte eine Ewigkeit angehalten und an den Lehmziegeln gerüttelt, die Miguel Stück für Stück aufgeschichtet hatte. Es war ein gieriges Knurren gewesen, das Knurren einer Bestie, die darauf lauerte, dass man ihr noch mehr zum Fressen vorwarf. Es hatte ihr Gracia und Cesara geraubt.
Stumm schloss Feliciano Miguel in die Arme.
Er umfasste mit seinen sehnigen Unterarmen den ganzen Rücken, drückte auf eine Weise zu, wie es Miguel bei ihm noch nie erlebt hatte. Die Arme seines Freundes umschlossen ihn mit Verzweiflung. Sie wollten ihn trösten und dadurch auch Feliciano.
»Ich... Ich bin tot«, sagte Miguel. »Ich bin in der Ruine meines Hauses gestorben. An Gracias Seite... An ihrer Seite.« Er konnte nicht weinen, obgleich sich alles in ihm danach sehnte. »Sie war bloß an den Tellern, Feliciano... Sie war bloß an den Tellern.«
Anstelle von Miguel schluchzte Feliciano und schämte sich dafür. Er wischte sich mit zwei Fingern den Rotz von der Nase und ließ Miguel los. »Ich finde selbst keinen Trost deshalb. Aber wenn... Wenn wir den Rest im Stich lassen, wird es noch trauriger.« Er zeigte über die Schulter zum Dorf. »Sie brauchen uns! Sie warten auf uns!«
Fern hinter den Äckern sah Miguel sein Dörfchen Bavispe.
Die Lehmziegelhäuser erstreckten sich über die flachen Ufer des Bavispe-Flusses, der das Tal von Norden nach Süden durchmaß und dabei Wasser aus dem El Santo, dem Texano, dem Hoyo de Mezcal und dem Cañadas einsammelte. An manchen Abenden zeichnete die Sonne die Gebirgskämme dahinter stundenlang rot.
»Was ist mit der Kirche?«, fragte Miguel tonlos. »Einer hat gesagt, sie sei eingestürzt... Die Erde habe gebebt und eine Ruine aus ihr gemacht.«
Das altehrwürdige Gotteshaus von Bavispe stammte aus spanischer Zeit und trug denselben Namen wie Miguel. Es hatte Gracia die Welt bedeutet; jeden Sonntag hatte sie Blumen für den Altar mitgenommen. Die Frauen aus dem Dorf hatten über die Inbrunst gespöttelt, mit der Miguels Frau die Messe begangen hatte.
»Sie ist hinüber«, sagte Feliciano bloß und schüttelte den Kopf. Er war abermals den Tränen nahe. »Ich... Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Du musst mit ins Dorf kommen. Du musst es dir anschauen.«
Sie schritten ein Stück an dem Graben entlang, den das Beben hinterlassen hatte, um Miguel den Weg vorbei an seinem zerstörten Haus zu ersparen. Die gähnende Kluft in der Erde, die ausgefransten Ränder, die aufgeworfene Erde, sie alle erinnerten Miguel an das Chaos, von dem der Priester in seinen Predigten gesprochen hatte.
»Sieh mich an!«, sagte Feliciano sanft und blieb vor Miguel stehen. Er hatte immer gewusst, wie er mit seinem Freund zu sprechen hatten. »Nichts und niemand bringt dir Gracia und Cesara zurück. Sie sind tot. Sie sind umgekommen.« Er griff Miguel bei den Schultern. »Du musst begreifen, was geschehen ist.«
Aus Miguel brach nur hysterisches Gelächter heraus.
Er machte sich von Feliciano los, kehrte ihm den Rücken zu und lachte den Kummer heraus, bis die Tränen zurückkehrten. Das heisere Lachen wurde zu ersticktem Greinen, dann brach Miguel zusammen und sank auf die Erde hinunter. Er starrte auf die Agaven rings um sie herum, die kräftigen Blätter, die wie Dorne in die Höhe ragten.
Nichts konnte Miguel trösten.
✰
Die Begebenheit von dem Hund Chico, der sich winselnd an die Füße des Ranchers Jack Rodgers geschmiegt hatte, noch ehe das Beben zu hören oder zu spüren gewesen war, hatte sich wie ein Lauffeuer in Campbell verbreitet. Die Frau vom Ely's hatte es ihren Freundinnen vom School District Fund erzählt, die wiederum ihren Männern, worauf man sich im Fryer's Hotel getroffen und darüber debattiert hatte.
»Was für ein Hokuspokus!«, knurrte der Mann im Sessel gegenüber von Lassiter. Er war von Kopf bis Fuß mit Staub bedeckt und hatte dennoch in einem der vornehmen Ohrensessel im Foyer Platz genommen. »Nach allen Regeln der Wissenschaft kann selbst ein Hund nicht wissen, ob die Erde zu zittern anfängt! Ich glaube Rodgers kein Wort! Er will sich bloß wichtig machen!«
Die übrigen Männer waren Geschäftsleute und Minenbesitzer aus Campbell und vertraten ihre Meinung ebenfalls kontrovers. Sie wiesen den jeweils anderen zurecht, zeterten regelrecht, bevor Lassiter die Hände hob und um Ruhe bat.
»Meine Herren!«, sagte der Mann der Brigade Sieben. »Es steht außer Frage, dass die Geschehnisse der vergangenen Stunden jeden von uns in Aufregung versetzen. Wir sollten darüber nicht vergessen, dass es dort draußen Menschen gibt, die unsere Hilfe brauchen.« Er sah sich nach allen Seiten hin um. »Ich schlage vor, dass wir diese Plauderrunde -«
Der empörte Protest der Versammelten zwang Lassiter, seinen Satz vorzeitig zu beenden. Er hatte damit gerechnet, dass man ihm vorhielt, ein Fremder im Arizona-Territorium zu sein, doch die Entschlossenheit, mit der man diesen Vorwurf äußerte, überraschte den großen Mann.
»Sie sollten sich schämen!«, rief Edward Clifford, der in der Stadt einen Mietstall betrieb. »Sie kommen von der feinen Ostküste, bringen eines der schönsten Mädchen mit und wagen es, uns zu belehren!« Er schüttelte den Kopf. »Sir, Sie sind nicht mehr als ein Dandy! Ich lege keinen Wert auf Ihr Urteil!«
»Nun gehen Sie nicht so hart mit ihm ins Gericht!«, rief Timothy Hurley. Er war der Direktor der Mineral Mining Company und zugleich Mittelsmann der Brigade Sieben. »Darf ich Sie daran erinnern, dass Mr. Lassiter beinahe zu Tode gekommen ist? Die Hazienda liegt – wie Sie alle wissen – nahezu in Trümmern.« Er atmete tief durch. »Außerdem sagt er bloß die Wahrheit, Gentlemen.«
Die erhitzten Gemüter fanden wieder zur Ruhe.
Die Männer berieten sich in gesitteter Weise und beschlossen, dass man einige Fuhrwerke mit Lebensmittel in den Süden schicken musste, um die Mexikaner zu versorgen, die es noch schwerer getroffen hatte. Als man sich nach einer Stunde erhob, um die nötigen Vorbereitungen zu treffen, klopfte Hurley Lassiter auf die Schulter.
»Ich bin nicht stolz«, sagte Lassiter und stemmte die Arme in die Seiten. »Ich wollte diese Männer nicht wie Schuljungen behandeln.«
»Sie haben gesagt, was nötig war.« Hurley ging mit Lassiter auf die Straße hinaus, auf der eine dichtgedrängte Menschenmenge stand. »Ich hätte es kaum kraftvoller zum Ausdruck bringen können. Die Bewohner von Campbell stehen unter Schock.« Er sah sich um. »Es hat noch nie ein Erdbeben von dieser Wucht gegeben.«
Ein Fuhrwerk bahnte sich einen Weg durch die Menge, die teils fassungslos, teils streitend herumstand und dem Kutscher die Schuld für die eigene Ratlosigkeit gab. Einige Flüche wurden laut, die der Mann auf der Kutsche mit gleicher Münze zurückzahlte. Er schwang sogar die Peitsche und trieb die Leute davon.