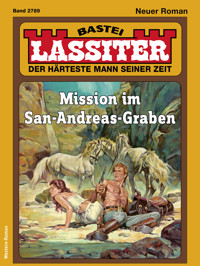1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lassiter
- Sprache: Deutsch
Die Coyote Mine befand sich im südlichen Sycamore Canyon, hinter einer malerischen Biegung, die Joe Butterly an den Ort erinnerte, an dem die Ranch seines Vaters gestanden hatte. Er hatte seine Jugend am Fuß der Rocky Mountains verbracht.
"Wirf die Hufeisen rüber!", brüllte Butterlys Freund Greg Hobson. Er meinte die gebogenen Stahlbügel für die Wasserrinnen. "Oder muss ich den ganzen Vormittag warten?"
Das grelle Sonnenlicht hatte die Männer früh von den Schlafstätten gescheucht, und wenn Butterly sich nicht täuschte, würde das gute Wetter bis zum Abend halten. Er griff in das Boot, mit dem sie ihre Ausrüstung den Fluss heraufgebracht hatten.
"Mach schon!", rief Hobson und sprang auf das Gerüst, das er zusammengezimmert hatte. "Mir werden die Arme lahm!"
Es waren die letzten Worte, die Butterly von ihm hörte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Nacht ohne Morgen
Vorschau
Impressum
Nachtohne Morgen
von Marthy J. Cannary
Die Coyote-Mine befand sich im südlichen Sycamore Canyon, hinter einer malerischen Biegung, die Joe Butterly an den Ort erinnerte, an dem die Ranch seines Vaters gestanden hatte. Er hatte seine Jugend am Fuß der Rocky Mountains verbracht.
»Wirf die Hufeisen rüber!«, brüllte Butterlys Freund Greg Hobson. Er meinte die gebogenen Stahlbügel für die Wasserrinnen. »Oder muss ich den ganzen Vormittag warten?«
Das grelle Sonnenlicht hatte die Männer früh von den Schlafstätten gescheucht, und wenn Butterly sich nicht täuschte, würde das gute Wetter bis zum Abend halten. Er griff in das Boot, mit dem sie ihre Ausrüstung den Fluss heraufgebracht hatten.
»Mach schon!«, rief Hobson und sprang auf das Gerüst, das er zusammengezimmert hatte. »Mir werden die Arme lahm!«
Es waren die letzten Worte, die Butterly von ihm hörte ...
Eine knappe Viertelstunde vor dem Tod seines guten Freundes Greg Hobson saß Joe Butterly am Heck des Bootes und zog das Steuerruder herum. Er starrte auf das Steingeröll am Ufer, in dem bereits der Kiel scharrte, und stemmte einen Fuß gegen die Sitzbank vor ihm.
»Verflucht noch eins!«, rief Greg und sprang von seinem Platz auf. Er war zwei Köpfe größer als Joe und ein behänder Sportler. »Du wirst uns noch in die Stromschnellen bringen! Halt das Ruder fest! Halt es fest, Joey!« Er machte einen Satz über die Bordwand und stand im Wasser. »Sag' ich's nicht? Sag' ich's dir nicht?«
Er fasste mit seinen kräftigen Händen den Bootsbug, zog ihn herum und rammte ihn tief in die Steine. Die Provianttaschen kippten um und fielen Joe vor die Füße. Aus einer der Taschen rollte ein Stück Brot, das Greg griff und sich in den Mund stopfte.
»Wird wohl ein guter Tag!«, sagte Joe und stieg über die Taschen. Er deutete zum Himmel hinauf. »Keine verfluchte Wolke, die uns Regen bringt! War gut, dass wir so zeitig aus den Federn gekommen sind!«
Seit Wochen waren sie ganz auf sich gestellt, und nahm man Gregs überschäumendes Temperament zum Maßstab, hatten sie sich die ganze Zeit über gut verstanden. Sie stritten jeden Tag über Banalitäten, als wären sie ein verfluchtes Ehepaar, und genau darin lag ihr Freundschaft. Sie achteten aufeinander und ließen sich nie im Stich.
Greg hatte Joe im Zug nach Baltimore gegenübergesessen.
Er hatte einen piekfeinen Gehrock getragen, in dem er zum Notar gegangen war und sich einen Landtitel in Arizona hatte bestätigen lassen. Sie hatten gemeinsam gegessen und waren ins Hooper's gegangen, in dem an diesem Abend eine Sängerin aus St. Louis gesungen hatte. Von den Beinen der Saloonsängerin hatte Greg den ganzen Abend geschwärmt.
»Träumst du noch von Mary?«, fragte Greg und stützte sich auf die Bootswand. Er stellte derartige Fragen oft unvermittelt. »Du hast im Schlaf von ihr geredet.« Er äffte Joes verzerrtes Gesicht nach. »Du musst sie aus dem Herzen kriegen.«
Sie räumten das Boot leer, und je weiter sie damit vorankamen, desto deutlicher trat Joe vor Augen, dass er in Greg einen Freund gefunden hatte, wie es ihn kein zweites Mal auf der Welt gab. Er konnte sich nicht erklären, weshalb er gerade an diesem Morgen darüber nachdachte. Er war mit einem Gefühl von Trauer in der Brust aufgewacht, als hätte ihm jemand einen zentnerschweren Stein auf die Rippen gelegt.
Die Gerüste gingen Greg schnell von der Hand.
Er verstand sich auf Schreinerarbeiten, sägte Balken zurecht, ersann Stützkonstruktionen für die Wasserkanäle, legte Schächte mit Brettern aus. Er war geschickter als Joe, dem dafür das Goldwaschen leichtfiel, und so ergänzten sie sich in den meisten Dingen.
Sie hatten Mary beide geliebt.
Zunächst war es Greg gewesen, der eine Affäre mit der verwitweten Farmerin aus Rockyneck Point angefangen hatte, dann hatte Mary Joe umgarnt, und zum Schluss hatten beide ihre Herzen an die Dreißigjährige verloren. Sie hatten sich ausgesprochen, und am nächsten Tag hatte Greg Mary gesagt, dass sie nach Arizona auf Goldsuche gehen würden.
»Mach schon!«, rief Greg und stellte einen Fuß auf das Holzgerüst. Er klatschte in die Hände und gab einen lauten Seufzer von sich. »Mir werden die Arme lahm!«
Grübelnd wandte sich Joe zum Boot um und fasste nach den rostigen Stahlklammern, mit denen sie gewöhnlich die Rinnen im Erdboden befestigten. Sie hatten die Dinger »Hufeisen« getauft, und Greg mochte es nicht, wenn er darauf warten musste. Er war ungeduldig und wollte seinen Teil erfüllen. Er war fleißiger als Joe, kräftiger ohnehin, und das ließ er seinen Freund bisweilen spüren.
»Warte!«, rief Joe zurück und beugte sich in den Schiffsrumpf. Er schob die umgefallenen Provianttaschen zur Seite und erblickte ein aufgeweichtes Brot darin, das ihm noch Jahre nach diesen Ereignissen im Traum erscheinen würde.
Dann hörte Joe ein ersticktes Gurgeln.
Er richtete sich vom Boot auf, wandte sich zu seinem Freund um und sah in dessen schmerzverzerrtes Gesicht, dessen Ausdruck frappierend jenem glich, das Greg vor einigen Minuten nachgeahmt hatte. Eine hässliche Wunde klaffte in Gregs Hals, aus der dickflüssiges Blut rann.
Hinter Greg stand ein bärtiger Kerl.
Er hielt ein Jagdmesser in der Rechten, von dem ebenfalls Blut troff, und hatte einen Arm um Gregs Hüfte geschlungen, um den Sterbenden aufzufangen. Als Greg zusammensackte, grinste der Fremde und deutete mit dem Messer zum Fluss.
Ein brennender Schmerz durchfuhr Joe.
Er schaute an sich herunter und sah die Klinge eines anderen Messers aus seinem Bauch ragen. Er hatte mit einem Mal die spanischen Goldminen im Sinn, über die Greg gesprochen hatte, die Minen in den Felswänden am Ufer, von denen die meisten glaubten, dass sie verschollen waren.
Musste Greg deshalb sterben?
Er war es gewesen, der vor einem Monat in Flagstaff darüber geprahlt hatte, dass er einige der Minen kannte, obwohl nichts davon wahr gewesen war. Er hatte eine Tänzerin an der Theke des Bartler Room beeindrucken wollen, hatte das Blaue vom Himmel gelogen, hatte sich wie ein Gockel aufgeführt.
»Lass ihn los!«, sagte eine dunkle Männerstimme hinter Joe. »Lass die Schwachköpfe krepieren! Wir müssen das Boot wegbringen!«
Die Beine sackten Joe weg, und er fiel vornüber in den Ufersand, der nach trockenem Gras und ausgedörrtem Holz roch. Er drehte den Kopf zur Seite, sah Greg röcheln und wusste, dass sie gemeinsam vor den Allmächtigen treten würden.
✰
Über den Holzhäusern von Flagstaff wölbte sich die Himmelskuppel mit den funkelnden Sternen, unter denen ein dünnes Wolkenband vorübertrieb. Die Mondscheibe war ein fahles Rund, das sich zur Hälfte hinter den Bergen versteckte und kaum genug Licht spendete, dass man die Hand vor Augen sah.
Der Mann im Sattel steckte sich einen Zigarillo an.
Er war aus Prescott herübergekommen, wo er einen Sträfling aus Idaho gejagt hatte, dem die eigene Prahlsucht zum Verhängnis geworden war. Er hatte den Kerl in einer Spelunke am Stadtrand aufgespürt, in der sich zwanzig Männer Kämpfe im Armdrücken geliefert hatten. Sie waren erfreut darüber gewesen, dass einer ihrer Konkurrenten ausschied.
Inzwischen hatte Lassiter einen anderen Auftrag erhalten.
Er mochte das Arizona-Territorium mit seinen zerklüfteten Felslandschaften, den tiefen Flusstälern, den einsamen Gipfeln, über denen Adler kreisten. Er mochte die Stille dieses Landstrichs, der wie kein anderer Verbrecher und Gesetzlose anzog und dennoch nichts von seiner Anmut verlor.
Mr. Renshaw, Flagstaff – Stopp – fünf Uhr morgens – Stopp.
Das Telegramm aus dem Hauptquartier war mit einem Kurier gekommen und erst tags zuvor aufgegeben worden. Es musste Washington in den frühen Nachmittagsstunden verlassen haben, woraus Lassiter schloss, dass der Mittelsmann in Flagstaff längst unterrichtet war. Er hatte die Geduld des Mannes nicht auf die Probe stellen wollen.
Aus dem Dunkel näherte sich eine Gestalt.
Sie war von gedrungenem Wuchs, ging am Stock und blieb in längeren Abständen stehen, um sich umzuschauen. Sie keuchte vernehmlich und kam dennoch raschen Schrittes auf Lassiter zu.
»Mr. Renshaw«, sagte Lassiter und nickte. Er beugte sich im Sattel nach vorn. »Sie wollten mich zu früher Stunde sehen.«
Die Stimme des Alten klang heiser und brüchig. »Ich muss auf der Hut sein, Mr. Lassiter. Ich darf niemanden mitbekommen lassen, dass ich Verstärkung gerufen habe.« Er trat an das Pferd und stützte sich auf seinen Stock. »Harvey Renshaw. Ich bin der verdammte Ortsvorsteher von Flagstaff gewesen.«
Sie liefen zum Waldrand hinüber, der in völliger Dunkelheit lag, und banden das Pferd an einem Pinienstamm fest. Renshaw war redselig und ließ die alten Tage von Flagstaff hochleben, in denen er die Eisenbahn ins Arizona-Territorium gebracht hatte. »Glauben Sie mir, Lassiter... Ich war ein gewiefter Mann. Ich bin nicht am Krückstock gegangen.«
»Sie müssen immer noch bei Kräften sein«, erwiderte der Mann der Brigade Sieben. »Sonst würde Ihnen das Hauptquartier kaum vertrauen.«
Renshaw winkte ab, lief einige Schritte voraus und wandte sich um. Er hatte wässrige Augen, die im Mondschein glänzten. »Sie sollen ein Frauenheld sein, hört man? Ich muss Sie enttäuschen. Ich muss Sie enttäuschen, Mr. Lassiter...« Er schüttelte gutmütig den Kopf. »Ich muss Sie mit dem Schutz einer Familie beauftragen.«
»Familie?«, fragte Lassiter und schloss zu Renshaw auf. Er überragte den Mittelsmann um gute eineinhalb Fuß. »Sprechen Sie von Siedlern?«
Der Alte setzte seinen Weg durch den Wald fort, bis sie eine Lichtung erreichten, von der sie den blassen Umriss der Berge sahen. Der Mittelsmann hob den Stock und deutete darauf. »Diese Leute sind keine Siedler, aber sie wollen ins Gebirge. Sie wollen hinauf zum Humphrey's Peak. Ich bin beauftragt worden, Sie zur Eskorte dieser drei Menschen zu machen.«
»Um wen handelt es sich?«, erkundigte sich Lassiter weiter. Er war an Senatoren und Kongressabgeordnete gewöhnt, die Dienste der Brigade Sieben in Anspruch, doch selten betraf seine Mission eine ganze Familie. »Sie müssen gute Freunde in Washington haben.«
Die Antwort von Renshaw fiel knapp und präzise aus. »Das Familienoberhaupt ist ein bekannter britischer Astronom. Sein Name ist Charles Lunsbury. Er ist mit einem transportablen Teleskop nach Flagstaff gekommen und will vom Humphrey's Peak aus Sternenbeobachtungen vornehmen.«
Durch die Kronen der Pinien, von denen die Lichtung gesäumt war, ging der Wind und ließ den Alten frösteln. Er starrte Lassiter aus der Finsternis heraus an und fuhr fort, als dieser zu keiner Erwiderung ansetzte. »Lunsbury ist mit einigen Männern der National Academy of Science bekannt, die offenbar um seine Sicherheit besorgt sind. Er hat die Wachleute abgelehnt, die ihm die Amerikaner zur Seite stellen wollten.«
Die Halsstarrigkeit des Briten nötigte Lassiter ein Kopfschütteln ab. »Er reist mit seiner ganzen Familie in die Wildnis und nimmt keine Leute zu seinem Schutz mit? Er hat den Beistand der Brigade Sieben nicht verdient.«
»Sie und ich wissen darum«, seufzte Renshaw und schaute zu den Bergen hinauf. Er deutete mit dem Stock auf den Gebirgszug. »Aber ich muss mich an meine Befehle halten. Sie sollen sich der Familie als Scout anbieten und sie zum Humphrey's Peak führen.« Er wandte sich zu Lassiter um. »Ich habe die nötigen Vorbereitungen dafür bereits getroffen.«
Eine Zeitlang sprachen sie über das Hotel, in dem Lunsbury und seine Familie abgestiegen waren, ehe Lassiter erfuhr, dass Renshaw der Mission wegen eine Company gegründet hatte, deren einziger Mitarbeiter er selbst war.
»Renshaw Transportation Co.«, meinte der Mittelsmann nicht ohne Stolz. »Der Schildermaler hat mir bereits eine Tafel gebracht. Ich lasse sie an meinem Haus anbringen.« Er hob listig die Brauen. »Lunsbury wird keinen Verdacht schöpfen.«
»Droht ihm Gefahr?«, fragte Lassiter und ging um Renshaw herum. »Das Justizministerium würde keinen Agenten beauftragen, hätte es nicht einen hinreichenden Verdacht. Es muss eine Drohung gegen Lunsbury gegeben haben.«
»Die Drohung ist das Arizona-Territorium«, sagte Renshaw lapidar. »Vor ein paar Tagen sind zwei Männer an der Coyote-Mine ermordet worden, davor ein Treck auf dem Weg hinunter nach Abbey's Spring. Sie müssen die Lunsburys wohlbehalten auf den Humphrey's Peak bringen.«
Der Wind frischte abermals auf und brachte Renshaw zum Frösteln. Er machte kehrt und steuerte raschen Schrittes wieder auf die Stadt zu. »Ich muss Ihnen nicht sagen, dass Lunsbury nichts von der Sorge der amerikanischen Regierung seinetwegen erfahren darf. Er soll seinen Forschungen nachgehen und danach mit seinen Studien nach London zurückkehren.«
»Verstanden, Sir«, entgegnete Lassiter. »Lunsbury wird nichts zustoßen.«
✰
Die beiden nackten Frauen am Bett von Robert S. Holmes waren nicht gewillt, sich an diesem Abend jeder Laune seiner Launen zu unterwerfen. Sie waren aufgestanden, hatten sich eine Kanne schwarzen Tees bringen lassen und standen schwatzend am Fenster. Sie mochten sich als Kurtisanen sehen, die sich einen gewissen Stolz leisten konnten, und Holmes wollte ihnen diesen Trost nicht nehmen.
Der Kunsthändler war sterbenskrank.
Seine Leber war hart wie Stein und schmerzte jeden Morgen, als würde ihm jemand einen Speer in die Seite bohren. Er trank die Elixiere, die ihm die Ärzte aufgeschrieben hatten, trank sie, als wären sie Whisky, und sie halfen ihm nicht. Er würde sterben, vermutlich in ein oder zwei Wochen, und der ganze verdammte Rittenhouse Square würde darüber jubeln.
»Brauchst du etwas?«, rief die dunkelhaarige Felicia und schwebte auf leichten Füßen zu Holmes zurück. Sie war jung und bezaubernd, und er wusste, dass sie irgendwann genauso krank werden konnte, doch er glaubte es bei ihrem Anblick nicht. »Du siehst müde aus, Robbie.«
Die Mexikanerin stand ihm näher als seine Haushälterin, die inzwischen das Tagesgeschäft besorgte und ihm die Korrespondenz vom Post Office brachte. Er hatte sich in Felicia verliebt, die auch mit anderen Männern schlief, ihm jedoch nichts davon sagte.
»Ich brauche nichts«, brummte Holmes und wälzte sich im Bett herum. Er starrte zu den Fenstern auf der Ostseite, hinter denen die Kronen der Parkbäume wogten. »Ich brauche das Telegramm von Lunsbury.«
Die Frauen plapperten noch einen Augenblick miteinander, ehe sie sich anzogen und das Zimmer verließen, um Holmes das Gewünschte zu bringen. Sie blieben einzig wegen des Geldes bei ihm, doch darin lag auch Gutes. Holmes konnte sie bei sich behalten, solange er ihnen bezahlte, was sie verlangten.
Er hatte Lunsbury fast zehntausend Dollar gegeben.
Der Astronom der englischen Krone hatte sich vor einem guten Jahr an Holmes gewandt, als der Palast seine Zuwendungen gestrichen hatte und Lunsbury eine weitere Expedition zur Marsbeobachtung hatte ausrichten wollen. Lunsbury war besessen von diesem Himmelskörper, der sich nur vor die Linsen eines Teleskops holen ließ, sobald er nah genug an der Erde stand.
Felicia brachte Holmes das Telegramm und setzte sich ans Bettende.
Sie massierte Holmes die geschwollenen Füße, ließ sich ihren Ekel dabei nicht anmerken und lächelte ihren Gönner sogar an. Sie war guten Herzens, wusste Holmes, und er erwischte sich bei dem Gedanken, dass er ihr einen Teil seines Reichtums vererben wollte.
Das Telegramm war in Flagstaff aufgegeben worden.
Gegen jede Vernunft war Lunsbury mit seiner Familie nach Arizona gereist, von der er sich nicht hatte trennen wollen. Er war ebenso störrisch wie Holmes, und vielleicht lag darin der Grund, dass sie seit Jahren miteinander befreundet waren. Der Brite war vier oder fünf Mal in Amerika zu Gast gewesen, und Holmes hatte ihn in den vornehmen Kreisen von Philadelphia herumgereicht wie eine Trophäe.
»Gibt es Neuigkeiten aus Arizona?«, fragte Felicia und wechselte zum anderen Fuß. Sie hatte sich das schwarze Haar zu einem Zopf gebunden. »Er war guter Dinge, als er aufgebrochen war. Du wolltest Mr. Lunsbury eine deiner Karten mitgeben... Eine Karte mit... mit Kanälen?«
Sie wandte sich um, lächelte sanft und hielt mit einer Hand seine Zehen fest. Sie war beinahe zärtlich, und Holmes hoffte, dass nicht alles davon gespielt war. »Eine Karte mit Marskanälen. Er glaubt, dass er die Karte besitzt, die Schiaparelli gemalt hat.«
»Schiaparelli?«, fragte Felicia. »Der Italiener? Du hast ihm eine Karte dieses Italieners beschafft?«
Fast vier Dutzend Kunstschätze lagerten in der Halle am Rittenhouse Club, von dem aus Holmes früher Geschäftsleute, Künstler und Intellektuelle mitgenommen hatte, um ihnen seine Sammlung zu zeigen. Er besaß Gemälde europäischer Maler, einige Skulpturen aus griechischen Landsitzen und eben eine Karte, die Giovanni Schiaparelli vor über zehn Jahren in Italien gezeichnet hatte.