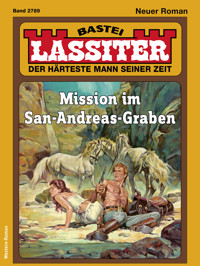1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Bereits am Morgen jenes verhängnisvollen Tages, an dem Colonel Tom Cadwallader seine rechte Hand verlieren würde, war das Flying Patriot außerordentlich gut besucht. Die Gäste strömten aus sämtlichen Straßen in das opulente Lokal am Stadtrand von Portland, das keinem Geringeren als dem legendären Frank Deboice gehörte.
"Nimm einen Schluck!", sagte Deboice versöhnlich und hielt Cadwallader das Glas hin. Er hatte den Streit nicht vergessen. "Ich will nicht, dass diese Drecksmeute zwischen uns steht."
Nach langem Zögern trank Cadwallader das Glas leer. Er saß an der Theke, starrte auf die versoffenen Seeleute, die über den Columbia River gekommen waren, und hasste Deboice aus tiefem Herzen.
Er würde ihn vor dem Morgengrauen umlegen müssen...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Blaue Bohnen zum Frühstück
Vorschau
Impressum
Blaue Bohnenzum Frühstück
von Marthy J. Cannary
Bereits am Morgen jenes verhängnisvollen Tages, an dem Colonel Tom Cadwallader seine rechte Hand verlieren würde, war das Flying Patriot außerordentlich gut besucht. Die Gäste strömten aus sämtlichen Straßen in das opulente Lokal am Stadtrand von Portland, das keinem Geringeren als dem legendären Frank Deboice gehörte.
»Nimm einen Schluck!«, sagte Deboice versöhnlich und hielt Cadwallader das Glas hin. Er hatte den Streit nicht vergessen. »Ich will nicht, dass diese Drecksmeute zwischen uns steht.«
Nach langem Zögern trank Cadwallader das Glas leer. Er saß an der Theke, starrte auf die versoffenen Seeleute, die über den Columbia River gekommen waren, und hasste Deboice aus tiefem Herzen.
Er würde ihn vor dem Morgengrauen umlegen müssen...
Den Küchentisch von Tiffany Brown zierte eine bauchige Tonvase, aus der ein Strauß violetter Lupinendolden ragte. Die Vase stand auf einer rotweiß karierten Decke, die mit Klammern an den Tischecken festgesteckt war. Die Gedecke darauf leuchteten hell in der Morgensonne, als Lassiter über die Schwelle trat und sich das sandblonde Haar raufte.
Der Mann der Brigade Sieben hatte gut geschlafen.
Er war tags zuvor mit einem Union-Pacific-Zug aus Cheyenne gekommen, hatte Tiffany am Bahnsteig auf die Arme genommen und sie übermütig bis zur Droschke getragen. Er mochte die gewiefte Hochstaplerin, deren Bekanntschaft er vor ein paar Jahren in Greeley gemacht hatte.
»Wach für eine Tasse Tee?«, rief ihm Tiffany vom Herd aus zu. Sie trug noch das Nachtkleid, mit dem sie neben Lassiter im Bett gelegen hatte. »Ich wollte dich nicht wecken, mein Freund.«
Sie war gutgelaunt, wie es ihre Art war, und dennoch lag ein gewisses Bedauern in ihrer Stimme. Sie wollte Lassiter nicht ziehen lassen, hatte sie am Vorabend gesagt, nicht an diesem Sonntag, an dem sie die Kirche ausließ und in der Hütte blieb.
Die dunkelblonden Haarsträhnen fielen Tiffany ins Gesicht.
Vor ein paar Tagen war sie fünfundzwanzig geworden, vermutlich zum fünften Mal, wie Lassiter vermutete, und sie hatte zu diesem Anlass eine Runde im Oxeye-Saloon gegeben, in dem sie dieser Tage als Sängerin auftrat. Eine ganze Schar Männer hatte Tiffany zugejubelt. Sie hatte nur Augen für Lassiter gehabt, der neben ihr am Klavier gelehnt hatte.
»Höchstens mit Rum!«, brummte Lassiter und schlang den Arm um Tiffanys schmale Taille. Er blickte in ihr schmal geschnittenes Gesicht, aus dem ihn zwei braune Augen anblitzten. »Ich betrinke mich in deiner Nähe besser nicht völlig.«
Denselben Rat hatte Lassiter in den Wind geschlagen, als er Tiffany zum ersten Mal begegnet war. Es war ihm übel bekommen. Sie hatte ihn sturzbetrunken in eine abgelegene Gasse von Greeley gelockt, ihm wertvolle Dokumente abgenommen und war damit nach Kalifornien durchgebrannt. Die Angelegenheit war glimpflich ausgegangen, jedenfalls für Lassiter, dem das Malheur verziehen worden war.
Dagegen hatte man Tiffany vier Wochen lang gejagt.
Sie war in die Berge geflohen, hatte sich in dieser Hütte verschanzt, die einem ihrer Liebhaber gehörte. Sie hatte von abgeschossenen Skunks gelebt, bis man ihren Namen in Washington vergessen hatte.
»Du wirst allmählich weise.« Tiffany nahm am Tisch Platz und schnitt sich eine Scheibe Brot ab. An ihren Unterarmen traten die Sehnen hervor. »Ich muss in ein paar Tagen nach Rawlins. Ich könnte die Dollars brauchen, die du in einer Satteltasche mit dir herumschleppst.«
Unwillkürlich blickte Lassiter zu den beiden Satteltaschen, die neben dem Küchenschrank lagen und in denen sich in der Tat vierhundert Dollar befanden. Er hatte Tiffany von dem Geld erzählt. »Du stiehlst nichts von Wert, Tiff. Ich traue dir, was das angeht. Du magst eine Lügnerin sein. Aber du bist keine Diebin.«
»Reizend«, erwiderte Tiffany und verzehrte das Brot. Sie stand auf und kramte zwischen den Gläsern, die im Wandregal standen. Sie nahm eines der Einmachgläser heraus, die allesamt in Tücher gewickelt waren. »Ich traue dir ebenfalls. Du hast nichts über mich verraten. Du hast deine eigenen Leute hinters Licht geführt.«
Das Hauptquartier hatte Lassiter nicht getäuscht.
Er hatte verschwiegen, dass er etwas über Tiffanys Verbleib gewusst hatte, und er hatte sich auch nur deshalb dafür entschieden, weil Tiffany ohne Bewandtnis für die damalige Mission gewesen war. Er hatte ihr ein lästiges Verhör erspart, das ihr stärker geschadet als es der Brigade Sieben genutzt hätte.
»Wie ich es gedacht hatte!«, rief Tiffany zu ihm herüber. »Bestes Rumgelee aus Ostindien! Du wirst es mögen!« Sie wickelte das Glas aus dem Tuch, hob den Holzdeckel herunter und stach mit dem Messer einen Streifen Gelee ab. »Willst du es gleich in den Tee? Oder soll ich –«
Das Geleeglas rutschte Tiffany aus den Fingern und fiel auf die Küchendielen. Es zersprang nicht gleich, sondern hüpfte auf dem Holz wie ein Lederball dahin, bevor es gegen die Schranktür prallte und in zwei Hälften zersprang. Das Gelee ergoss sich zähflüssig über die Scherben.
Wie vom Schlag gerührt stand Tiffany daneben.
Sie starrte zum Giebelfenster hinüber, in der sich die Silhouette einer menschlichen Gestalt bewegte und mit einem harten Stoß die Scheibe zertrümmerte. Der Fremde hatte einen Gewehrkolben ins Fenster gestoßen. Er schwang sich mit einem Satz hinein, wirbelte die Waffe herum und legte auf Tiffany an.
Buchstäblich im letzten Augenblick riss Lassiter die junge Frau zu Boden.
Er vernahm Tritte gegen die Tür, deren Bretter nach kurzer Zeit ebenfalls nachgaben, dann Schreie, ein zorniges Gebrüll, das auf vier oder fünf andere Männer schließen ließ. Er riss den Remington aus dem Holster, schlug den Spannhebel nach hinten und feuerte blind einige Schüsse unter dem Tisch ab.
Zur selben Zeit riss sich Tiffany von ihm los.
Sie kroch auf allen vieren zu dem Regal mit den Gläsern, zog vier oder fünf daraus hervor und warf sie auf die Männer. Das letzte Glas steckte sie unter die Bluse, rannte zum Fenster und sprang mit einem langen Satz hinaus. Sie war so behände, dass die Männer in der Hütte überrumpelt zurückblieben.
»Verdammt!«, brüllte einer der Fremden und wandte sich zu Lassiter um. »Nun zu uns, Bastard!«
✰
Durch Lassiters Stirn wanderte ein dumpfer Schmerz, den auch das kühle Tuch, das jemand gegen seine Schläfen presste, nicht zu lindern vermochte. Der Mann der Brigade Sieben blinzelte, machte ein zartes Frauengesicht über sich aus und wälzte sich auf die Seite. Er hatte vier oder fünf Stunden geschlafen und erinnerte sich, dass er im Saint-Mary-Hospital von Helena lag.
»Sie müssen essen«, sagte eine dünne Stimme. Sie hatte denselben Satz gesprochen, als Lassiter noch im Dämmerschlaf gelegen hatte. »Sie müssen zu Kräften kommen, Sir. Es gibt Männer, die mit Ihnen reden wollen.« Die Stimme kam näher an sein Ohr. »Sie warten draußen auf dem Gang. Ich würde sie nicht enttäuschen.«
Die Umrisse der zweckmäßig eingerichteten Krankenkammer schälten sich aus dem Dunkel, von dem Lassiter umgeben war. Neben dem Bett stand ein Schränkchen mit einer Schublade, daneben waren ein Stuhl und ein Tisch, auf dem Lassiters Habseligkeiten lagen. Er konnte den Remington erkennen, der aus dem Holster gerutscht war. Das Päckchen Patronen, das in seiner Weste gesteckt hatte, lag neben dem Griff des Revolvers.
»Wer... wer sind diese Leute?«, wollte Lassiter wissen und richtete sich halb auf. Er spürte seine lahmen Gliedmaßen kaum. »Ich will auch mit ihnen sprechen. Sie sollen hereinkommen.« Er starrte die Schwester an, die ihn behandelt hatte. »Ich esse später, Miss.«
Die Wangen der jungen Frau erröteten vor Scham, als die Schwester seinen Blick erwiderte, und auf die sanften Züge trat ein Ausdruck der Erleichterung. »Sie finden mich im Zimmer vorn im Haus. Ich muss... Ich muss Ihnen Medikamente bereiten. Sie müssen Blut verloren haben, Sir. Sie müssen viel Blut verloren haben.«
Bruchstückhaft entsann sich Lassiter des vergangenen Tages, den er in Tiffanys Hütte in den Bergen zugebracht hatte. Er hatte mit einem tiefen Schnitt in der Seite auf den Dielen gelegen, inmitten seines Blutes, und die Ohnmacht hatte ihn verfolgt wie ein zorniger Dämon. Er war von Holzfällern gefunden worden, die bei der Hütte nach dem Rechten gesehen hatten.
»Mr. Lassiter?«
Am Bett stand ein Mann in einem langen Gehrock, der sich zu Lassiter herunterbeugte. Er zog die Lederhandschuhe aus, mit denen er die Daunendecke beiseitegeschoben hatte, setzte sich auf die Bettkanten und strich die Handschuhe im Schoß glatt. Sein Gebaren zeugte von einer Vertraulichkeit, die Lassiters Misstrauen weckte.
»Sie kennen mich nicht?«, fragte der Mann und machte ein resigniertes Gesicht. »Ich war derjenige, der Sie in dieses Hospital bringen ließ. Sie sind schwer verwundet worden.« Er seufzte. »Sie trifft keine Schuld an dieser Angelegenheit.«
Erneut überkam Lassiter Unbehagen. »Sie sollten aufstehen, Sir. Ich will mich anziehen.« Er streckte die Hand nach seinen Kleidern aus, die unerreichbar weit auf dem Stuhl am Tisch hingen. Als er begriff, dass ihm die Kraft dazu fehlte, gab er ein frustriertes Knurren von sich.
»Sie müssen erst genesen, Mr. Lassiter«, sagte der Mann auf der Bettkante. Er stand auf und legte die Handschuhe auf dem Tisch ab. »Sie wurden das Opfer einer furchtbaren Verwechslung. Die Brigade Sieben... Man bereut, was Ihnen zugestoßen ist.«
Die Worte des Mannes drangen in Lassiters Ohren und ergaben doch keinen Sinn. Sie waren so belanglos und leer wie der Raum, in dem er lag, waren wie ein fiebriger Traum, der sich wieder und wieder ins Bewusstsein drängte.
»Sie sind verwundet worden«, sagte der Mann und schritt durch den Raum. »Sie sind durch unsere eigenen Leute verwundet worden. Sie müssen begreifen, dass das Hauptquartier hinter diesem Angriff steckte.«
Das Dachgebälk oberhalb des Bettes verschwamm zu einer grauen Masse, ehe es wieder das Gerüst von Balken wurde, das es in Wahrheit auch darstellte. Allmählich begriff Lassiter, dass seinen Sinnen nicht zu trauen war und dass er eine Unterhaltung führte, die er allenfalls zur Hälfte verstand. Er war zu geschwächt, um eine geeignete Entgegnung zu finden.
Der Mann am Bett stellte sich mit bedrückter Miene vor. »Ich heiße James Lansing, Mr. Lassiter. Ich bin Auktionator in Helena und Mittelsmann der Brigade. Ich muss Ihnen sagen, dass man Sie im Hauptquartier als Lockvogel benutzt hat.« Er blieb stehen und versteifte die Haltung. »Als Lockvogel bei der Festnahme von Tiffany Brown.«
Ächzend setzte sich Lassiter im Bett auf. Er trug einen festen Mullverband um die Hüfte und fühlte die Wunde, die sich darunter verbarg. Er hatte sie ein einziges Mal gesehen, als man ihn auf das Bett gehoben hatte. »Tiffany? Was ist mit Tiffany? Wo ist sie?«
»Sie ist flüchtig«, erwiderte Lansing und kehrte ans Bett zurück. Er hatte ein fleischiges Gesicht mit ausgeprägter Kinnpartie, die ein stoppeliger Bart bedeckte. »Noch weiß niemand, ob wir sie wiederfinden. Die Männer in der Hütte... Sie sollten Miss Brown festnehmen. Sie wussten nichts davon, dass Sie einer unserer besten Männer sind.« Er wies auf Lassiters Verband. »Einer dieser Kerle hat sie abgestochen.«
Mit beiden Armen stemmte sich Lassiter in die Höhe und wankte durch das Krankenzimmer. Er warf einen Blick aus dem Fenster, hinter dem sich die Hausdächer von Helena aneinanderreihten. »Man wollte an Tiffany kommen? Durch meine Hilfe?«
Lansing nickte betroffen. »Sie waren der Lockvogel. Die Affäre mit Tiffany... Man wusste davon und entschloss sich, Sie als Köder zu benutzen.« Er schüttelte den Kopf. »Doch die Leute in Montana... sie wussten nichts über den Namen Lassiter. Sie stachen zu, wie sie es bei jedem getan hätten, der sich ihnen in den Weg stellt.«
Die Tür öffnete sich einen Spalt und die Krankenschwester betrat den Raum. Sie trug ein Tablett mit Arzneien, die sorgfältig beschriftet waren. »Ich muss Mr. Lassiter behandeln, Mr. Lansing.«
Der Mittelsmann ging auf die junge Frau zu, nickte langsam und drehte sich zu Lassiter um. »Sie sollten ins Auktionsbüro kommen, sobald Sie wieder bei Kräften sind. Ich werde Ihnen mitteilen, was vorgefallen ist.« Er sah die Krankenschwester an. »Ich darf auf Ihre Verschwiegenheit zählen? Von der Verletzung darf niemand erfahren. Sie müssen ihn aus dem Hospital entlassen, sowie er sich kräftig genug fühlt, ja?«
Die Angesprochene nickte pflichtschuldig und brachte die Arzneien zu Lassiter. Sie machte sich an dessen Verband zu schaffen und scheuchte Lansing mit einer Handbewegung hinaus. »Gehen Sie, Sir! Ich versorge ihn, wie Sie es sich erbeten haben! Aber gehen Sie nun!« Sie gab Lassiter einen Schlag auf den Hintern. »Und Sie halten still! Ich muss Sie wieder auf Vordermann bringen!«
✰
Den Kongressabgeordneten an der Buffettheke hatten die schmale junge Frau, die durch die hintere Tür des Pullmanwaggons getreten war, längst bemerkt. Sie ließen ihre Drinks stehen, zupften ihre Kragenbinder zurecht und putzten die Staubflusen von ihren Fräcken. Sie waren seit fünf Tagen vollkommen unter sich und hatten jede weibliche Gesellschaft entbehren müssen.
Pete Gannon blieb auf seinem Hocker sitzen.
Er trank das Bourbonglas leer, zahlte dem Barkeeper der Union Pacific ein anständiges Trinkgeld und zog das Telegramm unter der Weste hervor, das er von jener Frau erhalten, der in dieser Sekunde sämtliche Aufmerksamkeit im Speisewagen galt. Er las die wenigen Zeilen, die ihn in Council Bluffs erreicht hatten, lächelte sanft darüber und steckte den Telegraphenbogen wieder ein.
Die übrigen Abgeordneten boten der Frau abwechselnd einen Sitzplatz am Fenster oder an der Theke an, redeten unablässig auf sie ein und überboten einander mit Komplimenten. Sie benahmen sich wie verdammte Schmeißfliegen, denen man nicht Herr werden konnte, sooft man auch mit der Hand fuchtelte. Sie benahmen sich nicht anders, als Gannon sie aus dem Kongress kannte.
Die Delegation bestand aus fünfzehn Abgeordneten.
Sie war durch den Sonderkommissar für auswärtige Angelegenheiten eingesetzt worden und umgehend mit ihrer ersten Dienstreise beauftragt worden. Die Fahrt sollte nach Pocatello führen, in ein abgelegenes Hotel, in dem man die Angelegenheiten der Kommission besprechen konnte, ohne dass jemand etwas an die Korrespondenten der Hauptstadtjournaille durchstach.
»Mr. Gannon?«
Die junge Passagierin mit den dunkelblonden Haaren und den betörend braunen Augen war auf Gannon zugetreten. Sie hatte sämtliche Offerten, die ihr die anderen Abgeordneten angeboten hatten, ausgeschlagen und erklomm einen Barhocker. Sie griff nach den gerösteten Lammstreifen, die auf der Theke standen, und verzehrte davon zwei genussvoll.
»Miss Brown«, sagte Gannon und zog das Telegramm erneut hervor. Er zeigte es seiner Sitznachbarin, um sie davon zu überzeugen, dass er derjenige war, für den sie ihn hielt. »Sie müssen erschöpft von der Reise sein. Ich muss gestehen, dass mich Ihr Telegramm überrascht hat.«