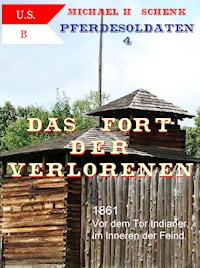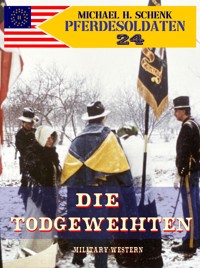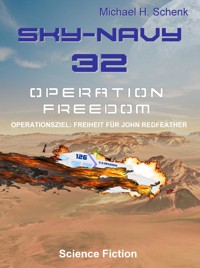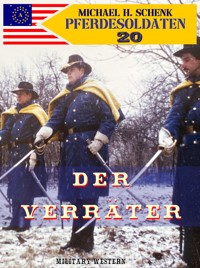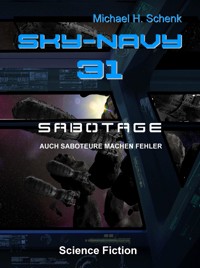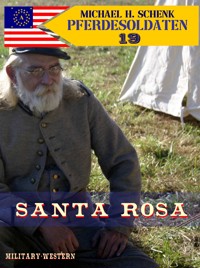Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pferdesoldaten
- Sprache: Deutsch
"Die Pferdesoldaten" bietet spannende Western aus der Zeit der nordamerikanischen Indianerkriege. Die in sich abgeschlossenen Abenteuer stellen die U.S. Reitertruppen in den Jahren zwischen 1833 und 1893 vor. Entgegen der üblichen Western-Klischees bietet der Autor dabei tiefe Einblicke in Ausrüstung, Bewaffnung und Taktiken, die sich im Verlauf der Jahre immer wieder veränderten. Schicke gelbe Halstücher und Kavallerie mit Repetiergewehren wird der Leser hier nicht finden, wohl aber Action mit einem ungewohnten Maß an Authentizität.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Schenk
Pferdesoldaten 03 - Der Pfad der Comanchen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1 Die Landvermesser
Kapitel 2 Garnisonsleben
Kapitel 3 Kriegsrat
Kapitel 4 Grand Forks
Kapitel 5 Eine furchtbare Entdeckung
Kapitel 6 Das Lauffeuer
Kapitel 7 Order aus Washington
Kapitel 8 Rache für Grand Forks
Kapitel 9 Aufbruch
Kapitel 10 Unter Feinden
Kapitel 11 Der Krieger
Kapitel 12 Rote Verbündete
Kapitel 13 Erstes Blut
Kapitel 14 Camp Cooper
Kapitel 15 Verhandlungen
Kapitel 16 Demonstration der Macht
Kapitel 17 Drohendes Unheil
Kapitel 18 Hintergedanken
Kapitel 19 Camp Looking Hill
Kapitel 20 Scouts
Kapitel 21 Staub über der Prärie
Kapitel 22 Beratung
Kapitel 23 Schatten in der Nacht
Kapitel 24 Verhandlungen
Kapitel 25 Eine überraschende Gelegenheit
Kapitel 26 Pfeile am Himmel
Kapitel 27 Eilmarsch
Kapitel 28 Ohne Ausweg
Kapitel 29 Blanker Stahl
Kapitel 30 Einer von Vielen
Kapitel 31 Ankündigung
Kapitel 32 Historische Anmerkungen:
Impressum neobooks
Kapitel 1 Die Landvermesser
Pferdesoldaten 3
Der Pfad der Comanchen
Military Western
von
Michael H. Schenk
© M. Schenk 2017
Das Land schien endlos.
Man nannte es die „Great Plains“, die großen Ebenen, und sie erstreckten sich von Kanada bis hinunter an den Golf von Mexiko. Ein bis zu 450 Meilen breiter Landstrich, der im Westen von den Rocky Mountains begrenzt wurde und der fast eineinhalb Millionen Quadratmeilen umfasste. Es war ein unendlich wirkendes Grasland, aus dem sich gelegentlich sanfte Hügel erhoben, hin und wieder von kahlen Erhebungen unterbrochen, die weit davon entfernt waren, als Berg bezeichnet zu werden. Sträucher und Bäume wuchsen nur selten und überwiegend entlang der vielen Bachläufe und der großen Flüsse. Dort gab es auch die wenigen ausgedehnten Wälder. Der Boden war von dichtem Gras bedeckt, welches die Nahrungsgrundlage für die Tierwelt bildete. Das zähe Büffelgras erreichte normalerweise eine Höhe von höchstens dreißig Zentimetern, doch es gab auch Regionen an denen es hüfthoch wuchs. Insekten, Schlangen, Präriehunde, Kaninchen und Gabelantilopen bevölkerten das Land, doch die dominierende Lebensform waren die Büffel.
Die Büffel und die Indianer, denen das Land gehörte.
Die „Great Plains“ waren das angestammte Gebiet der Comanchen. Ihre Stämme wanderten mit den großen Herden, die ihnen alles boten, was sie zum Leben benötigten. Das Volk der Comanchen war klug genug, die Bedürfnisse anderer Stämme zu akzeptieren. Der Büffel und die zahlreichen Antilopen boten auch anderen indianischen Völkern die Grundlage des Lebens. Fleisch und Häute, Knochen und Sehnen… Alles wurde verwendet und nichts verschwendet. Die Comanchen waren bei den Weißen gefürchtet und bei den roten Völkern respektiert, denn es gab keine besseren Reiter und Kämpfer. Immer wieder kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Comanchen, Kioways (Anmerkung: alte Schreibweise für Kiowa), Choctaws, Osagen, Cherokees, Pawnees und Sioux, doch insgesamt herrschte ein Gleichgewicht der Kräfte.
Bis die Weißen gekommen waren.
Das Volk der Comanchen mit seinen verschiedenen Stämmen war einst so zahlreich gewesen wie die Grashalme auf der Prärie, doch nun kämpfte es zunehmend um sein Überleben. Erst waren die Weißen gekommen um die Büffel zu jagen. Nicht wegen ihres wertvollen Fleisches, sondern um ihre Häute zu nehmen. Tausende von Büffeln waren abgeschlachtet worden, erst jetzt erholten sich ihre Bestände langsam wieder, denn die großen Jagdgruppen waren verschwunden. Nur einzelne Jäger kamen noch in die Plains. Der Häutehandel lohnte nicht mehr und es war riskant, sich mit den Comanchen anzulegen, auch wenn die Waffen der Weißen gefährlich waren.
Weit bedrohlicher als die Kugeln waren die Krankheiten. Zehntausende von Comanchen waren an den Fiebern des weißen Mannes gestorben. Nicht alleine durch den Kontakt von Mensch zu Mensch. Die Weißen hatten rasch erkannt, dass der rote Mann keine Widerstandskraft gegen seine Krankheiten besaß und einige von ihnen machten sich dies zunutze, indem sie pockenverseuchte Decken oder Kleidung als Tauschware oder Geschenk brachten.
Die Weißen waren selbst ein Seuche, denn sie fluteten in das Land, fertigten ihre Karten und bauten ihre Siedlungen.
Immer wieder brachen Kämpfe aus, immer wieder war ein Friede ausgehandelt worden. Der Friede, der alle Kriege beenden sollte. Doch jeder Vorwand war dem weißen Mann recht, um den Frieden zu brechen, zu kämpfen und weiter in das Land einzudringen. Bis wieder genug Blut geflossen war und ein neuer Vertrag geschlossen wurde.
Vor vielen Jahren war es genug gewesen. Das Volk der Comanchen hatte die texanische Stadt Austin angegriffen und viele Weiße getötet. Es war eine bittere Lektion für die Weißaugen gewesen und zugleich eine bittere Lektion für die Comanchen, denn anschließend machten Texas-Rangers und U.S.-Army Jagd auf die „blutrünstigen Wilden“.
Wieder schloss man einen Vertrag und wieder schrumpfte das Land der Comanchen.
Der neue Vertrag schien besser.
Die meisten Weißen respektierten ihn.
Die meisten Comanchen respektierten ihn.
Aber nicht alle.
Running Buffalo und seine Männer beobachteten die Eindringlinge schon seit vielen Tagen.
Vor einer Woche war der erfahrene Krieger und Unterhäuptling mit seiner Gruppe ausgeritten. Die großen Herden der Büffel begannen zu wandern und es wurde Zeit, das Lager abzubrechen und ihnen zu folgen. So suchten Running Buffalo und seine Begleiter nach den Büffeln, und nach einem neuen Lagerplatz, doch was sie fanden, das waren weiße Eindringlinge.
Ein Treck von zwanzig Weißen mit fünf Planwagen, der über die Plains zog und sich sehr ungewöhnlich verhielt. Die Männer bauten alle zwei oder drei Tage ein kleines Zeltlager auf, hantierten dann mit merkwürdigen Stangen und blitzenden Metallobjekten, und zogen dann ein Stück weiter.
Running Buffalo war sich nicht sicher, was dies zu bedeuten hatte. Er lag mit seinem Freund Wild Elk im hohen Büffelgras, keine hundert Meter von den Eindringlingen entfernt, die wieder einmal ein Lager errichteten.
„Sie wollen keine Häuser bauen“, raunte Wild Elk. „Sie haben keine Frauen und Kinder dabei. Wenn sie Häuser bauen wollen, dann haben sie immer ihre Familien dabei. Diese Männer nicht.“
„Du hast recht. Hier gibt es ohnehin nicht genügend Holz, um die Stangen eines Tipis zu schlagen. Aber es sind auch keine Jäger. Auf den Wagen sind Zelte und Vorräte, und diese seltsamen Dinge, mit denen sie hantieren.“
Die weißen Männer waren ihnen unheimlich. Sie taten seltsame Dinge. Steckten die Stangen mit bunten Tüchern in den Boden, stellten dreibeinige Gestelle auf, auf denen sich metallene Gegenstände aus Messing oder Gold befanden. Zwei ähnelten großen Teleskopen, wie die beiden Krieger sie schon gesehen hatten, doch die anderen waren von rätselhafter Bedeutung.
Wild Elk verlagerte sein Gewicht ein wenig. „Es gibt Weiße, die wollen einfach nur wissen, welche Pflanzen und Tiere es gibt. Wie das deutsche Weißauge, welches zwei Jahre bei uns lebte. Weißt du noch, wie er alle möglichen Dinge in seinem Buch zeichnete und andere in seine Gläser stopfte?“
„Er sprach häufig in wirren Worten“, erinnerte sich Running Buffalo. „Er nannte das „Latten“ oder so ähnlich. Ein wirklich verrückter Mann.“
„Vielleicht sammeln diese hier ebenfalls Sachen für ihre Gläser.“
„Unsinn“, brummte Running Buffalo. „Sie haben viel zu wenige Gläser dabei. Aber sie schreiben und malen ebenfalls sehr viel.“
„Wir sollten näher schleichen. Vielleicht reden sie auch dieses Latten und dann wissen wir, dass sie harmlos sind.“
„Nein, sie reden kein Latten. Sie sprechen die Zunge der weißen Männer.“
„Aber sie benutzen auch sehr seltsame Worte.“ Wild Elk seufzte. „Jedenfalls sind sie Eindringlinge und wir sollten sie töten.“
„Wenn wir sie einfach töten, dann kommen die Soldaten.“
„Ich fürchte die Soldaten nicht.“
Running Buffalo nickte. „Auch ich fürchte sie nicht. Aber unser Volk fürchtet sie. Wir haben schon oft gegen die Texaner und gegen Langmesser oder Marschiereviel gekämpft. Wir kämpfen besser“, ergänzte er, durchaus zufrieden. „Aber dafür sind sie viel zahlreicher als wir. Wir kämpfen erst, wenn wir es müssen, Wild Elk, nicht vorher.“
„Wir müssen immer kämpfen. Die Weißen dringen immer wieder und immer weiter in unsere Jagdgründe vor. Wenn wir diese hier gehen lassen, dann werden wieder andere kommen. Immer mehr, bis wir sie nicht mehre aufhalten können.“
„Der Vertrag sagt, dass sie nicht kommen dürfen.“
„Aber sie sind da.“
Running Buffalo nickte erneut. „Ja, sie sind da. Gut, ich werde näher heranschleichen. Vielleicht erfahre ich, was die Eindringlinge hier wollen.“
„Ich werde dich begleiten.“
„Das wirst du nicht. Falls sie mich entdecken, musst du die anderen benachrichtigen.“
Das Gras stand hüfthoch und bot gute Deckung. Dennoch musste man sehr vorsichtig sein, denn die Bewegung der Halme konnten verräterisch sein.
Running Buffalo war zutiefst beunruhigt. Diese Männer waren sehr tief in das Gebiet der Comanchen eingedrungen. Es war ungewöhnlich, dass sie nicht längst von einer anderen Jagdgruppe des Volkes entdeckt worden waren, zumal die Fremden keine Anstalten machten, sich verborgen zu halten oder ihre Spuren zu verwischen. Viele von ihnen waren auch ungewöhnlich gekleidet. Sie trugen Anzüge, wie sie in den großen Städten der Weißen üblich waren. Running Buffalo wusste dies sehr genau, denn er war bei der Schlacht von Austin dabei gewesen. Einige trugen die praktischere Bekleidung, die im Westen üblich war. Zwei waren Jäger in Lederkleidung, die dem Treck wohl als Scouts dienten.
Die beiden Jäger waren wahrscheinlich die gefährlichsten Gegner. Während sich die anderen mit ihren Geräten beschäftigten, achteten diese beiden auf die Umgebung. Running Buffalo glaubte die Anspannung der Jäger zu spüren und achtete darauf, sie nicht direkt anzusehen. Männer mit geschärften Sinnen spürten, wenn man sie beobachtete. Dennoch war es leicht, auch solche Feinde im Auge zu behalten. Man konzentrierte sich auf einen Punkt in ihrer unmittelbaren Nähe und sah ihre Bewegungen in den Augenwinkeln.
Der erfahrene Krieger nahm sich Zeit. So hoch das Gras auch stand, einer der Jäger saß auf dem hohen Bock eines der Planwagen und verfügte von dort oben über einen guten Überblick. Wurde der Comanche entdeckt, so geriet er in ernste Gefahr, denn die Pferde der beiden Späher standen weit zurück. Ein Nachteil des flachen und übersichtlichen Landes.
Running Buffalo gelang es, unentdeckt die Lücke zwischen zwei Planwagen zu erreichen. Er beherrschte die Sprache des weißen Mannes und so konnte er abermals Fetzen ihrer Gespräche mithören. Zwei Begriffe erklärten ihm endlich, was die Eindringlinge beabsichtigten. So schnell es ihm möglich war, kroch er zu seinem Freund zurück.
„Sie vermessen das Land und fertigen genaue Karten davon an“, berichtete er Wild Elk.
„Warum sollten sie das tun?“ Der Freund überlegte und sein Gesicht verfinsterte sich. „Es ist unser Land. Warum machen sie Karten von unserem Land? Wir brauchen keine Karten von unserem Land.“
„Weiße brauchen Karten.“ Running Buffalo sah düster zum dem kleinen Treck hinüber. „Sie brauchen Karten für ihre Straßen und ihre Städte.“
„Aber dies ist unser Land und hier wollen wir ihre Straßen und Städte nicht.“
„Wenn sie Karten von unserem Land anfertigen, dann wollen sie hier ihre Straßen und Städte bauen. Hier, in unserem Land.“
„Dann sollten wir sie töten“, stieß Wild Elk hervor.
Der Unterhäuptling nickte. „Ja, das sollten wir. Lass uns zu den anderen zurückgehen und uns beraten.“
In der Nacht kehrten sie zurück.
Zwölf Krieger, die ihre Reittiere zurückließen. Sie taten es nur ungern, denn die Pferde waren es, welche die Comanchen zu gefürchteten Reitern machten, doch hier mussten sie sich dem Feind unbemerkt nähern, damit der Überraschungsangriff gelang.
Die Weißen hatten drei Wachen aufgestellt, die allesamt nicht besonders aufmerksam waren. Es war Nacht und in der Nacht griffen Indianer nicht an. Es hieß, dass die Seele eines Kriegers, der in der Nacht stirbt, ewig durch das Dunkel irren müsse. Die Weißen waren fest davon überzeugt, und normalerweise traf diese Regel auch zu. Doch es gab eine Ausnahme und diese Nacht gehörte dazu, denn es war Vollmond. In den „Great Plains“ nannte man ihn auch den Comanchen-Mond oder, wenn er sich rot färbte, den Blut-Mond.
Doch in dieser Nacht war es der Boden der Prärie, der sich rot färbte.
Die drei Wachen starben zuerst. Pfeile und Messer töteten sie lautlos und schnell. Die Krieger huschten in das Lager der Schläfer und die meisten Weißen starben, ohne wieder aufzuwachen. Die Übrigen kämpften gegen Schlaf und Decke. Sie waren ohne Chance. Nur Wild Elk erlitt einen Streifschuss, denn der Jäger, den er mit dem Tomahawk erschlug, feuerte seinen Colt unter der Decke verborgen ab.
Dann herrschte Stille.
Die Comanchen stießen kurze Schreie des Triumphes aus. Sie nahmen Waffen, Munition und Pferde, und machten sich nicht die Mühe, ihre Spuren zu verwischen, denn dies waren die „Great Plains“, das Land der Comanchen.
Kapitel 2 Garnisonsleben
Fort Belknap war in vielerlei Dingen ungewöhnlich.
Dies betraf Form, Baumaterial, Aufgabe und Stärke seiner Garnison. Von oben betrachtet besaß es die Grundform des Viertels einer Torte. An der Spitze dieses Tortenstücks lagen die Unterkünfte der Kompanien und ihrer Offiziere. Der Kreisbogen erstreckte sich vom Norden zum Westen. Im Norden lagen die Quartiere der höheren Offiziere, im Westen, wo der Bogen endete, die Ställe und Korrals für die Reittiere und Gespannpferde. Es gab weitläufige Gärten für Gemüse und eigene Getreidefelder, eine Bäckerei, einen großen Store und sogar ein Gebäude für Billard. In der Mitte des „Tortenstücks“ lag der Paradeplatz.
Das Fort bestand seit November 1851 und Lieutenant-Colonel Freeman hatte fast alle Gebäude aus behauenem Naturstein errichten lassen. Für Militärposten an der Grenze zum Indianergebiet ein ungewöhnlicher Aufwand, war Holz doch wesentlich leichter verfügbar.
Es gab keinerlei Befestigungen. Keine Mauer und keine Palisade, nicht einmal einen Wachtturm. Fort Belknap war nicht eigentlich als Fort, als Befestigung angelegt, sondern als Garnison. Niemand wäre so verrückt gewesen, sich mit dieser anzulegen. Im Jahr 1856 waren hier eine Batterie Feldartillerie, ein Regiment Infanterie und ein volles Regiment Kavallerie stationiert.
Das Fort lag direkt am Brazos River, nahe der aufblühenden Stadt Newcastle und war die nördlichste Anlage einer Reihe von Stützpunkten, die sich vom Rio Grande bis zum Red River erstreckte. Sie schützten eine der alten Handelsrouten, die zum Wesentlichen aus dem sogenannten Santa Fe Trail bestand, und die texanische Grenze gegenüber Comanchen und Kioways.
Die Armee hatte einen schweren Stand bei der Sicherung der Grenze, zumal immer wieder Trecks von Händlern oder Siedlern zu eskortieren waren. Die mannigfaltigen Aufgaben waren mit Fußtruppen nicht zu bewältigen. Die drei berittenen Regimenter, die 1st und 2nd U.S.-Dragoons und das Regiment of Mounted Riflemen, waren hoffnungslos überfordert. Mit knapp 2.100 Berittenen sollte die Army Präsenz gegenüber den Indianern zeigen. Alleine das Volk der Comanchen schätzte man auf über 100.000 Stammesmitglieder, wobei man von 25.000 Kriegern ausging. Doch neben den Comanchen gab es noch eine Vielzahl anderer indianischer Völker. Der Überfall der Comanchen auf die Stadt Austin hatte den Kongress schließlich davon überzeugt, dass man es bei Indianern mit gefährlichen Gegnern zu tun hatte und so bewilligte man im Jahr 1855 die Aufstellung zweier weiterer berittener Regimenter – die 1st und 2nd U.S.-Cavalry.
Es gab einen wesentlichen Unterschied zwischen einem Reiter der Dragoons und einem der Cavalry. Dragoner waren für den Kampf zu Pferde und zu Fuß vorgesehen und daher mit Revolver, Säbel und einem Karabiner bewaffnet, so erbärmlich letzterer auch sein mochte. Kavallerie sollte hingegen ausschließlich zu Pferde kämpfen und ihre Bewaffnung beschränkte sich daher auf Revolver und Säbel.
Die 2nd U.S.-Cavalry war am 28. Mai 1855 in Louisville, im Unionsstaat Kentucky, aufgestellt worden. Schon am 27. September des gleichen Jahres marschierte sie in einer Stärke von 750 Mann nach Fort Belknap. Regimentskommandeur war Colonel Albert Sidney Johnston, sein Stellvertreter Lieutenant-Colonel Robert Edward Lee. Zu den drei Majoren der Truppe gehörte auch Matt Dunhill, ein bewährter Captain der U.S.-Dragoons, dessen Versetzung zur Kavallerie mit der Beförderung zum Major verbunden worden war.
Matt Dunhill war ein schlanker und hochgewachsener Mann von 43 Jahren. Sein Haupthaar wurde allmählich ein wenig schütter. Umso dichter wirkte der Dragonerbart, der seine Oberlippe zierte und nachts sorgfältig von einer Bartbinde geschützt wurde. In den letzten Jahren wurde Matt vielleicht ein wenig eitel, doch das mochte auch daran liegen, dass er seit neun Jahren mit der nun 36-jährigen Mary-Anne verheiratet war. Ihr Sohn Mark war gerade acht Jahre alt. Das Leben hatte sich für Matt Dunhill verändert, denn er trug nun nicht mehr nur die Verantwortung für sich selbst und seine Truppe, sondern auch für seine Familie. Eine Verantwortung, der er nicht immer so gerecht werden konnte, wie er sich dies als Ehemann und Vater wünschen mochte. Die dienstlichen Verpflichtungen gingen nun einmal vor und hierzu gehörte auch, dass er und seine Familie in den vergangenen Jahren bereits dreimal in andere Stützpunkte umgezogen waren. Vieles befand sich im Umbruch, auch in der Armee, und diese nahm nur wenig Rücksicht auf die Befindlichkeiten des Einzelnen.
Mary-Anne hatte sich überraschend schnell an das Leben als Soldatenfrau gewöhnt. Sie klagte nicht, wenn ihr Captain mit seiner Kompanie ausrückte, blickte der verschwindenden Abteilung mit erzwungenem Lächeln hinterher und strahlte förmlich, wenn sie Matt gesund zurückkehren sah. Unverzagt legte sie in jedem Fort oder Camp kleine Beete für Kräuter und Gemüse an, in der Hoffnung, die Früchte ihrer Arbeit auch ernten zu können. Häufig war dies nicht der Fall, so dass sie gelegentlich scherzhaft meinte, es lohne kaum, die Kisten und Koffer auszupacken, da sicher schon der nächste Marschbefehl geschrieben sei. Doch sie klagte nicht, liebte Matt von Herzen und widmete sich der Erziehung des kleinen Mark.
Die Beförderung ihres Mannes zum Major gab ihr die Hoffnung, dass er nun nicht mehr so oft hinaus musste. Ein Major rückte nur mit großen Abteilungen aus. Patrouillen und Eskorten waren die Sache von Captains und Lieutenants. Matt würde nun mehr mit Papier, als gegen die Indianer kämpfen.
Das Abendessen war bereit. Mark saß in dem kleinen Wohnzimmer und beschäftigte sich mit einem Buch. Sein Gesicht war hoch konzentriert und seine Lippen formten gelegentlich die Worte, die er las. Er war ein guter Schüler, vielleicht auch, weil seine Mutter gelegentlich in der kleinen Schule des Forts aushalf. Hier wurden alle Kinder der Offiziere und einfachen Soldaten in einer gemeinschaftlichen Klasse unterrichtet.
Mary-Anne hatte frische Limonade zubereitet. Wasser, mit etwas Zitrone und einer Spur Zucker, um den Geschmack abzurunden. Sie füllte das Getränk in zwei leere Flaschen und trug sie auf die kleine Veranda des Hauses hinaus. Boden und Überdachung bestanden aus Holz, die stützenden Säulen hingegen aus gemauerten Steinen. Mary-Anne hatte Haken in die Querbalken schlagen lassen und dort mit Wasser gefüllte Krüge aufgehängt. Krüge, die groß genug waren, so dass sie die Flaschen mit der Limonade hinein stellen konnte. Die Verdunstung würde dafür sorgen, dass das Getränk gekühlt wurde. Matt würde sich über diese Erfrischung freuen, denn der Tag war heiß gewesen und er hatte viele Stunden in der Sonne gestanden und der Ausbildung zweier Kompanien beigewohnt. Eigentlich war er überfällig, denn es war schon seit einiger Zeit Dienstschluss. Aber wie so oft würden die Offiziere wieder zusammensitzen und die Ereignisse des Tages besprechen.
„Wo bleibt Dad?“ Mark kam auf die Veranda. „Ich habe Hunger.“
Mary-Anne strich ihm über die Haare und lächelte. „Du hast recht, wir sollten jetzt essen, sonst wird noch alles kalt. Dein Vater hat sicher wieder einmal etwas mit dem Colonel zu bereden.“
„Dad redet ziemlich oft mit dem Colonel“, stellte der Achtjährige fest.
„Ja, das tut er. Weißt du, Mark, dein Vater ist nun einmal ein sehr erfahrener Offizier und war bei den Dragoons. Die meisten Offiziere im Regiment sind neu oder kommen von anderen Waffengattungen und so hören sie sich an, was dein Dad ihnen zu erzählen hat.“
„Die Dragoner sind besser als die Kavallerie.“
„Wie kommst du denn auf diese Idee?“ Sie lachte und schob ihn durch die Tür ins Wohnzimmer.
„Ich habe gehört, wie Dad das zu einem anderen Offizier gesagt hat.“
„Er hat das aber gewiss nicht so gemeint, junger Mann. Unser Kavallerie-Regiment hat noch keinerlei Erfahrung und muss sich diese erst erwerben. Dein Dad hilft dabei, dass die zweite Kavallerie ganz bestimmt das allerbeste Regiment überhaupt wird.“
Sie aßen und Mary-Anne blickte immer wieder auf die kleine Kaminuhr. An diesem Tag wurde es wirklich sehr spät.
„Ich bleibe auf, bis Dad da ist“, meinte Mark.
„Morgen ist Schule, junger Mann. Aber du kannst im Bett noch etwas lesen. Er kommt bestimmt früh genug, um dir noch eine gute Nacht zu wünschen.“
Der Junge wusch sich, zog sein Nachthemd über und legte sich dann mit einem Buch ins Bett. Keine halbe Stunde später war er eingeschlafen. Mary-Anne gab ihm einen sanften Kuss, legte das Buch zur Seite und zog dann die Tür zu seinem Zimmer zu.
Sie hatte das Essen warm gestellt, dennoch begann es zunehmend abzukühlen. Allmählich machte sie sich nun doch Gedanken. Wenn es derartig spät wurde, dann musste etwas vorgefallen sein. Gab es Befehle für das Regiment? Sollte es zum ersten Mal ausrücken?
Sie hörte den diensthabenden Trompeter das Signal „To the Quartiers“ blasen. Das Hornsignal befahl die Soldaten in ihre Quartiere.
Nach Dienstschluss waren die Soldaten ihren jeweiligen Vergnügungen nachgegangen. Sie spielten Karten, würfelten oder suchten das Store auf, in dem auch Alkohol ausgeschenkt wurde. Alkohol war ein beständiges Problem von Offizieren und Mannschaften. In Fort Belknap war davon nicht viel zu bemerken, denn die Ausbildung hielt die Männer zu sehr auf Trab und der Fortkommandant hatte sehr strikte Auflagen für den Ausschank erlassen. Doch in den abgelegenen Forts und Camps war Mary-Anne schon manchem Mann begegnet, welcher der Trunksucht zu verfallen drohte.
Mary-Anne trat auf die Veranda hinaus und blickte zu dem Bereich hinüber, in dem sich die Kommandantur und die Quartiere der höheren Offiziere befanden. Endlich erkannte sie Matt, der rasch näher kam und sie endlich in die Armee schloss.
„Tut mir Leid, Liebes, aber der Dienst…“
„Es wird besser, wenn das Regiment in den Einsatz geht“, entgegnete sie verständnisvoll, wobei ihre Bemerkung nicht ohne Hintergedanken war.
„Das wird so rasch wohl nicht der Fall sein“, bestätigte er ihre Hoffnung. „Colonel Sibley hat angekündigt, dass das Regiment erst mit neuen Karabinern ausgerüstet werden soll.“
„Ich dachte, die Cavalry bekommt keine Karabiner.“
„Scheinbar hat man seine Meinung geändert. So gut die neuen sechsschüssigen Revolver auch sind, der Pfeil eines indianischen Kriegsbogens fliegt weiter.“ Matt sah das leichte Erschrecken in ihrem Gesicht und küsste ihre Wange.
Mary-Anne war nicht nur sehr hübsch, sondern auch gebildet und engagiert. Ihr war rasch bewusst geworden, wie sehr sich das Leben der einfachen Soldatenfamilien von dem der Offiziersfamilien unterschied. Sie versuchte deren Los zu erleichtern. Ein Soldat verdiente nicht viel und war er verheiratet, dann musste seine Frau jede Arbeit annehmen, damit man über die Runden kam. Putzarbeiten, Näharbeiten, Wäsche oder Backen für die Garnison brachten wertvolle Cents und doch langte es oft vorne und hinten nicht. Nicht selten lag dies daran, dass die Ehemänner beim Spiel verloren oder zu viel von ihrem Sold vertranken.
Mary-Anne hatte eine schmiedeeiserne Sitzgruppe mit in die Ehe gebracht. Einen kleinen Tisch, zwei Stühle und eine besondere Bank, deren kleine Kufen leichte Schaukelbewegungen erlaubten. Matt genoss es, am Abend mit seiner Frau auf der Bank zu sitzen und mit ihr über die Ereignisse des Tages zu plaudern.
„Mark schläft bereits“, berichtete sie. „Oder er tut doch zumindest so.“
„Er ist ein guter Junge.“ Matt war stolz auf den Achtjährigen und sah gerne darüber hinweg, wenn dieser doch einmal über die Stränge schlug.
Die Kinder im Fort wurden tagsüber unterrichtet, doch ab dem späten Nachmittag dachten sie sich immer wieder einen Schabernack aus. Meist waren es harmlose Späße, aber in der letzten Woche hatten sich ein paar der größeren Jungen ein paar Schläge mit dem Stock eingefangen, da sie Kletten unter die Sättel einiger Kavalleristen geschoben hatten.
„Lass uns hineingehen“, schlug sie vor. „Ich habe dein Essen warm gestellt.“
„Ich habe noch keinen Hunger“, erwiderte er verlegen.
Ihr Blick wurde skeptisch. „Dann beschäftigt dich etwas, Matt. Immer wenn du keinen Hunger hast, dann machst du dir um etwas Gedanken.“
Matt zuckte mit den Schultern und zog sie erneut etwas enger an sich. „Nun ja, das Regiment ist praktisch fertig ausgebildet und du weißt, wie dringend man es entlang der Grenze benötigt. Ich denke, dass Sibley bald Befehle für uns bekommen wird. Wahrscheinlich wird man einige der Kompanien auf die Forts verteilen.“
„Ich habe mich daran gewöhnt, dass wir wie eine Indianerhorde herumziehen“, sagte sie lächelnd. „Aber für Mark ist es schwierig. Hier hat er Freunde und wer weiß, wie es in einer anderen Garnison aussieht. Es gibt nicht überall Familien.“
„Ich weiß.“ Manchmal konnte Matt noch immer nicht fassen, mit ihr verheiratet zu sein.
Er hatte sie während einer Patrouille in Louisiana kennengelernt und sich sofort in die Tochter eines wohlhabenden Händlers verliebt. Das war kaum verwunderlich, denn die junge Frau war hübsch, intelligent und heiß begehrt. Sehr viel überraschter war Matt von der Tatsache, dass sie seinem Werben nachgegeben hatte. Ihr Vater war nicht begeistert, da Mary-Anne in eine vermögende Familie hätte einheiraten können und somit das zivilisierte Leben in einer Stadt genossen hätte. Stattdessen war sie mit Matt Dunhill vor den Altar getreten, damals noch ein einfacher Captain. Nein, Mister John Jay Jones hatte sich Besseres erhofft, doch zwei Faktoren führten zu seiner Zustimmung: Mary-Annes feststehender Entschluss und die Liebe des Vaters zu seiner Tochter. Obwohl es Matt widerstrebte, musste er allerdings akzeptieren, dass „JJJ“ seiner Tochter eine stattliche Mitgift zugestand.
„Wir werden unsere Zweisamkeit verschieben müssen“, flüsterte sie. „Da kommt Daddy Lee. Wenn er so spät am Abend zu uns kommt, dann will er sicher etwas Wichtiges mit dir bereden.“
Matt beobachtete den schlanken Offizier, der sich langsam näherte. Lieutenant-Colonel Robert Edward Lee war sicherlich ein ganz besonderer Mann. Er hatte seine Karriere im Corps of Engineers begonnen und war, für seine Leistungen im Ingenieurwesen während des amerikanisch-mexikanischen Krieges, belobigt worden. Man machte ihn zum Superintendent der Militärakademie von West Point und gab ihm endlich, im Jahr 1855, das ersehnte Feldkommando. Nun war er stellvertretender Kommandeur der 2nd U.S.-Cavalry und erwies sich als Offizier, der von Vorgesetzten und Untergebenen gleichermaßen hoch respektiert wurde. Aufgrund seiner fürsorglichen Art wurde er gelegentlich, wenn auch nur hinter vorgehaltener Hand, als „Vater des Regiments“ bezeichnet.
Selbst Matt Dunhill empfand Lee gegenüber nicht nur Respekt. Lee strahlte eine Wärme und Freundlichkeit aus, die es schwer machte, ihn ihm nicht eine Vaterfigur zu sehen. Zugleich war er ein überaus fähiger Offizier, der auch unnachgiebige Härte zeigen konnte, wenn dies erforderlich wurde.
„Guten Abend, Misses Dunhill. Guten Abend, Mister Dunhill.“ Lee grüßte freundlich und zeigte jenes Lächeln, mit dem er jedermann für sich einnehmen konnte und mit dem er so manches Wortduell geschlichtet hatte. „Ich bedauere sehr, dass ich so spät noch störe, aber ich würde gerne noch ein paar Worte mit Ihrem Gemahl wechseln, Misses Dunhill.“
Mary-Anne erwiderte mit ihrem bezaubernden Lächeln. „Darf ich Ihnen etwas Limonade anbieten, Mister Lee? Ich habe sie frisch zubereitet.“
„Das wäre sehr freundlich, Misses Dunhill. Es war ein heißer Tag und die Nacht verspricht sehr schwül zu werden.“
Mary-Anne mochte Lee. Für ihn musste der Dienst besonders schwer sein. Lee war schon viele Jahre verheiratet, doch im Jahr 1850 war seine Frau an rheumatischer Arthrose erkrankt und konnte ihren Gatten daher nicht zu seinen Dienstorten begleiten. Seine Frau lebte in Arlington, Virginia, und die beiden waren einander von Herzen zugetan. Man wusste, dass es eine rege Korrespondenz zwischen den Eheleuten gab.
Mary-Anne verschwand im Haus, und Matt und Lee setzten sich auf die Veranda. Die junge Frau zog sich wieder zurück, nachdem sie die Limonade gebracht hatte. Bis dahin tauschten die beiden Offiziere Belanglosigkeiten aus, doch nun kam Lee auf das zu sprechen, was ihn offensichtlich beschäftigte.
„Wie Sie bereits gehört haben, sollen wir Karabiner für unser Regiment bekommen. Nagelneue Sharps, wie sie schon bei den Dragoons eingesetzt werden. Bei unseren hat man eine Verbesserung durchgeführt. Man muss kein einzelnes Zündhütchen mehr aufsetzen, sondern es gibt einen automatischen Zündhütchensetzer, der beim Spannen des Hahns ein Zündhütchen auf das Piston der Waffe schiebt. Das nennt sich, wenn ich mich recht erinnere, Maynard Primer. Jedenfalls stand das so in der Ankündigung der Waffenlieferung. Nun, Mister Dunhill, Sie kommen ja von den Dragoons. Haben Sie Erfahrung mit der Sharps?“
„Mit dem Karabiner? Ja, Sir. Diese Erfindung von Maynard ist mir allerdings unbekannt.“
„Hm. Immerhin gehören Sie zu den erfahrenen Offizieren im Regiment und ich würde es begrüßen, wenn Sie morgen die Waffen in Empfang nehmen und sie genauestens auf dem Schießstand prüfen. Es wäre nicht sehr erfreulich, wenn wir mit Karabinern ausrücken, die nicht für den Felddienst taugen.“
„Selbstverständlich, Sir, ich werde mich darum kümmern.“
„Sehr schön, Mister Dunhill. Nun, dann will ich Sie nicht länger von Ihrem verdienten Dienstschluss abhalten. Grüßen Sie Ihre reizende Frau nochmals von mir und danken Sie ihr in meinem Namen für die vorzügliche Limonade.“
„Das werde ich tun, Sir.“
Der Lieutenant-Colonel hatte den richtigen Zeitpunkt abgepasst. Während er sich langsam entfernte, blies der diensthabende Hornist das Signal „to extinguish lights“, welches dazu aufforderte, alle Lichter zu löschen. Natürlich mit Ausnahme jener, die für den Wachdienst erforderlich waren.
„Und? Was lag Daddy Lee auf dem Herzen?“ Mary-Anne stellte das Essen auf den Tisch.
Matt hatte eigentlich keinen Hunger, aber er aß etwas, um seine Liebste nicht zu enttäuschen. „Ich soll morgen die Waffenlieferung überprüfen.“
Sie setzte sich zu ihm und sah ihn forschend an. „Weil du die meiste Kampferfahrung hast, nicht wahr?“
„Ich bin hier nicht der Einzige mit Kampferfahrung.“
„Ich habe das Gefühl, dass ihr bald zum ersten Mal ausrücken werdet.“
Er lächelte sie an und schwieg. Er hatte die gleiche Vorahnung.
Matt Dunhill erwachte mit den Klängen der „Reveille“. Wie üblich war Mary-Anne schon auf und bereitete den Morgenkaffee zu. Das Frühstück würde Matt in der kleinen Offiziersmesse einnehmen. Als Mark aus seinem Bett stieg, war sein Vater schon fertig angekleidet. Wie üblich prüfte Mary-Anne den Sitz der Uniform. Es war noch nicht lange her, dass Matt erstmals den Rock eines Majors angezogen hatte. Als Linienoffizier zeige die lange Uniformjacke jetzt zwei Reihen Knöpfe und nicht nur die einzelne von Offizieren im Kompanie-Rang. Das neue Tschako, die Albert-Cap, gefiel ihr allerdings weniger. Es war steif, verjüngte sich ein wenig nach oben und besaß einen breiten und eckigen Mützenschild. Oben auf der Krone war vorne ein kleiner Stoffball, das sogenannte Pompom, in der gelben Farbe der Kavallerie befestigt. Mary-Anne hatte die alte weiche Mütze mit der flachen Krone adretter empfunden. Dafür schimmerten jetzt aber die Eichenblätter eines Majors auf den schmalen Schulterstreifen, die an schmale rechteckige Kästchen erinnerten.
Matt legte die rote Schärpe aus Seide zweimal um die Taille und verknotete sie an der linken Hüfte, wo die beiden schweren Quasten herunterhingen. Mary-Anne half ihm, den neuen Waffengurt umzulegen. Er war nun nicht mehr weiß, sondern aus geschwärztem Leder und wurde mit einer rechteckigen Schließe fixiert, die den amerikanischen Adler mit der Schriftrolle zeigte. Das umgebende Eichenlaub war versilbert. Das neue Koppelschloss trugen nun alle Kavalleristen, gleich welchen Ranges. Auch die Uniformknöpfe waren neu, fast halbkugelig in ihrer Form, und trugen den Adler.
„Du siehst sehr präsentabel aus“, stellte sie zufrieden fest.
„Keinesfalls so präsentabel wie du.“ Sie umarmten und küssten sich kurz, dann verließ Major Dunhill das Haus. Wenig später verkündete der „Roll Call“ den Beginn des morgendlichen Appells. Erst danach würde es Frühstück geben und jeder Soldat war froh, wenn die Tagesbefehle nach dem Appell möglichst kurz gehalten wurden.